Mit einer Einleitung von seiner Cousine Lady *****
(„Madge Plunket“)
Herausgegeben und bebildert von George duMaurier
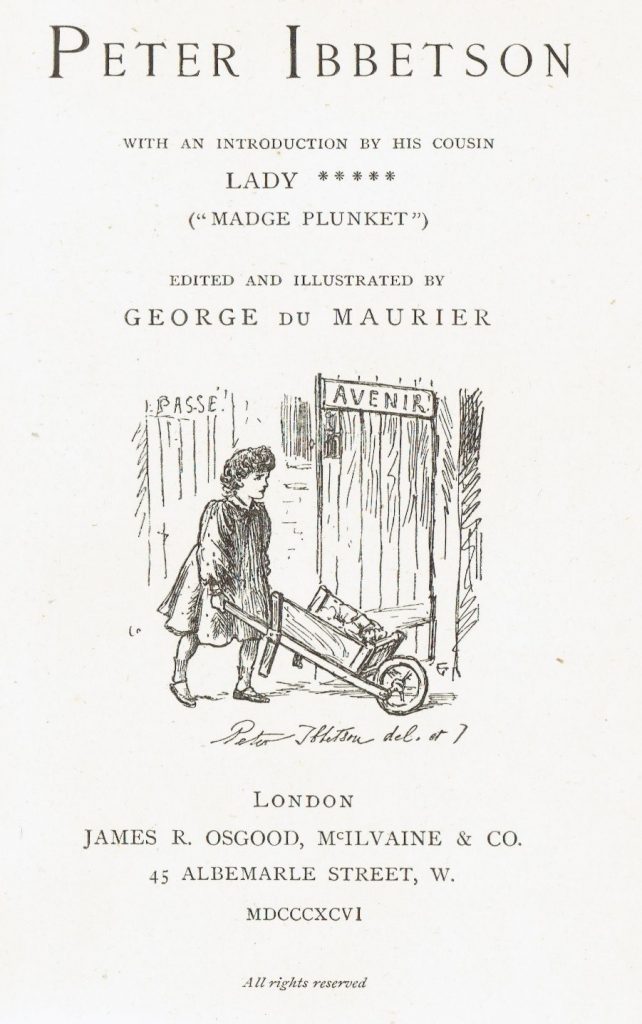
O toi qui m’apparus dans ce desert du monde,
Habitante du ciel, passagère en ces lieux!
(O du, die du mir erschienst in dieser Wüste von Welt,
Bewohnerin des Himmels, Mitreisende hier!)
Alphonse de Lamartine: Invocation
Einleitung
Der Autor dieser einzigartigen Autobiografie war mein Cousin, der im Asyl für kriminelle Wahnsinnige in – verstarb. Er hatte dort drei Jahre eingesessen.
Er war dorthin verlegt worden nach einem plötzlichen und gewalttätigen Anfall von Mordlust (der glücklicherweise keine ernsthaften Folgen hatte) im Gefängnis von – , wo er nach seiner Verurteilung wegen Mordes an seinem Verwandten – eine lebenslängliche Zuchthausstrafe verbüßte.
Er war ursprünglich zum Tode verurteilt worden.
In dem erwähnten Asyl verfasste er diese Lebenserinnerungen, und ich erhielt das Manuskript kurz nach seinem Hinscheiden zusammen mit einem Brief, der mich sehr rührte. Er erinnerte darin an unsere frühere Freundschaft und ernannte mich zu seiner literarischen Vollstreckerin.
Es war sein Wunsch, dass die Geschichte seines Lebens wortwörtlich so veröffentlicht werden sollte, wie er sie geschrieben hatte.
Ich habe es nicht ratsam gefunden, dies zu tun. Es würde sinnloserweise einen alten Skandal wieder zum Leben erwecken, der längst begraben und vergessen ist, und würde Menschen Schmerz und Verdruss bereiten, die noch am Leben sind.
Seine Memoiren bedürfen auch nicht der Rechtfertigung bei denen, die ihn oder irgendetwas von ihm kannten – die einzigen Menschen, die es betrifft. Seine schreckliche Tat ist längst verziehen worden von denen (und das sind viele), die wussten, wie sehr er provoziert worden war, und die den Charakter das Provokateurs kannten.
Nach reiflicher Überlegung und aus gutem Grund beschloss ich (um die Wünsche des Toten nicht in ihrer Gesamtheit zu verwerfen), die Memoiren mit bestimmten Änderungen und Weglassungen zu veröffentlichen.
Ich habe fast alle Namen von Menschen und Orten geändert; bestimmte Details unterdrückt und einige Passagen seines Lebens weggelassen (den größten Teil seiner Schulzeit zum Beispiel, und seine kurze Karriere als Rekrut bei den Horse Guards), da sie leicht zur Identifikation und Verärgerung von noch Lebenden führen könnten, denn er wird manchmal recht persönlich und ist vielleicht nicht immer gerecht. Einige andere Ereignisse habe ich nacherzählt (vor allem sein Strafverfahren vorm Old Bailey) und durch etwas Ähnliches ersetzt, soweit sich das machbar war, ohne dass die Plausibilität litt.
Zugleich möchte ich hervorheben, dass, abgesehen von diesen Änderungen, jeder Umstand seines natürlichen Lebens, wie er ihn selbst beschreibt, absolut und bis ins kleinste Detail wahr ist, wie ich mich vergewissern konnte.
Für den ersten Teil davon, das Leben in Passy, das er mit so viel Liebe beschreibt, kann ich persönlich bürgen; ich bin die Cousine Madge, auf die er ein- oder zweimal Bezug nimmt.
Ich erinnere mich der gemütlichen Bleibe, in der er mit seinen Eltern (meinem lieben Onkel, meiner Tante) lebte; der entzückenden Madame Seraskier, ihres Ehemanns, ihrer Tochter, ihres Hauses, Parva sed apta, des Majors Duquesnois und alles anderen.
Und obgleich ich ihn seit seinem zwölften Lebensjahr nicht mehr gesehen habe – damals starben seine Eltern und er zog nach London – (ich habe ja den größten Teil meines Lebens im Ausland verbracht), schrieb er mir doch hin und wieder.
Ich konnte auch mancherlei Information über ihn von anderen erhalten, insbesondere von einem Verwandten des verstorbenen Ehepaars Lintot, der ihn gut kannte, und von verschiedenen Offizieren seines Regiments, die sich an ihn erinnerten; auch von der Tochter des Vikars, die er im Haus von Lady Cray traf und die sich genau des Gesprächs erinnerte, das sie beim Essen mit ihm führte, an sein plötzliches Unwohlsein und seine lange Unterredung mit der Herzogin von Towers unter der Esche am nächsten Morgen; sie war eine der Croquet-Spielerinnen.
Er war der schönste Junge, den ich je sah, und so bezaubernd, lebhaft und liebenswert, dass jeder ihn mochte. Er hasste Grausamkeit, besonders an Tieren (recht bemerkenswert bei einem Jungen seines Alters), und war sehr wahrheitsliebend und mutig.
Nach allen Berichten (und nach einer Fotografie in meinem Besitz) wuchs er zu einer für einen Mann ungewöhnlichen Attraktivität heran, eine persönliche Gabe, die für ihn keinerlei Bedeutung zu haben schien, obgleich er sie an anderen so sehr schätzte. Aber er wurde auch sehr scheu und reserviert in seinem Verhalten, außerordentlich schüchtern und selbstkritisch; er war zur Schwermut veranlagt, liebte die Einsamkeit, lebte viel allein und zog niemanden ins Vertrauen, flößte zugleich aber Zärtlichkeit und Achtung ein. Er scheint in Rede, Verhalten, Betragen und Aussehen immer durch und durch gentlemanlike gewesen zu sein.
Es mag sein, auch wenn er es nicht ausspricht, dass er, nachdem er sich unter etwas unglücklichen Voraussetzungen um eine Berufskarriere bemüht und sie auch angetreten hatte, das Gefühl nicht los wurde, er habe den gesellschaftlichen Rang (wie er ihn innegehabt hatte) verloren, der ihm auf Grund seiner Geburt eigentlich zustand; und er mag seine Kollegen unsympathisch gefunden haben.
Seine alten Briefe an mich sind von bezaubernd offenem Überschwang.
Es fällt mir schwer, von der Lady zu sprechen, die ich (unter Beibehaltung ihres Titels und Änderung ihres Namens) Herzogin von Towers nenne. Dass sie sich nur zweimal und unter den beschriebenen Umständen trafen, ist eine unbezweifelbare Tatsache.
Unbezweifelbar ist auch, dass er in Newgate am Morgen nach seinem Todesurteil einen Umschlag empfing, der Veilchen und die seltsame Nachricht enthielt, die er erwähnt. Sowohl der Brief als auch die Veilchen befinden sich in meinem Besitz, und der Text ist eindeutig ihre Handschrift.
Darüber hinaus ist es sicher, dass sie sich beinahe sofort nach dem Verfahren und der Verurteilung meines Cousins von ihrem Ehemann trennte und relativ zurückgezogen von der Welt lebte, und es ist ebenfalls sicher, dass er, 25 Jahre später, im Gefängnis von – nur wenige Stunden nach ihrem tragischen Tod plötzlich durchdrehte, obgleich er davon auf regulärem Wege noch gar nichts wissen konnte; und dass er ins – Asyl verlegt wurde, wo er, nachdem sein Wahnsinn abgeklungen war, für viele Tage in einen Zustand suizidaler Melancholie verfiel, bis er zur Überraschung aller eines Morgens in bester Stimmung aufwachte und offensichtlich von allen ernsten Symptomen des Irrsinns geheilt war; und so blieb er bis zu seinem Tod. Im letzten Jahr seines Lebens schrieb er seine Autobiografie auf Englisch und Französisch.
Und wenn man alle Umstände in Betracht zieht, kann es nicht überraschen, dass eine so große Dame, Freundin von Königinnen und Kaiserinnen, Trägerin eines hohen Titels und berühmten Namens, mit Recht gefeiert für ihre Schönheit und ihren Charme (und ihre unendliche Wohltätigkeit), von untadeligem Ruf, eine der beliebtesten Damen der englischen Gesellschaft, eine sehr warme Zuneigung zu meinem armen Cousin empfunden haben soll; in der Tat war es ein offenes Geheimnis in der Familie von Lord Cray, dass dem so war. Wären sie nicht gewesen, hätte sie die ganze Welt in ihr Vertrauen gezogen.
Nach ihrem Tod hinterließ sie ihm das Geld, das sie von ihrem Vater hatte. Er führte es karitativen Zwecken zu. Und sie hinterließ ihm eine große Menge von Manuskripten in einer Geheimschrift, die offenbar dieselbe war, welche er für die Notizen benutzte, die er unter die zahllosen Skizzen schrieb, die er während der langen Zeit seiner Einsperrung (auf Grund ihres Interesses und fraglos auch auf Grund seiner guten Führung) zeichnen durfte, da ihm die Haft so erträglich wie möglich gemacht werden sollte. Diese (ganz außergewöhnlichen) Skizzen und die Manuskripte Ihrer Hoheit sind nun in meinem Besitz.
Sie enthalten ein Geheimnis, in das hineinzuspähen ich nicht gewagt habe.
Aus Papieren der beiden kann ich zweifelsfrei die (so seltsam entdeckte) Tatsache bestätigen, dass sie von einer gemeinsamen französischen Vorfahrin abstammen, deren Namen ich nur geringfügig verändert habe und deren Überlieferung im Département de la Sarthe noch immer nachklingt, wo sie vor einem Jahrhundert eine Berühmtheit war; ihre Geige, eine wertvolle Amati, gehört heute mir.
Zum übernatürlichen Teil seiner Geschichte will ich nicht viel sagen.
Es ist natürlich eine Tatsache, dass er, bevor er sein Leben beschrieb, völlig und allem Anschein nach unheilbar wahnsinnig war.
Es gab anscheinend unterschiedliche Meinungen oder eher Zweifel bei den Leitern des Asyls, ob er auch noch verrückt war, nachdem die akute, aber sehr heftige Phase seines kurzen Anfalls beendet war.
Wie das auch immer gewesen sein mag, ich bin zumindest überzeugt davon, dass er kein Phantast war, sondern zutiefst an die ungewöhnliche geistige Erfahrung glaubte, die er enthüllte.
Auf die Gefahr hin, dass man glaubt, ich teilte seinen Wahnsinn – wenn er denn wahnsinnig war – will ich mit der Bemerkung schließen, dass ich ihn erstens für zurechnungsfähig halte und zweitens glaube, dass er durchweg die Wahrheit gesagt hat.
MADGE PLUNKET
Teil Eins
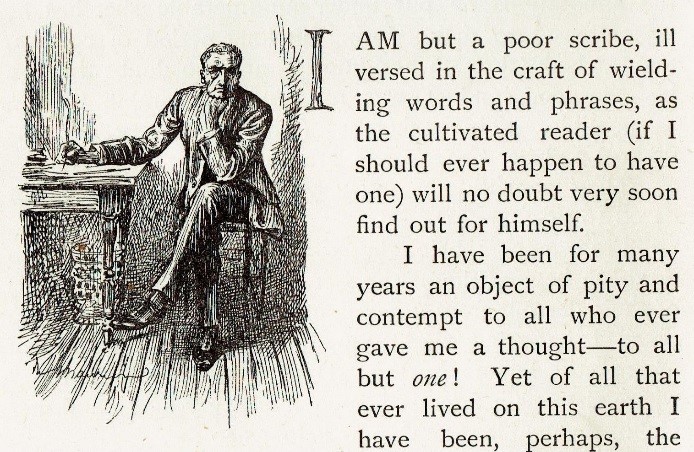
Ich bin nur ein armseliger Schreiberling; unerfahren im Handwerk des Umgangs mit Wörtern und Sätzen, wie der gebildete Leser (sollte ich je einen solchen haben) zweifellos nur allzu bald selbst herausfinden wird.
Ich bin für viele Jahre Gegenstand des Mitleids und der Verachtung für alle gewesen, die je einen Gedanken an mich verschwendeten – für alle außer einer! Dennoch bin ich von allen, die je auf dieser Erde lebten, vielleicht der glücklichste und privilegierteste gewesen, was der Leser entdecken wird, wenn er bis zum Ende durchhält.
Mein äußeres und mein inneres Leben lagen wie die Pole weit auseinander. Und wenn ich mich fünf Minuten vor zwölf entschlossen habe, der Welt meine Geschichte zu übergeben, dann nicht, um mich in den Augen meiner Mitmenschen zu rechtfertigen, so sehr ich ihre Meinung auch schätze; denn ich habe sie immer geliebt und ihnen nur Gutes gewünscht, würde ihnen gern mein Wohlwollen ausdrücken und ihres wenn möglich gewinnen.
Denn die Regionen, in denen ich mein Glück gefunden habe, sind für alle zugänglich, und viele, geübter und begabter als ich, werden sie zu weit besserem Zweck und zum größeren Ruhm und Vorteil des Menschengeschlechts erforschen als ich, habe ich ihnen den Fingerzeig einmal gegeben. Bevor ich das aber tue und um zu zeigen, wie ich selbst diesen Fingerzeig erhielt, muss ich, so gut ich es vermag, die Geschichte meines bewegten Lebens erzählen und damit dem letzten Willen eines Menschen gehorchen, dessen leisester Wunsch mir Gesetz war.
Wenn ich hier wortreicher bin, als ich sein sollte, darf das auf meinen Mangel an Erfahrung in der Kunst literarischer Komposition zurückgeführt werden – und darauf, dass ich mich natürlich besser oder schlechter darzustellen wünsche, als ich zu sein glaube; schließlich aber auch auf den unsagbaren Zauber, den persönliche Erinnerungen auf die am meisten betroffene Person ausüben und den sie, ohne die Begabungen und Vorzüge, die mir verweigert blieben, doch nicht hoffen darf wirklich mitzuteilen, so intensiv sie ihn auch empfindet.
Deshalb möchte ich mich schon im Voraus entschuldigen für die Egozentrik dieser Memoiren, die nur die Einführung zu einem anderen, umfangreicheren Werk sind, das ich später zu veröffentlichen hoffe. Um diese Darstellung von größter Wichtigkeit für die Menschheit zu schreiben, über das ganze äußere und innere Selbst, um das zu bewerkstelligen, ohne irgendwie egozentrisch zu erscheinen, braucht es wahrhaftig Genie – und ich bin doch nur ein armseliger Schreiberling.
*****
„Combien j’ai douce souvenance
Du joli lieu de ma naissance!“
[Wie viele süße Erinnerungen habe ich
an den hübschen Ort meiner Geburt!]
Diese wohllautenden Zeilen gingen mir in Abständen immer wieder durch den Kopf während all der Jahre meines äußeren Lebens wie der Kehrreim einer endlosen Ballade – traurig und monoton, o weh! der Ballade, die die meine ist; süß und monoton der Kehrreim – von Chateaubriand.
Manchmal denke ich, man muss, um die volle Bedeutung dieses Refrains zu empfinden, seine Kindheit im sonnigen Frankreich verbracht haben, wo er ja geschrieben wurde, und den Rest des Lebens ausschließlich in London – oder schlimmer noch als in London – wie es bei mir der Fall war. Hätte ich mein Leben von Kindheit auf in Bloomsbury verbracht, in Clerkenwell oder Whitechapel, meine Kindertage wären eines Großteils des Glanzes beraubt, in dem ich sie sehe, blicke ich auf sie aus meinen späten Jahren zurück.
„Combien j’ai douce souvenance!“
Es war an einem herrlichen Junimorgen in einem bezaubernden französischen Garten, wo die warme, süße Luft geschwängert war mit dem Duft von Flieder und Syrinx, gesprenkelt mit Schmetterlingen, Libellen und Hummeln, dass mein bewusstes äußeres Leben anhob mit seinem glücklichsten Tag.
Es stimmt, ich hatte vage (und sehr lückenhafte) Erinnerungen an ein schäbiges Haus im Herzen Londons, in einer Straße von trostloser Geradlinigkeit, die auf einen langweiligen Platz und wieder zurückführte, und sonst nirgendwohin, wie ich meinte. Dann an eine beängstigende und aufregende Reise und ein Durcheinander von Tagen und Nächten. Ich konnte mich erinnern an die blaue Kutsche mit den vier großen, schlanken braunen Pferden, so ruhig, bescheiden und brav; an den Schaffner im roten Mantel mit seinem Horn; den rotgesichtigen Kutscher mit seiner rauen Stimme und den vielen Capes. An den Dampfer mit seinem glänzenden Deck, so schön und weiß, dass es wie eine Entweihung war, darauf zu treten – die Fleckenlosigkeit währte nicht lange; dann zwei hölzerne Anlegebrücken, auf jeder ein Leuchtturm, dann der Kai mit Hafenarbeitern in blauen Blusen und rotbehosten Soldaten mit Schnurrbärten, mit barfüßigen Fischersfrauen, und alle sprachen die Sprache, die ich ebenso gut kannte wie die vertrautere, die ich hinter mir zurück gelassen hatte, aber jene hatte ich immer für meinen und den ausschließlichen Besitz meines Vaters und meiner Mutter angesehen, mit dem man süße Vertraulichkeiten austauschen und nicht Dazugehörige irritieren konnte; und hier gab es kleine Jungen und Mädchen auf der Straße, ganz normale Kinder, die es gut und besser sprachen als ich.
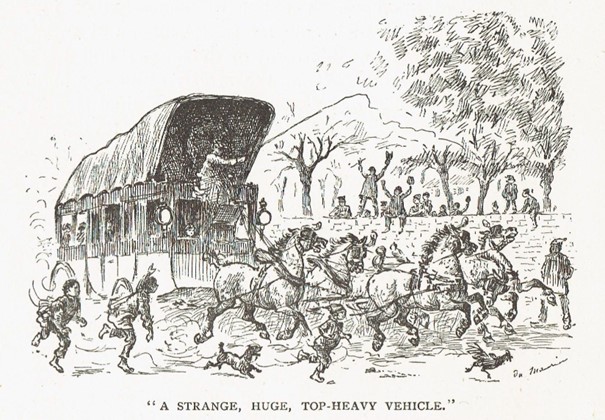
Darauf folgte der Traum von einem seltsamen, riesigen kopflastigen Vehikel, das aussah, als hätte man drei gelbe Kutschen zusammengesteckt, und einem Berg von Gepäck oben drauf unter einer riesigen schwarzen Persenning, die in einem Verdeck endete; und unter dem Verdeck saß ein Mann mit Schnurrbart in blauem Hemd, er trug eine einzigartige, einer Ziehharmonika ähnelnde Mütze, knallte mit seiner lärmenden Peitsche über fünf wiehernden, aufgeregten und zänkischen weißen und grauen Pferden mit Glöckchen an den Hälsen und Büscheln von Fuchsschwänzen auf den Köpfen, die eigenen Schweife hinten sorgsam aufgebunden.
Aus dem Coupé, in dem ich mit Vater und Mutter saß, konnte ich gut beobachten, wie sie uns über staubige Straßen zwischen endlosen Apfelbaum- und Pappelreihen auf beiden Seiten zogen. Kleine barfüßige Bengel (deren Väter und Mütter Holzschuhe und lustige weiße Nachtmützen trugen) liefen uns nach, um französische Halfpennys zu erbeuten, die größer als die englischen und besser in der Hand zu halten waren! Hügelan und hügelab fuhren wir; über rumpelnde Holzbrücken, holprig gepflasterte Straßen in kleinen Städten mit großen Hofplätzen, wo fünf frische zänkische Stuten, grau und weiß, darauf warteten, den Platz der alten einzunehmen, die zwar erschöpft waren, sich aber immer noch zankten.
Und durch die Dunkelheit konnte ich die fröhliche Musik der Glöckchen und Hufe hören, das Rumpeln der Räder, das Knallen der unvermeidlichen Peitsche, während ich mal auf diesem, mal auf jenem Schoß Schlaf suchte; aus dem Halbschlaf erwachend konnte ich den Schimmer der roten Lampen auf den gestreckten fünf weißen und grauen Rücken sehen, die uns so tapfer durch die dunkle Sommernacht zogen.
Dann wurde alles sehr ermüdend und lückenhaft und verworren, bis wir in der Dämmerung des nächsten Tages eine Anlegestelle an einem breiten Fluss erreichten; und als wir da unter dicken Bäumen entlangfuhren, trafen wir auf andere fünfspännige Kutschen mit roten, blauen und grünen Lampen, sie brachen auf ihre lange Reise auf, während die unsere zu Ende ging.
Dann begriff ich (denn ich war ein gut erzogenes Jüngelchen und hörte meinen Vater ausrufen: „Endlich Paris!“), dass wir in Frankreichs Hauptstadt gelangt waren, was mich sehr beeindruckte – so sehr, wie es scheint, dass ich sechsunddreißig Stunden am Stück durchschlafen sollte, um mich beim Aufwachen in dem Garten zu befinden, den ich erwähnt habe und ohne Bruch oder Auflösung der Kontinuität (außer wenn ich wieder einschlief) wieder in den Besitz meines bis jetzt andauernden Selbst zu gelangen.
*****
Der glücklichste Tag meines gesamten äußeren Lebens
Denn in einem alten Schuppen voller Gerät und Gerümpel am Ende des Gartens, auf halbem Weg zwischen einem leeren Hühnergehege und einem unbenutzten Stall (beide jeweils ein Paradies für sich) fand ich eine kleine Kinderschubkarre – das wohl ungewöhnlichste, unerhörteste, unerträumteste, anmutigste und faszinierendste Objekt, das mir in meinem ganzen kurzen Leben je begegnet war.

Ich verbrachte Stunden – Stunden des Entzückens – damit, Ziegelsteine vom Stall zum Hühnergehege zu rollen, und rollte sie mit noch mehr Entzücken wieder zurück, während freundliche französische Arbeiter, die im Innern und am Äußern des Hauses, wo wir wohnen wollten, arbeiteten, dem „p’tit Anglais“ dann und wann leutselige Fragen stellten und seine Kenntnis ihrer Sprache sowie sein bemerkenswertes Geschick in der Handhabung einer Schubkarre kommentierten. Ja, ich erinnere mich verwundert und mit neu erwachtem Selbstbewusstsein an die Intensität, die Eindringlichkeit, das Ausmaß meines Glücks und mit welch fröhlicher Zuversicht ich mich auf eine endlose Folge solcher Stunden in der Zukunft freute.
Am nächsten Morgen aber – das Wetter war ebenso schön, die Schubkarre und die Ziegelsteine und die freundlichen Arbeiter waren da, alle Düfte, Anblicke und Töne waren dieselben, aber die erste unbefangene Hingerissenheit war nicht wieder herzustellen, die Herrlichkeit und Frische waren verflogen.
So erreichte ich im ersten Morgendämmer des Lebens fast zur selben Zeit die Hochwassermarke meines irdischen Glücks – die ich auf dieser Seite des elfenbeinernen Tors nie wieder erreichen sollte – und entdeckte, dass es, um die Vollkommenheit menschlichen Glücks dauerhaft zu machen, mehr braucht als einen süßen französischen Garten, eine französische Kinderschubkarre und einen netten kleinen englischen Jungen, der Französisch spricht und den Beifall genießt – eine vierte Dimension ist vonnöten.
Ich fand sie zu gegebener Zeit.
Aber wenn es auch keine Entzückensstunden wie die erste mehr gab, folgten ihr doch sieben glückliche Jahre, die mich entzücken, wenn ich nur an sie denke.
*****
O dieser schöne Garten! Rosen, Kresse, Winden, Goldlack, Wicken, Nelken, Ringel- und Sonnenblumen, Dahlien und Stiefmütterchen, Stockrosen, Mohn und der Himmel weiß, was sonst noch! Auf dem Grund meiner Erinnerung blühen sie alle gleichzeitig, ohne Rücksicht auf Zeit und Jahreszeit.
Sie alle zum ersten Mal sehen, riechen und pflücken im empfänglichen Alter von fünf Jahren! Ein solches Königreich zu erben nach fünf Jahren Gower Street und Bedford Square! Denn alles ist relativ und hängt vom Standpunkt des Betrachters ab. Für den Besitzer von Chatsworth (und für seine Gärtner) wäre mein schöner französischer Garten keine große Sache gewesen.
Und was für eine Welt von Insekten – darin wäre Chatsworth nicht überlegen gewesen (und in der Tat, die fehlen dort sehr) – schöne, interessante, komische, groteske und schreckliche Insekten; von der stolzen Hummel zum Ohrwurm und seinem Cousin, dem Schwarzen Moderkäfer; und all diese wilden, vielfüßigen Dinger, die sich in der Feuchtigkeit und Dunkelheit unter großen flachen Steinen ausbreiten. Unfassbar, dass ich mit ihnen – Rosen und Tausendfüßlern und allem – befreundet war, dann aber mein weiteres Leben zwischen nackten, weiß getünchten Mauern verbracht habe, wo ich nicht mal mit einem Floh oder eine Spinne befreundet sein konnte!
Unser Haus (in dem ich, nebenbei, fünf Jahre zuvor auf die Welt gekommen war), alt ockerfarben mit grünen Schlagläden und verschieferten Mansardendächern, stand zwischen diesem Garten und der Straße – einer langen, gewundenen, holprig gepflasterten Straße, über der in großen Abständen Öllampen hingen; diese Lampen wurden bei Nachteinbruch mit Flaschenzügen heruntergelassen, aufgefüllt, angezündet und wieder hochgezogen, damit man in mondlosen Nächten ohne Mond für ein paar Stunden auch im Dunkeln sehen konnte.
Uns gegenüber lag eine Knabenschule – „Maison d’éducation, dirigée par M. Jules Saindou, Bachelier et Maître ès lettres et ès sciences,“ Verfasser einer geologischen Abhandlung mit so unheimlich schrecklichen Abbildungen voreiszeitlicher, im Urweltschlamm mit einander kämpfenden Reptilien, dass ich nie imstande war, sie zu vergessen. Mein wissenschaftsbeflissener Vater schenkte mir das Werk zu meinem sechsten Geburtstag. Ihm verdanke ich so manchen Alptraum.
Von unserem Fenster aus konnten wir sehen und hören, wie die Jungen spielten – aus einiger Entfernung hören sich französische Jungen nicht viel anders als englische an, aber aussehen tun sie auf Grund ihrer blauen Blusen und der dunklen, geschorenen Köpfe ganz anders, und wir konnten die Turngeräte auf dem Schulhof sehen, M. Saindous ganzer Stolz. „Le portique (Reck)! la poutre (Balken)! le cheval (Pferd)! et les barres parallèles (Barren)!“ So wurden sie in M. Saindous Prospekt vorgestellt.
Auf beiden Seiten der Straße (die „Rue de la Pompe“, Pumpenstraße hieß), standen, soweit das Auge in Richtung Westen reichte, Wohnhäuser, die sich von unserem nur geringfügig unterschieden; und Gartenmauern, überragt vom Blattwerk der Rosskastanien, Platanen, Akazien und Limonen; und hier und da riesige Tore mit Eisengittern, bewehrt mit steinernen Pfosten, Eingängen zu geheimnisvollen Behausungen aus Ziegelsteinen, Gips und Granit, viele verlassen und umarmt von besonntem Ziergrün.
In östlicher Richtung lagen nicht weit entfernt schlichte Läden mit altmodischen Sprossenfenstern – Liard, der Krämer, Corbin, der Geflügelhändler, der Metzger, der Bäcker, der Kerzenhaltermacher.
Und diese hübsche Straße führte auf ihrem gewundenen Weg nicht zum Bedford Square oder zum neuen University College Hospital, sondern nach Paris durch den Arc de Triomphe auf der einen und zur Seine auf der anderen Seite; oder, wandte man sich nach rechts, durch den Bois de Boulogne des Louis Philippe I., Königs von Frankreich, nach St. Cloud – alles dem heutigen Paris, dem heutigen Bois de Boulogne so ähnlich, wie eine Kutsche einem Expresszug ähnelt.
Auf der einen Seite des schönen Gartens lag ein zweiter schöner Garten, von unserem durch eine hohe Mauer getrennt, vor der Pfirsich-, Birnen-, Pflaumen- und Aprikosenbäume standen; auf der anderen, zugänglich für uns durch eine kleine Tür in einer niedrigeren Mauer, an der Jasmin, Climatis, Winden und Kresse wuchsen, erstreckte sich eine lange gerade Straße, die mit Mandelbäumen, Akazien, Goldregen, Flieder und Weißdorn so dicht bepflanzt war, dass die efeubedeckten Mauern auf beiden Seiten kaum zu sehen waren. Wie hübsch sie den Boden fleckten, wenn die Sonne schien! Ein Ende dieser Straße grenzte an die „Pumpenstraße“, von der sie durch große schmiedeeiserne Tore zwischen Steinportalen abgezäunt war, und auf der Seite war eine porte bâtarde [eine Tür in der Größe zwischen Fußgänger- und Wagengröße], bewacht von Vater und Mutter François, dem alten Conciergeehepaar. Friede ihrer Asche, mögen ihre freundlichen und herzlichen Seelen sich im Himmel ausruhen!
Das andere Ende der Straße, wo es auch ein Eisentor gab, verlief sich in einen großen Privatpark, der niemandem zu gehören schien und den wir betreten durften – eine wahre Wildnis des Entzückens, ein Himmel, ein Horror verworrener Dickichte und nicht allzu gefährlicher Kalkfelsen, stillgelegter alter Steinbrüche und dunkler Höhlen, saftiger Wiesen, mit Seggen bewachsener Teiche, Rübenfelder, Kiefernwälder, Rosskastaniengehölze, dunkle Schluchten von Walnussbäumen und Rotdorn, die an Sommermittagen Schatten spendeten, nackte, windüberwehte Hochebenen, von wo aus man weit in die Ferne reconnaitre konnte; alle Arten von wilden und Furcht einflößenden Plätzen, wo wilde Tiere sich gut verstecken und kleine Jungen auf der Suche nach gefährlichen Abenteuern recht sicher umherstreifen konnten.
Dies ganze riesige umzäunte Grundstück (angefüllt mit seltsamem Singen, Summen, Pfeifen, Brummen, Zwitschern, Gurren, Brausen, Krächzen, Flattern, Kriechen, Schleichen, Springen, Klettern, Buddeln, Plätschern, Tauchen) war seit Ewigkeiten vernachlässigt worden – ein Garten Eden, in dem man furchtlos vom Baum der Erkenntnis pflücken und essen und alle Arten von Leben liebevoll kennenlernen konnte, ohne seine Unschuld zu verlieren; ein Wald, der aus eigener Kraft wieder jungfräulich und urzeitlich geworden war; wo die schöne Natur ihren eigenen süßen Willen durchgesetzt und alles zusammengeballt und verheddert hatte, gerade als hätte eine Schöne dort ungestört für bald hundert Jahre geschlafen und nur auf den Märchenprinzen gewartet – oder, wie es sich einige Jahre später herausstellte, o weh, auf den Spekulanten und den Eisenbahningenieur, diese Märchenprinzen unserer Gegenwart.
Meine tiefste Erinnerung will mir weismachen, dass dieses Gebiet beinahe grenzenlos war, obgleich ich mich an seine Grenzen erinnere. Meine Kenntnis der physikalischen Geographie, soweit sie sich auf diesen speziellen Vorort von Paris bezieht, gebietet mir, diesem irdischen Paradies bescheidenere Grenzen zu setzen, denn es war seinerseits durch einen leicht zu überwindenden Zaun von Louis Philippes Bois de Boulogne getrennt; und diesem kann ich in meinem Herzen keinerlei Grenzen zugestehen außer der hübschen alten Stadt, nach der er benannt ist und deren Hauptstraße zu der magischen Kombination von Fluss, Brücke, Palast, Gärten, Berg und Wald führt, St. Cloud.
Was konnte man einem kleinen Jungen, frisch (wenn das Frische ist) aus dem Herzen von Bloomsbury, mehr wünschen?
Damit auch nicht ein einziger Tropfen fehle im vollen Glücksbecher dieses kleinen Jungen, gab es einen Teich auf dem Weg von Passy nach St. Cloud – einen erinnerungswürdigen Teich namens La mare d’Auteuil, das einzige kostbare Gewässer, dessen sich Louis Philippes Bois de Boulogne rühmen konnte. Denn in jener unverdorbenen Zeit gab es keinen künstlichen See, gebildet von einem künstlichen Strom, kein Restaurant Pré Catelan, keinen Jardin d’Acclimatation. Der Wald war einfach ein Wald und sonst nichts – ein dichter, wilder Wald, der viele hundert Acres bedeckte und vielen tausend wildlebenden Tieren Schutz bot. Obgleich in seiner Mitte von geheimnisvoller Tiefe, war dieser berühmte Teich (der Jahrhunderte alt gewesen sein mag und den es immer noch gibt) keinesfalls groß; man konnte von überall einen Stein über ihn hinwegwerfen.
Auf drei Seiten vom Wald begrenzt (der heute beseitigt ist), trennte nur ein Saum von Bäumen ihn von der staubigen Straße; und man konnte ihn ganz für sich haben außer an Sonntag- und Donnerstagnachmittagen, wenn sich einige liebeskranke Pariser seiner erinnerten und in seiner Schönheit ihre eigene vergaßen.
Nur da zu sein, hieß glücklich sein; denn nicht nur war es der einsamste, hübscheste und schönste Teich der ganzen bewohnten Welt – der Teich der Teiche, der einzige Teich – er wimmelte auch von einer weitaus größeren Zahl verschiedener Insekten und Reptilien als jeder andere Teich der Welt. Zumindest glaubte ich, dass das der Fall war, denn sie waren zahllos.
Diese Tiere zu beobachten, ihre Lebensweise zu verstehen, sie zu fangen (was wir manchmal taten), sie mit nach Hause zu nehmen, lieb zu ihnen zu sein und zu versuchen, sie zu zähmen und ihnen unsere Lebensart zu vermitteln (mit dem immer gleichen Misserfolg, klar, aber in was für lustiger Gesellschaft!) wurde zu einer Lieblingsbeschäftigung, die ich, mal mehr, mal weniger, für sieben Jahre beibehielt.
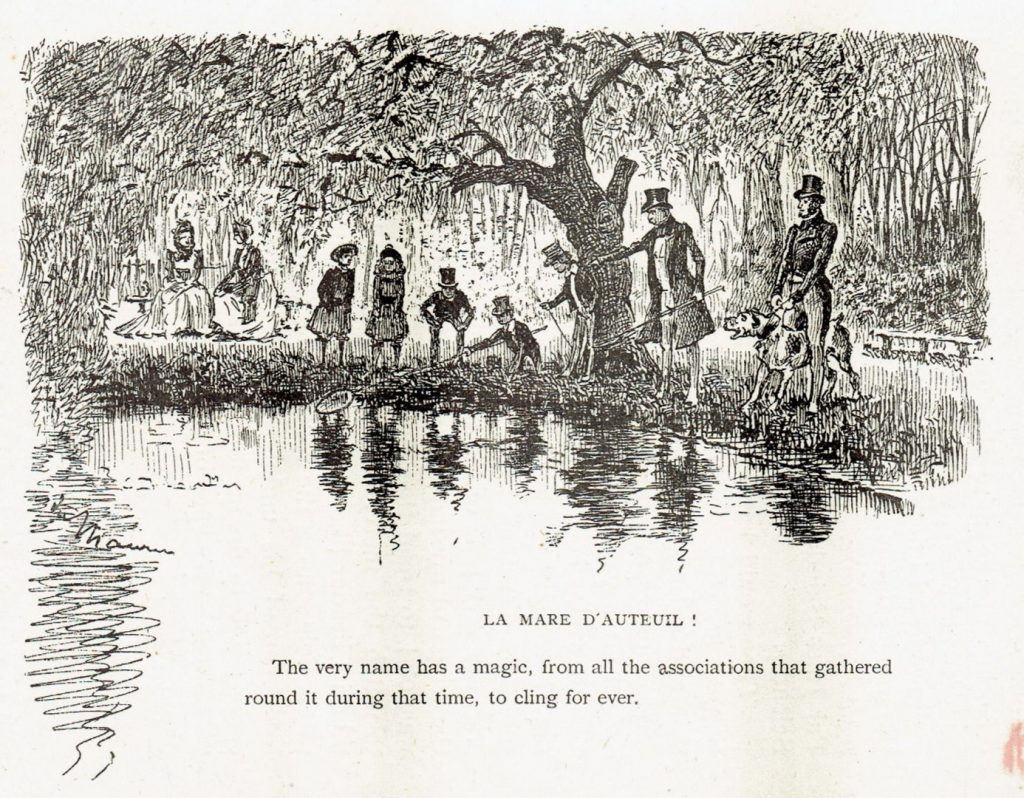
Das Mare d’Auteuil! Der Name allein übt einen Zauber aus durch all die Assoziationen, die sich in jener Zeit um ihn angesammelt haben, um immer daran haften zu bleiben.
Wie ich es liebte! Wenn ich nachts in meinem warmen Bett döste, dachte ich ehrfürchtig an es, wie feierlich es aussah, als ich es widerstrebend vor ein, zwei Stunden in der Dämmerung verließ. Später würde ich es mir ausmalen, tief, kalt und still unter den Sternen liegend, im dunklen Dickicht, mit all den eigenartigen, unheimlichen Wesen, die unter seiner ruhigen Oberfläche wimmelten.
Dann würde das Wasser sinken, und das entblößte Schilf würde beginnen, sich merkwürdig zu bewegen und zu rascheln, und alles Lebendige würde sich zwischen seinen Wurzeln, aus dem unbedeckten Schlamm zur Mitte aufmachen – hüpfend, gleitend, wie wahnsinnig sich windend …
Weiter sank das Wasser; und bald schon erwachten am schlammigen Grund einige Yards darunter riesige fette Salamander, lang verlorene und vergessene Kaulquappen, groß wie Ratten, gewaltige Kröten, enorme Flachkäfer, alle Arten von haarigen, schuppigen, stachligen, trübäugigen, knolligen, form- und namenlosen Monstren, dem Morast entsprossen, der hunderte von Jahren dort geschlummert hatte, und sie krabbelten hinein und hinaus, wälzten und schlängelten sich, verschlangen einander wie die großen Saurier und Lurche in meinem Manuel de géologie élémentaire, edition illustrée à l’usage des enfants. Par Jules Saindou, Bachelier et Maître ès lettres et ès sciences.
Dann würde ich aufschrecken, kalten Schweiß im Gesicht, Eiseskälte würde sich in mir ausbreiten, mir Gänsehaut machen, mein Haar sträubte sich und ich sehnte mich innigst danach, dass der Morgen des nächsten Tags anbräche.
Wenn mich in späteren Jahren und weit entfernt in den kalten Nebeln von Clerkenwell oftmals die Sehnsucht nach „dem schönen Ort meiner Geburt“ überwältigte, dann sehnte ich mich am meisten nach dem Mare d’Auteuil; es war der Leitstern und Pol meiner heimwehkranken Begierden; dahin trugen mich die Schwingen meiner hoffnungslosen Phantasie immer zuerst; o, noch einmal den sonnenbeschienenen Grassaum betreten, den Schwarm fröhlicher Kaulquappen beobachten, und der grüne Frosch macht einen Kopfsprung wie ein kleiner Mann, und die Wasserratte schwimmt zu ihrem Loch unter den Wurzeln der Weide, und der Egel nimmt seinen wellenförmigen Weg durch die Stängel der Wasserlilien; tief träumen von der entzückenden, unwiderruflich verlorenen Vergangenheit an dem einzigen Ort von allen, an dem ich und die meinen immer glücklich waren!
„ … Qu’ils étaient beaux, les jours de France!“
In der Straße, die ich erwähnt habe (der Straße, die sie immer noch für mich ist und wie ich sie immer bezeichnen werde) gab es auf halber Strecke rechts eine maison de santé, eine Pension, geführt von einer Madame Pelé; und dort quartierten sich kurze Zeit nach unserer Ankunft vier oder fünf Gentlemen ein, die versucht hatten, Frankreich zu übernehmen, mit einem grimmigen Thronprätendenten an der Spitze und einem zahmen Adler als Symbol des Reichs, das sie um sich versammeln wollten.
Die Invasion war fehlgeschlagen; der Prätendent war zu Festungshaft verurteilt worden; der Adler hatte ein neues Zuhause im öffentlichen Schlachthaus von Boulogne-sur-Mer gefunden, dessen Zierde er für viele Jahre war und wo er so viel zu fressen bekam wie wohl nie zuvor; und diese treuen Gefolgsleute, der Colonel Voisil, der Major Duquesnois, der Capitaine Audenis, der Docteur Lombal (und zwei oder drei weitere, deren Namen ich vergessen habe) hatten Hausarrest bei Madame Pelé und schienen ihre Haft nicht besonders schlimm zu finden.

Ich lernte sie alle kennen und lieben, besonders den Major Duquesnois, eine fast wörtliche Übersetzung von Colonel Newcome ins Französische. Trotz meiner Englishness zog es ihn sofort zu mir, er drillte mich und und lehrte mich exerzieren, wie es in der Vieille Garde üblich war, und erzählte mir sieben Jahre lang wahrhaftig jeden Nachmittag ein neues Märchen. Scheherezade konnte für ihren Sultan nicht mehr tun, um ihren Hals vor der Bogensehne zu bewahren!
Cher et bien aimé vieux de la vieille! [Lieber und sehr geschätzter Alter von der alten Garde!] Mit seinem gewaltigen eisengrauen Schnurrbart, seinem schwarzen Satinstoff, seiner fleckenlosen Wäsche, seinem langen grünen, ausgebeulten Gehrock und dem eleganten roten Ordensband in seinem Knopfloch konnte er kaum vorhersehen, wie warm und zärtlich sein immerdar süßes und grünes Gedenken im Herzen seines Erbfeinds, des kleinen englischen Tyrannen und Gefährten, überdauern sollte!
*****
Gegenüber von Madame Pelé lag das einzige Wohnhaus außer ihrem und unserem in der Straße, eine bezaubernde kleine weiße Villa mit griechischem Portikus, auf den mit Goldbuchstaben geschrieben stand „PARVA SED APTA“. Aber die ersten drei Jahre nach unserer Ankunft war sie unbewohnt.
Nach der geselligen französischen Sitte jener Zeit wurden wir mit diesen und anderen Nachbarn bald vertraut und sahen einander viel zu jeder Tageszeit.
Meine große und schöne Mutter (la belle Madame Pasquier, wie sie galant genannt wurde) war eine Engländerin, die in Paris geboren und zeitweise auch aufgewachsen war.
Mein lustiger und leutseliger Vater (le beau Pasquier, denn er war auch groß gewachsen und gutaussehend) war ein Franzose, wenngleich englischer Staatsbürger, der in London geboren und zeitweise aufgewachsen war; denn er war ein Kind von Emigranten, die Frankreich in der Zeit des Terrors verlassen hatten.
„When in death I shall calm recline,
Oh take my heart to my mistress dear!
Tell her it lived upon smiles and wine
Of the brightest hue while it lingered here!”
„Wenn ich mich ruhig zum Sterben lege,
o trage mein Herz dann zu meiner Geliebten!
Sag ihr, es lebte von ihrem Lächeln und vom Wein
des hellsten Farbtons, als es hier weilte.“

Er war mit einer großartigen, ja, phänomenalen Stimme begabt, in der Bariton und Tenor zusammenfielen; ein Wunder an Umfang, Süße, Beweglichkeit und Kraft; er hatte vorgehabt, an der Oper zu singen, hatte zu dem Zweck tatsächlich drei Jahre am Pariser Konservatorium studiert; und dort hatte er alle, die vor ihm waren, getragen und Anlass zu den höchsten Hoffnungen gegeben; aber seine Familie, Katholiken der schwärzesten, und Legitimisten der weißesten Färbung und arm wie Kirchenmäuse hatten sich einer solchen gottlosen und unpassenden Karriere in den Weg gestellt, so dass die Welt einen großen Sänger verlor und der große Sänger eine Goldader von Reichtum und Ruhm.
Er hatte jedoch gerade genug zum Leben und hatte eine Frau geheiratet (eine Ketzerin!), die gerade ebenso viel oder ebenso wenig hatte; und er verschwendete seine Zeit und sowohl ihr wie sein Geld mit wissenschaftlichen Erfindungen – mit wenig Erfolg, denn er hatte zwar zu singen gelernt aber kein Konservatorium besucht, an dem das Erfinden gelehrt wird.
So dass er, als er darauf wartete, „dass endlich sein Schiff nach Hause kam“, nur seine Frau mit seinem Gesang unterhielt, wie es angeblich auch die Nachtigall tut; und um sich selbst überflüssiger Energie zu entledigen, die Dienerschaft zu bezaubern, Vater und Mutter François, und die fünf Nachfolger von Napoleon und alle und jeden, der zuhören mochte und schließlich und nicht zuletzt (und am meisten) mich selbst.
Denn diese seine große vernachlässigte Gabe, auf die er so wenig Gewicht legte, war für mich die schönste und geheimnisvollste Sache der Welt, gleich gefolgt vom süßen Harfen- und Klavierspiel meiner Mutter, die eine bewundernswerte Musikerin war.
Sie pflegte nachts zu spielen, ließ die Schlafzimmer- und die Wohnzimmertür angelehnt, so dass ich ihr zuhören konnte, bis ich einschlief.
Manchmal, wenn mein Vater zu Hause war, trieb ihn seine Stimmung, die Melodien, die sie spielte, mit zu summen oder zu singen, während er im Zimmer auf und ab ging auf der Spur einer neuen Erfindung.
Und obwohl er „piano, piano“ summte und sang, schienen die süßen, suchenden Töne den gesamten Raum zu füllen.
Das ganze Haus wurde zum Resonanzkörper, die Harfe zu einem zweitrangigen Geklimper, und mein kleines, erregbares Knochengerüst erbebte und vibrierte unter den Schwingungen der unbewussten Stimme meines Vaters; o, was für bezaubernde Melodien sang er!
Sein Repertoire war ebenso unerschöpflich wie ihres; und so durchzog eine endlose Folge lieblich tönender Melodien diesen glücklichen Zeitraum.
Und so wie angeblich jemandem, der ertrinkt oder aus großer Höhe fällt, sein gesamtes vergangenes Leben visionär in einem einzigen von der Erinnerung aufgezeichneten Blitz erscheint, so liegen für mich die sieben Jahre süßer, unbezahlbarer Heimatliebe – sieben mal vier wechselnde Jahreszeiten von einfacher, geselliger, vorimperial französischer Intensität; ein ideales Haus mit all seinen hübschen Möbeln, Formen und Farben; ein Garten voller Bäume und Blumen; ein großer Park und das ganze Wildleben darin; eine Stadt mit ihren Einwohnern; ein oder zwei Meilen eines geschichtsträchtigen Flusses; ein Wald, groß genug, um vom Triumphbogen bis St. Cloud zu reichen (und in ihm der Teich der Teiche); und all der Wind, all das Wetter, das die wechselnden Jahreszeiten bringen – all das liegt für mich eingebettet und einbalsamiert in jedem einzelnen Takt von wenigstens hundert verschiedenen Melodien, die ich nach Lust und Laune für den bloßen Aufwand von ein bisschen Pfeifen oder Summen heraufbeschwören kann, ja, ich kann sie mit einem Finger auf dem Klavier spielen – wenn eins in Reichweite ist.
Genug für ein ganzes Leben – bei gehöriger Sparsamkeit, versteht sich – es wäre nicht gut, die seltsame Kraft eines melodischen Takts, die Substanz vergangener Dinge und Tage, die nicht mehr sind, zu bewahren, durch zu häufige Nutzung zu erschöpfen.
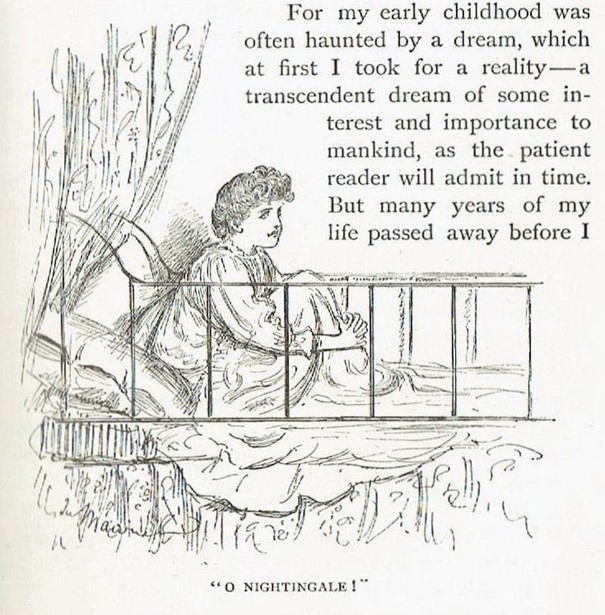
O Nachtigall! Ob du selber singst oder ob, besser noch, deine Stimme nicht aus deiner Kehle, aus deinem feurigen Herzen und erhabenen Gedächtnis kommt und du die Lieder für den Gesang vieler anderer komponierst, gesegnet sei dein Name! Sein bloßer Klang ist süß in jedem Klima, jeder Sprache: Nightingale, Rossignol, Usignuolo, Bulbul! Selbst „Nachtigall“ [deutsch im Original] klingt nicht verkehrt im Mund eines hübschen englischen Mädchens, das eine Hannoveranerin zur Gouvernante hat! Und in der Tat wird in dem Land, in dem du „Nachtigall“ heißt, die beste Musik gemacht!
Und, o Nachtigall, enthalte niemals, niemals deinen Gesang denjenigen vor, die ihn lieben – und verschwende ihn nicht für diejenigen, die das nicht tun …
So umsungen, schließe ich meine Augen, und, umgeben von Dunkelheit, Wärme und himmlischen Tönen schlummre ich ein – vielleicht um zu träumen!
Denn seit meiner frühen Kindheit wurde ich heimgesucht von einem Traum, den ich zuerst für real hielt – einem metaphysischen Traum, der für die Menschheit von einigem Interesse, einiger Wichtigkeit sein könnte, wie der geduldige Leser zu gegebener Zeit einräumen wird. Aber viele Jahre meines Lebens verstrichen, bevor ich imstande war, ihn zu erklären und zu begründen.
Ich brauchte mein Gesicht nur zur Wand zu drehen, und schon befand ich mich in der Gesellschaft einer Dame mit weißem Haar und jungem Gesicht – einem sehr schönen, jungen Gesicht.
Manchmal ging ich Hand in Hand mit ihr, ich als noch ganz kleines Kind, und zusammen fütterten wir zahllose Tauben, die in einem Turm an einem gewundenen Fluss lebten, der an einer Wassermühle endete. Es war zu schön – und ich erwachte.
Manchmal besuchten wir einen dunklen Ort, wo es eine feurige Esse mit vielen Löchern gab, und vielen Menschen, die hier herumgingen und arbeiteten, unter ihnen ein Mann mit weißem Haar und jungem Gesicht wie die Dame, und mit schönen roten Absätzen unter seinen Schuhen. Und unter seiner Führung würde ich in der Esse einen bezaubernden kleinen Zweispitz aus farbigem Glas machen können – einen Schatz! Und die bloße Freude darüber würde mich aufwecken.
Manchmal würden die weißhaarige Dame und ich zusammen an einem Tafelklavier sitzen, an dem sie lieblich musizierte, und sie würde mein Lieblingslied singen, ein Lied, das ich anbetete. Aber ich wachte immer auf, bevor dies Lied zu Ende war, weil die Seligkeit, wenn ich es hörte, zu intensiv, ja, unerträglich war; und alles, woran ich mich, wenn ich erwacht war, erinnern konnte, war: „triste – comment – sale“. [traurig – wie – gemein] An die Melodie, die ich in meinem Traum so gut kannte, erinnerte ich mich nicht.
Es war, als ob ein innerster Kern meines Seins, ein kindisches Allerheiligstes, eine Quelle überfeiner Erinnerung absonderte, die sich, angeregt von einem Impuls, der sich dann und wann im Schlaf aktivierte, in diesem einzigartigen Traum verströmte, schattenhaft und schwach, aber jedes Mal begleitet von einem Gefühl so maßlosen und durchdringenden Glücks, dass ich jedes Mal vor rätselhafter Ekstase zitterte, und die bloße Erinnerung daran genügte, um so manche folgende Stunde zu segnen und zu beglücken.
*****
Neben dieser glücklichen dreiköpfigen Familie lebte ganz in der Nähe (in der Street oft he Tower) meine Großmutter, Mrs. Biddulph, und meine Tante Plunket, eine Witwe, mit ihren beiden Söhnen Alfred und Charlie und ihrer Tochter Madge. Sie waren auch hübsch anzusehen – sehr sogar – vom goldhaarigen, weißhäutigen, gutgebauten angelsächsischen Typ, von freien, offenen, heiteren Sitten, und ohne die abscheuliche englische Überheblichkeit.
So dass wir wenigstens physisch dem englischen Namen einigen Kredit verschafften, der gerade damals in Passy-lès-Paris nicht im besten Ruf stand, wo man Waterloo noch nicht vergessen hatte. Im Laufe der Zeit freilich wurde uns unsere Nationalität nachgesehen auf Grund unseres guten Aussehens – „Non Angli sed angeli!“, wie Monsieur Saindou sich galant auszurufen erlaubte, als er uns (mit einem Prospekt seiner Schule) aufsuchte und uns alle auf dem Rasen unter dem großen Apfelbaum versammelt fand.
Aber die Ränge englischer Schönheit in Passy sollten bald eine bemerkenswerte Bereicherung in Gestalt einer gewissen Madame Seraskier erfahren, die mit ihrer kranken kleinen Tochter kam, um in dem Haus mit der so bescheidenen goldenen Inschrift „PARVA SED APTA“ zu leben.
Sie war die englische, genauer: die irische Frau eines ungarischen Patrioten und Naturwissenschaftlers namens Dr. Seraskier (Sohn des berühmten Geigers); ein außerordentlich hoch gewachsener Mann, fast ein Riese, mit ernstem, wohlwollendem Gesicht und einem Prophetenkopf; wie mein Vater, war er in seiner Familie oft abwesend – vielleicht aus verschwörerischen Gründen – vielleicht aber auch nur (wie mein Vater), um etwas zu erfinden oder Ausschau nach dem Schiff zu halten, „das ihn heimbrächte“.
Die Ankunft dieser schönen Frau war eine Sensation – für mich eine Sensation, die nie schal wurde oder sich verschliss; jetzt hieß es nicht mehr la belle Madame Pasquier, sondern la divine Madame Seraskier – schönheitstrunken, wie die Franzosen sein können.

Sie übertraf meine hochgewachsene Mutter um mehr als einen halben Kopf, oder, wie Madame Pelé bemerkte, deren Vergleiche immer aus der Küche oder dem Esszimmer stammten: „Elle lui mangerait des petits pâtés sur la tête!“ [Sie könnte kleine Pasteten auf ihrem Kopf essen.] Und Hochgewachsenheit, die der Hässlichkeit Würde verleiht, vergrößert Schönheit in geometrischer Progression – 2, 4, 8, 16, 32 – für jeden weiteren Zoll zwischen fünf Fuß fünf Zoll zum Beispiel und fünf Fuß zehn oder elf Zoll (in etwa), denn das, nehme ich an, war Madame Seraskiers Maß.
Sie hatte schwarzes Haar und blaue Augen – der Art, die in einem Roman violett werden – und schöne weiße Haut, hübsche Hände und Füße, eine perfekte Figur und Gesichtszüge, gemeißelt, vollendet, poliert und ausgestattet mit einer so einzigartigen Glückseligkeit, dass man starrte und starrte, bis das Herz platzte vor seltsamem eifersüchtigem Groll auf jeden anderen, der das Recht haben sollte, etwas so seltenes, so göttlich, so heilig Schönes anzustarren – auf jeden in der Welt außer einem selbst!
Aber eine Frau kann all dies haben oder sein, ohne Madame Seraskier zu sein – sie war viel mehr! Denn die Wärme und belebende Freundlichkeit ihres Wesens schimmerte durch ihre Augen und ertönte in ihrer Stimme. Sie war alles in einem – ihre Schlichtheit, ihre Anmut, ihre Natürlichkeit, das Fehlen jeglicher Eitelkeit, ihre Höflichkeit, ihr Mitgefühl, ihr Frohsinn.
Ich weiß nicht, was am unwiderstehlichsten war: Sie hatte einen leichten irischen Akzent, wenn sie Englisch sprach, einen weniger leichten englischen Akzent, sprach sie Französisch!
Ich machte es mir zur Aufgabe, mir beide anzueigenen.
Sie war wirklich in Herz und Seele und Körper, was wir alle sein sollten – wäre da auf Seiten einiger weniger Milliarden unserer unbedachten/sorglosen Mitmenschen nicht ein gewisser Mangel an Gemeinschaftsgeist und Selbstbescheidung (unter gebührender Führung) gewesen.
Es sollte keine hässlichen Fassungen für schöne Seelen geben, in denen diese achtlos oder irrtümlich eilig verstaut werden, und man sollte nicht dulden, dass hässliche Seelen wie Einsiedlerkrebse in schöne Hüllen kriechen, die nie für sie bestimmt waren. Die äußerlich sichtbare Gestalt sollte die innere geistige Anmut abbilden; dass dies selten der Fall ist, lässt sich nicht leugnen. Ach! Schönheit dieser Art ist eine solche Ausnahme, dass ihr Inhaber wie ein Prinz königlichen Geblüts von der Wiege auf verzogen und verdorben wird, jeder gute, großzügige und selbstlose Impuls wird durch die Schmeichelei zersetzt – durch diesen so leicht errungenen, so gern entrichteten und als dem König zustehend angenommenen spontanen Tribut.
So dass es für uns, wenn durch die Gnade des Himmels die sehr Schönen auch sehr gut sind, an der Zeit ist, nieder zu knien und Gebete des Dankes und der Verehrung zu sprechen; denn das Göttliche durfte für einen Augenblick in der vergänglichen Gestalt unserer armseligen Menschlichkeit manifest werden.
Ein schönes Antlitz! eine schöne Melodie! Es gibt nichts auf Erden, was darüber hinaus geht und hieraus haben wir, in Ermangelung besseren Materials, für uns selbst das himmlische Königreich erbaut.
„Plus oblige et peut davantage
Un beau visage
Qu’un homme armé –
Et rien n’est meilleur que d’entendre
Air doux et tendre
Jadis aimé!”
[„Mehr kann und vermag
ein schönes Gesicht
als ein Bewaffneter –
und nichts ist schöner, als
eine süße, zarte, schon vor langer Zeit
geliebte Weise zu hören.“]
(Alfred de Musset)
Meine Mutter wurde sehr bald die leidenschaftlich ergebene Freundin von Madame Seraskier, und ich – was hätte ich nicht getan, welche Gefahr nicht auf mich genommen, welchen Tod wäre ich nicht für sie gestorben!
Ich starb nicht; ich lebte fast fünfzig Jahre als ihr Bekenner; um mich fünfzig Jahre lang an die Hingerissenheit und die Pein zu erinnern, die ich bei ihrem Anblick empfand; das unerklärlich sehnende Weh, die dumpfe, köstliche, verwickelte, unschuldige Qual, für die niemand außer den allergrößten Dichtern je einen Ausdruck gefunden hat; und die sie, diese Zungenfertigen und Begabten, vielleicht nicht halb so heftig empfunden haben wie ich im besonders empfänglichen Alter von sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf Jahren.
Sie hatte weitere Sklaven meines Geschlechts. Die fünf napoleonischen Helden huldigten ihr jeder auf seine Weise: Der gute Major mit einer Art süßer väterlicher Zärtlichkeit, die rührend mit anzusehen war; die anderen mit vielleicht weniger selbstloser Anbetung; besonders der brave Capitaine Audenis mit seinem gewichsten blonden Schnurrbart und schönen braunen Frack, so fest mit goldenen Knöpfen über seiner enormen Brust zugeknöpft, und kaum wahrnehmbar kleinen Füßen, fest eingesperrt in glänzende Damentuchschuhe mit Perlmuttknöpfen; sein Hobby war es, glaube ich, sich für die Missgeschicke des Krieges schadlos zu halten durch erfolgreichere Angriffsversuche in einer anderen Richtung. Jedenfalls verriet er eine Wärme, die meine enge Brust in eine Gehenna verwandelte, bis sie lachte und dafür sorgte, dass er sich wieder um gebührenden Anstand und schamvolle Zurückhaltung bemühte.
Bald wurde klar, dass sie wenigstens zwei aus dieser kleinen Männerwelt bevorzugte – den Major und mich selbst; es bildete sich ein merkwürdiges Trio.
Ihre arme kleine Tochter, Objekt ihrer ganzen leidenschaftlichen Fürsorge, ein sehr kluges und frühreifes Kind war das Gegenteil von schön, obgleich sie hübsche Augen gehabt hätte, wenn deren rote Lider nicht wimpernlos gewesen wären. Sie trug ihr dickes Haar kurz geschnitten wie ein Junge, war von teigiger und fahler Konstitution, hohlwangig, das Gesicht grob geschnitten und überwachsen, mit langen dünnen Händen und Füßen, Armen und Beinen von Mitleid erregender Länge und Dünne; ein stilles und melancholisches kleines Mädchen, das ständig am Daumen lutschte und sich seinen eigenen Berater hielt. Sie musste oft für mehrere Tage das Bett hüten, und wenn es ihr wieder gut genug ging, dass sie aufstehen konnte, las ich ihr (um ihrer Mutter einen Gefallen zu tun) Le Robinson Suisse vor, Sandfort and Merton, Evenings at Home, Les Contes de Madame Perrault, den Schiffbruch aus „Don Juan“, dessen wir nie müde wurden, den „Giaour“, den „Corsair“ und „Mazeppa“; und nicht zuletzt Peter Parley‘s Natural History, die wir auswendig konnten.
Und aus diesem letzteren Werk deklamierte ich oft für sie einen Text, der für mich das schönste Gedicht der Welt geblieben ist, möglicherweise, weil es das erste war, das ich selber las, oder auch, weil es so innig mit jenen glücklichen Tagen verknüpft ist. Unter dem Stich einer Wildente (nach Bewick, glaube ich) standen W.C.Bryants Verse „To a Water-fowl“ [Auf einen Wasservogel]. Sie bezauberten mich damals und bezaubern mich heute, wie nichts anderes mich je bezaubert hat. Denke ich an sie, werde ich wieder ein Kind mit der jungfräulichen Empfindungsfeinheit eines Kindes und seiner magischen Aufnahmefähigkeit für unbestimmte Andeutungen des Unendlichen.
Die arme kleine Mimsey Seraskier lauschte mit aufgerissenen Augen und schnellem Auffassungsvermögen. Sie hatte die seltsame Vorstellung, dass ein Paar unsichtbarer Wesen, „La fée Tarapatapoum“ und „Le Prince Charmant“ (zwei Lieblingsfiguren von Monsieur le Major) immer über uns wachten – über sie und über mich – und uns gleichermaßen lieb hätten, „La fée Tarapatapoum“ mich und „Le Prince Charmant“ sie – dass sie auf uns aufpassen und uns durchs ganze Leben behüten würden.
„O! Ils sont joliment bien ensemble, tous les deux – ils sont inséparables!“ [O, sie sind alle beide immer hübsch beisammen, sie sind untrennbar!], rief sie apropos dieser visionären Wesen aus; und apropos des Wasservogels sagte sie:
„Il aime beaucoup cet oiseau-là, le Prince Charmant! dis encore, quand il vole si haut, et qu’il fait froid, et qu’il est fatigue, et que la nuit vient, mais qu’il ne veut descendre!” [Er liebt diesen Vogel sehr, der Prince Charmant! Du sagst es doch, wenn er so hoch fliegt, wenn es kalt, wenn er müde ist und die Nacht kommt, er aber nicht hinunter will!]
Ich würde spritzig erwidern:
„All day thy wings have fanned,
At that far height, the cold thin atmosphere;
Yet stoop not, weary, to the welcome land,
Though the dark night be near.”
[Immer haben sich deine Flügel entfaltet
in der großen Höhe, der kaltdünnen Atmosphäre,
doch sink nicht ermattet auf willkommenes Land,
mag die dunkle Nacht auch nahe sein.]
(W.C. Bryant)
Und die Augen der armen, kränklichen, altklugen, erschöpften Mimsey würden sich mit Tränen füllen, sie würde nachdenklich an ihrem Daumen lutschen und an Unaussprechliches denken.
Dann würde ich Bewicks Holzstiche für sie kopieren, während sie auf der Armlehne meines Stuhls saß und mir geduldig zusah; und sie würde sagen: „La fée Tarapatapoum trouve que tu dessines dans la perfection!“ [Die Fee Tarapatapoum findet, dass du sehr gut zeichnest.], und würde diese kleinen Meisterwerke „pour l’album de la fée Tarapatapoum!“ wie Schätze aufheben.
Es gab eine Graphik, die sie über alle anderen schätzte – einen Stahlstich in einem Band von Byron, der zwei schöne Wesen beiderlei Geschlechts zeigte, die Hand in Hand durch eine dunkle Höhle gingen. Der Mann trug Seemannskluft, die Dame, leicht bekleidet und barfuß, hielt eine Fackel, und darunter stand geschrieben:
And Neuha led her Torquil by the hand,
And waved along the vaults her flaming brand!
(Und Neuha hielt ihren Torquil bei der Hand,
schwenkt‘ durch die Höhlen ihren Flammenbrand.)
Ich verbrachte Stunden damit, den Stich zu kopieren, und sie zog meine Kopie dem Original vor und bestand darauf, dass die beiden Figuren hervorragende Porträts ihres Prinzen und der Fee seien.

Manchmal während des Lesens und Zeichnens unterm Apfelbaum auf dem Rasen, wedelte der schlafende Médor (eine riesige Promenadenmischung von einem Hund, zusammengesetzt aus allen Rassen Frankreichs, mit den Vorzügen aller und den Fehlern von keiner) mit seinem dreizölligen Schwanz, gab leise begrüßende Traumwimmertöne von sich, und Mimsey sagte:
„C’est le prince charmant qui lui dit: Médor, donne la patte!” [Jetzt sagt der Prince Charmant zu ihm: Médor, gib Pfötchen!]
Oder unser alter Kater würde sich mit hochgerecktem Schwanz aus seinem Schlummer erheben und sich an einem imaginären Rock reiben; und das hieß:
„Regarde Mistigris! La fée Tarapatapoum est en train de lui frotter les oreilles!“ [Guck dir Mistigris an! Die Fee Tarapatapoum krault ihm gerade die Ohren!]
Wir sprachen meistens Französisch, obgleich unsere Väter und Mütter uns streng zum Gegenteil aufforderten, sie machten sich große Sorgen, wir könnten unser Englisch gänzlich verlernen.
Zeitweise fanden wir eine Art von genialem Kompromiss; denn Mimsey, die voller Ideen steckte, erfand eine neue Sprache oder vielmehr zwei neue Sprachen, die wir Frankingle und, je nachdem, Inglefrank nannten. Sie bestanden aus anglisierten französischen Nomen und Verben, die wir englisch konjugierten und aussprachen – und vice versa.
Zum Beispiel war es sehr kalt, das Fenster des Schulzimmers stand offen, dann sagte sie in Frankingle:
„Dispeach yourself to ferm the feneeter, Gogo. It geals to pier-fend! We shall be inrhumed!”, oder, wenn ich nicht gleich verstand: “Gogo, il frise a splitter les stones – maque haste et chute le vindeau; mais chute-le donc vite! Je snize déjà!” Das war Inglefrank.
Mit dieser Erfindung konnten wir Uneingeweihte verblüffen und verwirren, Engländer wie Franzosen. Der intelligente Leser, der es gedruckt vor sich sieht, wird sich nicht so schnell hereinlegen lassen.
Wenn es Mimsey gut genug ging, kam sie mit meinen Cousins und mir mit in den Park, wo wir unser Leben genossen, indem wir als Indianer im Hinterhalt lagen, Madge Plunket vor einem feigen Ritter retteten, oder Schlangen, Feldmäuse und Eidechsen jagten, nach Eidechseneiern gruben, die wir zu Hause auszubrüten versuchten, dieser freudvollen Zuflucht für alle Arten von Tieren wie auch kleiner Jungen und Mädchen. Denn dort gab es Eichhörnchen, Igel und Meerschweinchen; eine Eule, einen Raben, einen Affen, weiße Mäuse; kleine Vögel, die das mütterliche Nest verlassen hatten, bevor sie flügge wurden (sie starben immer!), den Hund Médor und manch anderen zugelaufenen Hund; gar nicht zu reden von einem gewaltigen Schaukelpferd, das aus einem wirklichen, ausgestopften Pony gemacht war, dem kleinsten Pony aller Zeiten!
Oft waren wir in unserer ausgelassenen Stimmung zu laut für Mimsey. Sie würde schreckliches Kopfweh bekommen, in einer Ecke sitzen, in einem Arm einen Igel und den Daumen der anderen Hand im Mund. Sie war nur glücklich, wenn wir allein zusammen waren, und dann moult tristement! [sehr traurig]
An Sommerabenden gingen ganze Gruppen von uns, Erwachsene und Kinder, durch den Park und den Bois de Boulogne zum Mare d’Auteuil. Wenn wir nah genug waren, dass Médor das Wasser roch, dann bellte, grinste und kreiselte er, wurde verrückt vor Begeisterung, denn er konnte nach Steinen tauchen und wollte uns das vorführen.
Dort fingen wir große olivfarbene Käfer mit gelber Unterseite, rotbäuchige Molche, grüne, schön gefleckte Frösche und schöner, parabolischer Sprungbahn; goldene und silberne Fische, lilabraun gescheckt. Ich erwähne sie in der Reihenfolge ihres Reizes. Die Fische waren zu zahm, zu leicht zu fangen, ihre Schönheit allzu kultiviert; der seltene, platte, hinterhältige Gelbrandkäfer „schoss den Vogel ab“.
Manchmal würden wir sogar durch den Bois de Boulogne nach St. Cloud gehen, um die neue Eisenbahn und die Züge zu sehen – ein unerschöpflicher Gegenstand der Verwunderung und des Entzückens – würden Eis essen in der „Tête noire“ (einem Hotel, das Tatort eines schrecklichen Mordes gewesen war, aus dem eine cause célèbre wurde); und wir würden durch die duftende Nacht zurückkehren, während die Glühwürmchen im Gras leuchteten und in der Ferne die Frösche im Mare d’Auteuil quakten. Dann und wann würde ein aufgescheuchter Rehbock von Dickicht zu Dickicht in kurzen Sprüngen den Weg überqueren, und Médor würde wieder verrückt spielen und das Echo der neuen Befestigungswerke von Paris erwecken, die noch im Bau waren.
Es war ihm nicht gegeben, Rehböcke zu erwischen!
Wenn mein Vater mit von der Partie war, würde er Tiroler Melodien jodeln und schöne Arien von Boieldieu, Hérold und Grétry singen; oder „Drink to me only with thine eyes“ oder auch die „Bay von Dublin“ für Madame Seraskier, die sich die Sehnsucht nach ihrem geliebten Heimatland erlaubte, wann immer ihr geliebter Gatte nicht da war.
Oder wir würden ein fröhliches Chorlied anstimmen und zu der Melodie
„Marie, trempe ton pain,
Marie, trempe ton pain,
Marie, trempe ton pain dans la soupe,
Marie, trempe ton pain,
Marie, trempe ton pain,
Marie, trempe ton pain dans le vin!”
[Marie, tunke dein Brot in die Suppe,
tunke dein Brot in den Wein!]
Oder auch
„La – soupe aux choux – se fait dans la marmite;
dans – la marmite – se fait la soupe aux choux.“
[Die Kohlsuppe macht man im Kochtopf,
im Kochtopf macht man die Kohlsuppe.“]
Wovon wir alle ordentlich Appetit aufs Abendessen bekamen.

Oder ein andermal, wenn es zu heiß zum Singen oder wir zu müde waren, verließ Monsieur le Major die Königreiche des Märchenlands, entblößte im Gehen seinen hohen Glatzkopf und erzählte ernst und voller Verehrung von seinem großen Meister, von Brienne, von Marengo und Austerlitz; vom Abschied in Fontainebleau und von den Hundert Tagen – aber niemals von St. Helena; davon zu erzählen, mutete er sich nicht zu. Und indem er sich langsam bis Waterloo voran arbeitete, setzte er seinen Hut auf und bewies uns durch A+B, wie die Engländer an diesem Tag so gut wie verloren hatten, und warum und wozu. Und eine feierliche, andächtige Stille legte sich über die Gruppe, während wir lauschten und einige von uns begannen, sich nach dem Bett zu sehnen.
O, die gute alte Zeit!
Die Nacht war geweiht für mich durch den Schimmer, den Duft und das Rascheln von Madame Seraskiers Kleid, wenn ich in dunkler werdender Dämmerung an ihrer Seite ging – ein Schimmer von Gelb, Hellblau oder Weiß – ein Duft nach Sandelholz, ein Rascheln, das den leichten, kraftvollen Schritt fester und schmaler Füße mit hohem Spann verriet, die nicht leicht zu ermüden waren; und den angstvollen mütterlichen Wunsch, wieder bei Mimsey zu sein, die für diese weiteren Ausflüge nicht robust genug war.
Auf den kürzeren pflegte ich Mimsey für den größeren Teil unseres Heimwegs manchmal auf dem Rücken zu tragen (um ihrer Mutter eine Freude zu machen) – eine leichte Bürde, mit ihren armen langen, dünnen Armen um meinen Nacken und ihrer bleichen kalten Wange an meinem Ohr – sie wog beinah nichts! Und wenn ich müde wurde, würde Monsieur le Major mich ablösen – aber nicht für lange. Sie wollte immer von Gogo getragen werden (denn so wurde ich aus unerfindlichem Grunde genannt, vielleicht einfach weil ich Peter hieß).
Sie würde beginnen bei den bleichen Birken, die sich von der Dunkelheit abhoben, und erschauern, wenn ein Zweig sie streifte und mir alles über den Erlkönig erzählen – „mais comme ils sont là tous les deux“ (sie meinte den Prinzen und die Fee) “il n’y a absolument rien à craindre.“ [aber weil alle beide dabei sind, gibt es einfach nichts zu fürchten.]
Und Mimsey war si bonne camarade trotz ihrer Feierlichkeit, ihrer schlechten Gesundheit und vieler Schmerzen, so empfänglich für kleine Gefälligkeiten, so erfreut über kleine Begabungen, so unduldsam mit kleinen Eitelkeiten (an denen sie keinen größeren Anteil hatte als ihre Mutter), und von so tiefer Heiterkeit trotz ihres ewigen Ernsts – denn sie war in ihrem Herzen ein richtiger Wildfang – dass ich sie bald nicht nur ihrer Mutter zu Gefallen trug, sondern um ihr einen Gefallen zu tun – und ich hätte alles für sie getan.
Was Monsieur le Major betrifft, so entdeckte er allmählich, dass Mimsey zur Hälfte eine Märtyrerin, zur Hälfte eine Heilige war und alle Tugenden unter der Sonne besaß.
„Ah, vous ne la comprenez pas, cette enfant; vous verrez un jour quand ça ira mieux! Vous verrez! Elle est comme sa mère … Elle a toutes les intelligences de la tête et du cœur!” [Ach, ihr versteht dieses Kind nicht; eines Tages, wenn es ihm besser geht, werdet ihr sehen! Ihr werdet sehen! Sie gleicht ihrer Mutter … Hat dieselbe Klugheit des Kopfes und des Herzens!] Und er drückte den Wunsch aus, es möchte dem Himmel gefallen haben, dass er entweder einen eigenen Sohn oder eine eigene Tochter hätte. Er war der geborene Großvater!
Darüber hinaus hatten Mimsey und ich viele gemeinsame Vorlieben – Musik zum Beispiel, ebenso die Holzstiche von Bewick und die Dichtungen von Byron, geröstete Maronen, Haustiere; und vor allem das Mare d’Auteuil, das sie im Herbst am liebsten mochte, wenn die braunen und gelben Blätter an seinem Rand wirbelten und hüpften und einander jagten oder auf seiner bewegten Oberfläche trieben, und der kaltfeuchte Wind durch die zerrauften Äste des Waldes unter dem bleiernen Himmel pfiff.
Sie sagte, es sei gut, dann dort an zu Hause und den offenen Kamin zu denken; noch besser, wenn das Zuhause schließlich erreicht war, des trostlosen Teichs sich zu erinnern, den wir verlassen hatten; und gut war es in der Tat, in der Dämmerung durch Wald, Park und Straße zu stapfen, wenn die Fledermäuse unterwegs waren, mit Alfred, Charlie und Mimsey, mit Madge und Médor unseren raschelnden Weg durch Massen toten Laubs zu nehmen, die schönen, reifen Rosskastanien aus ihrer gespaltenen weichen Hülle zu schälen oder im Gehen hier und da Eicheln und Bucheckern aufzulesen.
Und, zu Hause angelangt, war es schön, sehr schön, daran zu denken, wie dunkel, einsam und fröstelnd es jetzt war draußen am Mare, während wir da hockten und quatschten und am Holzfeuer im Schulzimmer Maronen rösteten, bevor die Kerzen angezündet wurden – entre chien et loup, wie man von der französischen Dämmerung sagte – während Thérèse das Teegeschirr aufdeckte, uns Neuigkeiten erzählte, Brot und Butter schnitt; und meine Mutter spielte im Wohnzimmer über uns Harfe; bis der letzte rote Streifen im nassen Westen hinter den wiegenden Baumwipfeln erstarb, die Vorhänge zugezogen wurden, es gab Licht, und der Hunger kam zu seinem Recht.
Ich liebe es, hier in meiner Einsamkeit und Gefangenschaft zu sitzen und mir jedes Detail jener süßen Zeit ins Gedächtnis zu rufen – zu leiden unter den Schmerzen glücklicher Erinnerung; für meinesgleichen gibt es, sagen uns große Dichter, keinen größeren Schmerz. Die Schmerzenskrone dieses Schmerzes ist meine Freude und mein Trost, ist es immer gewesen; und ich würde sie nicht gegen Jugend, Gesundheit, Reichtum, Ehre und Freiheit tauschen; nur gegen eine nochmalige und dreifach glückliche Kindheit würde ich wieder und wieder ihre dreifach glückliche Erinnerung tauschen.
Und damit es für uns kein reines Zuckerschlecken war und langweilig hätte werden können, mussten meine Cousins und ich ziemlich hart arbeiten. Zunächst einmal tat meine liebe Mutter alles, was sie konnte, um aus mir ein Wunderkind des Lernens zu machen. Sie versuchte mir Italienisch beizubringen, das sie ebenso fließend sprach wie Englisch und Französisch (da sie viel in italien gelebt hatte), und ich musste „Gierusalemme liberata“ in die beiden letzteren Sprachen übersetzen – eine Aufgabe, die unbeendet blieb – und das „Allegro“ und der „Penseroso“ im Stil Miltons in französische Prosa bringen, und „Le Cid“ in corneillianisches Englisch. Dann war die Geschichte Griechenlands und Roms von Pinnock zu bewältigen und natürlich die Bibel; und jeden Sonntag die Kollekte, das Evangelium und die Epistel auswendig lernen. Nein, es war kein Zuckerschlecken.
Ihr war es ein Vergnügen zu lehren, aber ach! meins war es nicht zu lernen; wir seufzten oft über einander, liebten einander vielleicht aber nur umso mehr.
Dann gingen meine Cousins und ich am Morgen zu Monsieur Saindou gegenüber, um französische Grammatik, französisches Latein und französisches Griechisch zu lernen. Aber an drei der wöchentlichen sechs Nachmittage kam Mr. Slade, ein in Paris gestrandeter Hilfslehrer aus Cambridge, um das Latein und Griechisch, das wir am Vormittag gelernt hatten, zu anglisieren (und zu neutralisieren) und uns zu zeigen, was für ein trauriges Zeug die Franzosen aus beiden Sprachen und ihren Silbenlängen gemacht hatten. Vielleicht sind die griechischen und lateinischen Silbenlängen ein Luxus englischer Kreszenz – ein bloßer sozialer Test – eine von uns erfundene Fallgrube wie der Buchstabe H für die Überführung unachtsamer Vortäuscher; aber vielleicht konnten es sich die Schulmeister, da französische Erziehung damals so bedauernswert billig war, nicht leisten, abstruse Überflüssigkeiten dieser Art zu berücksichtigen; für den Preis waren sie nicht zu haben.
Es sei daran erinnert, dass in Frankreich der König und sein Gemüsehändler ihre Söhne auf dieselbe Schule schickten (was allerdings auf Monsieur Saindous Institut nicht zutraf, wo es fast nur Gemüsehändler und keinen König gab); die Gebühr für Bett, Pension und Unterricht belief sich auf etwa dreißig Pfund im Jahr.
Dem Lateinischen fehlte infolge dessen die Vornehmheit, die sich aus der Exklusivität ergibt, es fehlte ihm die aristokratische Würze, auf der der Gelehrte sich nicht weniger dankbar ausruht als der Dummkopf und die allein das kostspielige britische Public-School-System (und der britische Akzent) einer toten Sprache mitgeben kann. Wenn das Französische einmal eine tote Sprache ist, werden wir ihm einen Reiz verleihen, den es nie zuvor hatte; manche von uns tun das schon heute.
Aus diesem Grund moralisieren die besten französischen Autoren anders als unsere so selten mit den üblichen hübschen, vertrauten und passenden Zeilen aus Horaz oder Virgil und schmücken mit ihnen ihre Erzählungen; und deshalb auch wird Latein im französischen Gespräch so selten zitiert außer dann und wann durch einen erschöpften Abteilungsleiter, der, während er die unverkaufte Seide aufrollt, seufzt:
„Varium et mutabile semper femina!“ [Launisch und schwankend immer die Frau, Virgil]; oder ausruft: „O rus! quando te aspiciam!“ [O Feld, wann sehe ich dich wieder? Ovid] wenn er am ersten schönen Sonntagmorgen im Frühling seine Eisenbahnfahrkarte nach Asnières löst.
Aber das war eine Abschweifung, und wir haben uns weit von Mr. Slade entfernt.
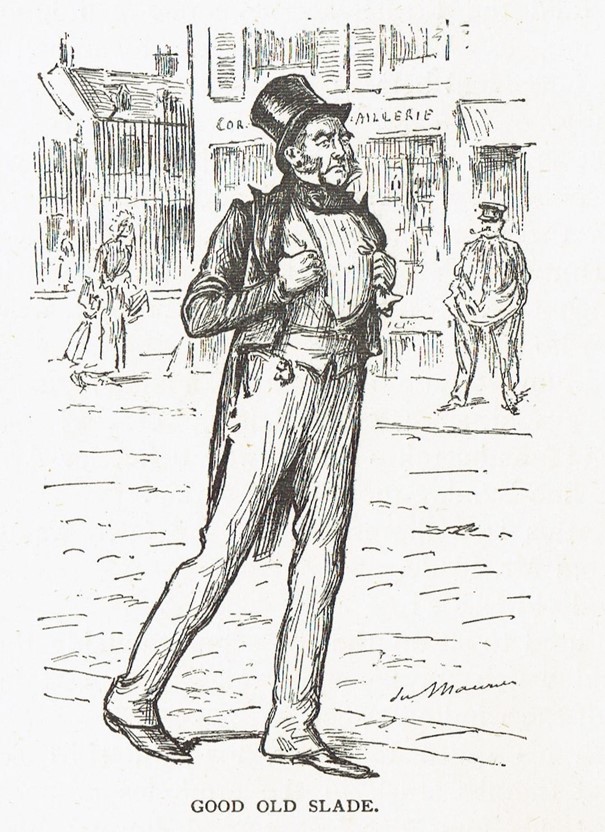
Guter alter Slade!
Wir pflegten auf den steinernen Pfosten vor dem Straßentor zu sitzen und darauf zu warten, dass er um eine bestimmte entfernte Ecke der gewundenen Straße bog.
Mit seinem grünen Frack, seinem steifen Hemdkragen, seinen dicken flachen Daumen, die er in die Ärmelausschnitte seiner Nanking-Weste steckte, seinen langen, flachen, einwärts gerichteten Füßen, seinen rötlichen Koteletten, seinem auf dem Hinterkopf sitzenden Hut und seinem sauberen, frischen, blühenden, rechtschaffenen Engländergesicht – war sein Anblick nicht sympathisch, wenn er schließlich erschien.
Manchmal hinderten ihn Krankheit oder häusliche Angelegenheiten zu seinem Bedauern, die Unterrichtszeit in unserer Mitte zu verbringen, und das Glück, das sich unser bemächtigte, wenn uns allmählich dämmerte, dass wir vergebens nach ihm Ausschau hielten, war zu groß, als dass wir es in Worten, Taten oder äußeren Demonstrationen hätten ausdrücken können. Es war genug, auf unseren Steinpfosten zu sitzen und es langsam über uns kommen zu lassen.
Diese Glücksmomente waren äußerst dünn gesät. Es wäre vielleicht unangebracht, dieses gelegentliche Fernbleiben eines hoch respektablen Englischen Dozenten mit dem Besuch eines Engels zu vergleichen, aber so empfanden wir es.
Dann aber würde er das am nächsten Nachmittag nachholen, dieser gewissenhafte Engländer; was fair war gegenüber unseren Eltern, aber nicht uns gegenüber; und was für eine Extrastrenge als Zins für das bettelhafte Darlehen eines halben Nachmittags! Was für ein Hauen auf tintenfleckige Finger mit einem gemeinen, harten, runden, polierten, hartholzigen, kontormäßigen englischen Lineal!
Wir hatten uns angewöhnt in jenen Tagen, alles Englische für gemein zu halten – ein Ausdruck, den wir nach der Meinung unserer Eltern allzu gern benutzten.
Aber vielleicht waren wir nicht ganz ohne Entschuldigung für dieses unverzeihliche Gefühl. Denn es gab noch eine andere englische Familie in Passy – die Prendergasts, eine ältere Familie als unsere, das heißt, die Eltern (und Onkel und Tanten) waren mittleren Alters, die Großmutter tot und die Kinder erwachsen. Wir hatten nicht die Ehre ihrer Bekanntschaft. Aber ob das ihr Pech oder unser Fehler war (oder vice versa), weiß ich nicht. Hoffen wir, das erstere.
Sie waren von ganz anderer Art als wir, und auch, wenn ich es sage: ihre Art war von einzigartiger Reizlosigkeit; vielleicht waren sie die Vorlage für jene Karikaturen unserer Landsleute, mit denen französische Karikaturisten Rache für Waterloo zu nehmen versuchten. Sie waren steif, hochmütig, geringschätzig. Hatten vorstehende Vorderzähne, Adlernase, lange Oberlippe, fliehendes Kinn; stumpfe, kalte, dumme, selbstsüchtige grüne Augen, die weder nach rechts, noch nach links, sondern starr über die Köpfe der Leute hinweg sahen, während sie einherstolzierten in der Anmaßung ihrer unfehlbaren britischen Selbstgerechtigkeit.

Bei ihrem plötzlichen Anblick (besonders an Sonntagen) wurden alle Kardinaltugenden auf der Stelle hassenswert und Respektabilität etwas zum Weglaufen. Sogar die blanke, glattrasierte Reinlichkeit war so puritanisch aggressiv, dass man den bloßen Gedanken an Seife verabscheute.
Ihr Akzent, wenn sie (in Läden) französisch sprachen, war nicht musikalisch, süß und sympathisch wie der von Madame Seraskier, sondern barbarisch und grotesk mit furchtbaren „ongs“ und „angs“, und „ows“ und „ays“; ihre Haltung war anmaßend, misstrauisch und herablassend; und dann hörten wir ihre unverschämten beiseite gesprochenen Bemerkungen; und auch wenn sie groß, aufrecht und äußerlich nicht missbildet waren, sie waren doch derartige Spaßbremsen, Skelette auf einem Fest, Unheil verkündende Karnevalsmasken von feierlicher Leere, solche öden, trübseligen, unkomischen Witzfiguren, dass man ahnte: Waterloo würde eines Tages vergessen und vergeben sein, sogar in Passy, aber die Prendergasts – niemals!
Ich lebe nun so lange fern von aller Welt, dass nach allem, was ich weiß, dieser „grimmige, plumpe, gespenstische, hagere und unheilvolle Vogel von einst“ ausgestorben sein könnte wie ein anderer, aber weniger reizloser Vogel: der Dodo; wobei wir uns ja noch im Stand der Gnade befinden.
Aber in jenen Tagen verallgemeinerten wir etwas übereilt, wie junge Leute es gerne tun, gelangten zu der Vorstellung, England müsse voll von Prendergasts sein, und wollten da nicht hin.
Von dieser generellen englischen Garstigkeit machten wir, das ist wahr, einige wenige Ausnahmen: Tee, Senf, Mixed Pickles, Pfefferkuchen-Nüsse, und, wichtiger als alles in der Welt, der englische Laib Hausbrot, der uns einmal wöchentlich als große Gaumenfreude und Belohnung für unsere Tugenden erreichte und so gut zur Butter von Passy passte. Es war zu lecker! Aber es gab immer eine Schwierigkeit, ein Dilemma – sollte man es nur mit Butter essen – oder cassonade (französischen braunen Zucker) drüberstreuen?
Mimsey wusste, was sie wollte, und aß es mit französischem braunem Zucker, und wenn sie nicht da war, bewahrte ich ihr die Hälfte meiner Scheiben auf und bestreute sie sorgsam selbst und für sie mit cassonade.
Andererseits war für uns alles Französische das Gegenteil von garstig – außer den französischen Jungen, die wir kannten, und bei Monsieur Saindou gab es etwa zweihundert davon; dann gab es da all die Jungen von Passy (deren namen Legion waren und die nicht das Institut von Monsieur Saindou besuchten), und wir kannten alle Jungen in Passy. So dass wir nicht alles Materials für gute, fade, mürrische, patriotische englische Vorurteile beraubt waren.
Ebenso wenig unterließen es die französischen Jungen, uns im Gegenzug garstig zu finden und diese ihre Auffassung gelegentlich zum Ausdruck zu bringen; besonders die gewöhnlichen kleinen Jungen, deren Spielplatz die Straße war, die voyous de Passy [Strolche von Passy]. Sie hassten unsere weißseidenen Zylinder, großen Krägen und Eton-Jacken, und nannten uns sacred godems, wie ihre Vorfahren die Unseren in Zeiten Johannas von Orleans nannten. Manchmal warfen sie mit Steinen, und dann kam es zu Zusammenstößen und blutigen frechen französischen Nasen und zum Weglaufen verzagter kleiner französischer Beine und furchtsamem Wehgeschrei: „O là, là! O là, là – maman!“, wenn die Engländer sie ereilten.
Freilich bluteten auch unsere Nasen unsieghafter Weise dann und wann – durch einen gewissen Hufschmied – immer derselbe junge Hufschmied – Boitard!
Immer richtet ein junger Hufschmied Derartiges an – oder ein junger Metzger.
Natürlich hat ihn zur Ehre Großbritanniens einer von uns so nach Noten durchgedroschen, dass er den Kopf seither nicht mehr aufrecht halten konnte. Es ging um eine Katze. Es passierte in der Dämmerung eines Weihnachtsabends auf der „Schwaneninsel“ zwischen Passy und Grenelle (zu spät, um die Katze zu retten).
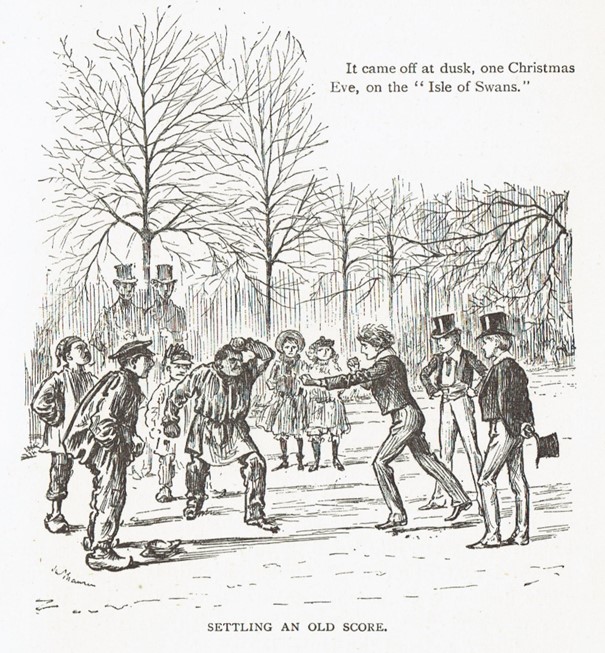
Ich war der Held dieses Kampfes. „Jetzt oder nie,“ dachte ich, sah rot und ging auf meinen Gegner los wie ein Verrückter. Den Ring bildeten Alfred und Charlie, unterstützt, seltsam genug, von einem Paar männlicher Prendergasts, die sich dazu herabließen, die Vorgänge interessant zu finden. Madge und Mimsey sahen erschrocken und bezaubert zu.
Der Kampf dauerte nicht lange und wäre es wert, von Homer besungen oder sogar in Bell’s Life [Londoner Sportzeitung] zu erscheinen. Aus diesem Grund beschreibe ich ihn nicht. Solange er dauerte, schienen die beiden Prendergasts ihn sehr zu genießen, und als er vorbei war, besannen sie sich, sagten nichts und stolzierten davon.
*****
Als wir älter und klüger wurden, wurde es uns erlaubt, unsere Ausflüge bis nach Meudon, Versailles, St. Germain und an andere herrliche Orte auszudehnen; auf Mietpferden dorthin zu reiten, nachdem wir in der berühmten Reitschule in der Rue Duphot gebührend Reiten gelernt hatten.
Außerdem gingen wir in den entzückenden Sommerbädern der Seine schwimmen, die so majestätisch Schwimmschulen heißen und wurden ehemalige Meister in „la coupe“ (ein Streich, den kein Engländer außer uns je vollbracht hat) und in all den verschiedenen feinen Nuancierungen des Kopfsprungs – „la coulante“, „la hussarde“, „la tete-beche“, „la tout ce que vous voudrez.“
Außerdem machten wir uns mit Paris vertraut, besonders mit dem alten Paris.
Zum Beispiel gab es die Insel von St. Louis mit ihren stattlichen alten Palästen entre cour et jardin, hinter grimmen Steinportalen und hohen Mauern, wo hohe Beamte und Anwälte in gediegener Abgeschiedenheit wohnten – der Amtsadel; wo aber in vergangener Zeit der bedeutendere Schwertadel gewohnt hatte, Kreuzzügler vielleicht und Tempelritter wie Brian de Bois-Guilbert. [Figur aus Walter Scotts „Ivanhoe“]
Und dann die noch berühmtere Insel, la Cité, wo Paris selbst geboren wurde, wo Notre Dame ihre Zwillingstürme emporreckte über den trübsinnigen, grauen, leprösen Mauern und schmutzigbraunen Dächern des Hôtel-Dieu.
Armselige, vor Alter fast zusammenbrechende Häuschen, ohne Umriss und Perspektive, schmiegten sich wie alte Spinnweben zwischen die Pfeiler der großen Kathedrale; und auf zwei Seiten des kleinen Platzes davor (der Place du Parvis Notre Dame) standen alte Steinbauten mit hohen Schieferdächern und kunstvoll gewundenen schmiedeeisernen Balkonverkleidungen. Sie schienen so romantische Geschichten zu verbergen, dass ich nie müde wurde, sie zu betrachten und mich zu fragen, was für Geschichten das wohl waren. Und wo ich jetzt daran denke, muss eins dieser Gebäude das Hôtel de Gondelaurier gewesen sein, wo, wenn es nach dem wahrheitsliebendsten Historiker aller Zeiten geht, die arme Esmeralda einstmals tanzte und den Tamburin schüttelte, um das blonde Fräulein Fleur-de-Lys de Gondelaurier und dessen edle Freunde zu unterhalten, die sie doch alle an Schönheit, Reinheit, Güte und Erziehung übertraf (obgleich sie nur ein ungebildetes Zigeunermädchen aus der Gosse war); und dort, vor ihnen allen und dem fröhlichen Bogenschützen, wurde ihr endlicher Untergang durch den Verrat ihrer Ziege herbeigeführt, der sie so unbesonnen beigebracht hatte, den geliebten Namen „Phébus“ zu buchstabieren.
Nicht weit davon entfernt war die Morgue, das grauenhafte Gebäude, das der große Stecher Charles Méryon mit der bizarren Faszination ausstattete, die derjenigen ähnelt, die sie in jenen Tagen auf mich ausübte – und heute noch ausübt, wenn ich sie mit den bezauberten Augen der Erinnerung betrachte.
La Morgue! Was ein unheilvoller Klang liegt schon im bloßen Namen!
Hatte man sich an den Schrecken des Innern (denn solche waren es für einen geistig gesunden englischen Jungen) satt gesehen, so war es nur ein Schritt bis zur Reiterstatue von Henri Quatre auf dem Pont Neuf (der ältesten Brücke von Paris, das nebenher). Rittlings auf seinem langschweifigen Schlachtross sitzend lächelte le roy vert et galant, genau in der Mitte zwischen beiden Ufern des historischen Flusses, wo er am historischsten ist, und wandte dem Paris des Bürgerkönigs mit seinem birnenförmigen Gesicht und den Koteletten den Rücken.
Und da stand man nun, gebannt und unentschlossen wie Buridans Esel zwischen zwei Hafersäcken. Denn auf beiden Seiten, im Norden und im Süden des Pont Neuf, waren bezaubernde Slums zu finden, die einen attraktiver als die anderen, hügelauf und –ab sich windend und rundherum und ein und aus wie die gespenstischen Illustrationen von Gustave Doré zu Balzacs Tolldreisten Geschichten (die ich, wenn ich das sagen darf, erst viele Jahre später las).
Dunkle, enge, stille verlassene Straßen, die hinaufführten in so manchen Alptraum – mit der Gosse in der Mitte, Türmchen und Steinpfosten an den Seiten; und irre hohen Mauern (an denen es défendu d’afficher war) und Resten alter Wehrgänge oben drauf, Platanen- und Limonenzweigen, die darüber hingen, und dahinter graue alte Gärten aus der Zeit von König Ludwig dem Zänker und davor! Und vielsagende Namen, in alten rostigen Eisenlettern an die Straßenecken geschrieben – „Rue Videgousset“ [Leere-Taschen-Straße], „Rue Coupe-gorge“ [Kehlschnittstraße], „Rue de la vieille Truanderie“ [Straße der alten Gaunerei], „Impasse de la Tour de Nesle“ [Sackgasse vom Nesle-Turm], und so weiter, sie regten die Phantasie an wie ein Kapitel Hugo oder Dumas.
Der Weg dahin führte durch lange, gewundene, belebte Durchfahrten, ganz unregelmäßig gepflastert, und alle belebt mit seltsamen, entzückenden Leuten in blauen Blusen, braunen Wolltrikots, Holzschuhen, rotweißen Baumwollnachtmützen, geflickten Lumpen; mit sehr anmutigen Mädchen mit hübschen, anständigen Füßen, blitzenden Augen und keinerlei Kopfputz außer dem eigenen Haar; mit fröhlich grinsenden dicken und dünnen alten Vetteln mit Gesichtern von entsetzlicher Bosheit und Verkommenheit; mit altklug witzigen kleinen Gossenkobolden beiderlei Geschlechts; und mit Krüppeln! Heitere Bucklige, rüstige blinde Bettler, fröhlich kriechende Gelähmte, skrofulöse arme Wesen, die über ihre Leiden juxten und witzelten; unbeschwert freundliche Bettelmonster ohne Arme oder Beine, die sich auf ihren Bäuchen durch den Matsch wälzten von einem Weinkellerlokal zum andern; blaukinnige Priester und barfüßige braune Mönche, ernste barmherzige Schwestern, und hier und da ein vergnügter Lumpensammler mit seiner Kiepe und seinem Knapsack hinten drauf; oder ein Kürassier, oder ein riesiger Karabiniere, oder ein vergnügter kleiner „Afrikanischer Jäger“, oder ein Paar kühner Gendarmen, die neben einander ritten mit ihren gewaltigen schwarzen bonnets à poil; [Pelzmützen] oder ein Paar Mitleid erregender rothosiger Soldaten, gerade frisch vom Land eingezogen, mit unschuldigen hellen Augen, strohblondem Haar und sommersprossigen Gesichtern, Hand in Hand gehen sie, starren in die Läden der Schweineschlachter und manchmal auf des Schweineschlachters Weib!
Dann ein Hochzeitszug von Arbeitern – Braut und Bräutigam vorneweg, unbeholfen in ihren besten Sonntagssachen, alle zusammen laut singend. Dann ein Armenbegräbnis oder eine bedeckte Bahre, der mitleidige Augen folgen auf ihrem Weg zum Hôtel Dieu; oder die letzte Ölung mit Glocke und Kerze, bestimmt für die Bettstatt irgendeines in extremis demütig mit dem Tode Ringenden – und wir entblößten alle den Kopf, als sie vorbeikam.
Und dann, als ständige Tonbegleitung die hallenden Glockentöne, die wiederkehrenden Straßenrufe, das Geklingel des marchand de coco [Kokosnusshändlers], die Trommel, das cor de chasse [Jagdhorn], die Drehorgel des Berbers, die allgegenwärtigen zahmen Papageien, der Scherenschleifer, der schreiende Pommes-frites-Händler, und als Lustigstes von allem der Pudelfriseur und sein Sohn, Strophe und Antistrophe, minütlich gellt der Junge in seinem schrillen Diskant: „Mein Vater schneidet Pudel für 30 Sous; er fängt widerspenstige Kater ein“, worauf der Vater in seinem feierlichen Bass grummelt: „Mein Sohn sagt die Wahrheit“ – L’enfant dit vrai!
Und über die allgemeine Kakophonie erhebt sich der Lärm des ewigen Peitschenknallens, der schweren Wagenräder, die über die unebenen Steine holpern, des Stampfens und Wieherns der lebhaften kleinen französischen Wagenpferde, die Musik ihrer vielen Glöckchen und des Schimpfens und Fluchens, des hue! dià! der Kutscher. Es war alles herrlich.
*****
Von dort nach Hause – ins ruhige, unschuldige, vorstädtische Passy, die Uferstraßen entlang, immer oben auf der Mauerbrüstung, um auch nichts zu verpassen (bis ein Gendarme in Sicht kam), oder auf den Boulevards, der Rue Rivoli, den Champs Élysées, der Avenue de St. Cloud und der Chaussée de la Muette. Was für ein schöner Weg! Gibt es irgendwo einen vergleichbaren mit dem, wie er war in den süßen frühen Vierzigern dieses abgetragenen Jahrhunderts – und bevor dieser armselige Schreiberling in die Flegeljahre kam?
Ach, es ist schon was, dieses Paris gekannt zu haben, das einem zu Füßen lag, wenn man von den Höhen von Passy hinabblickte, mit all seinen Spitzen und Türmen, all seinen prächtig vergoldeten Kuppeln, seinem Arc de Triomphe, seinen Champs Élysées, dem Champ de Mars, den Türmen von Notre-Dame, der weit entfernten Colonne de Juillet, dem Dôme des Invalides, dem Hôpital Val-de-Grâce, der Église de la Madeleine, der Place de la Concorde, wo neben den schönen unvergesslichen Brunnen der Obelisk seine exotische Spitze emporreckt.
Da floss der sich unter vielen Brücken hindurchwindende Fluss immer in die gleiche Richtung, anders als unsere von Ebbe und Flut regierte Themse, und immer gut gefüllt. Auf der anderen Seite dehnte sich der stattliche, exklusive Vorort aus zur Verzweiflung der Neureichen und kürzlich Geadelten, wo beinahe jedes Haus einen Namen trug, der sich wie eine Seite aus dem Buch der französischen Geschichte las; und weiter noch das fröhlich verruchte Quartier Latin, die gravitätische Sorbonne, das Panthéon, der Jardin des Plantes; auf dieser Seite in mittlerer Entfernung der Louvre, in dem für Jahrhunderte die französischen Könige gewohnt hatten; die Tuilerien, in denen der „König der Franzosen“ damals wohnte, wenn auch nur noch für kurze Zeit.
Ja, ich kannte und liebte es alles; und am meisten liebte ich es, wenn die Sonne in meinem Rücken versank und zahllose entfernte Fenster das blutrote westliche Feuer reflektierten. Es sah aus, als ob halb Paris in Brand geraten wäre vor dem kaltblauen Osten als Hintergrund.
Liebes Paris!
Ja, es ist schon was, es als kleiner Junge durchstreift zu haben – ein kleiner englischer Junge (und das heißt unbeaufsichtigt von seiner Mutter oder seinem Kindermädchen), neugierig, wissbegierig und unermüdlich; voller Phantasie; alle Sinne gespannt mit der Gespanntheit, die zum Frühling des Lebens gehört: dem Blick eines Falken, dem Gehör einer Fledermaus und dem Geruchssinn beinahe eines Hundes.
In der Tat brauchte man eine sowohl feine als auch vorurteilsfreie Nase, um dieses Paris zu verstehen, zu schätzen und durch und durch zu genießen – nicht das Paris von Monsieur le Baron Haussmann mit Gasbeleuchtung und elektrischem Licht, entwässert und mit Wasser versorgt durch die moderne Wissenschaft; sondern das „gute alte Paris“ von Balzac und Eugène Sue und Les Mystères [„Die Geheimnisse von Paris“ von Eugène Sue] – das Paris der schummrigen Öllaternen, die an eisernen Masten hingen (an denen einst Aristokraten aufgehängt wurden); von Wasserträgern, die Wasser aus ihren Handkarren verkauften und es dir an die Tür brachten (au cinquième), den Eimer für einen Penny, um davon zu trinken, darin dich zu waschen, damit zu kochen und alles.
Es gab ganze Straßen – und das waren in keiner Weise die am wenigsten spannenden und romantischen – wo die ungeschriebenen häuslichen Aufzeichnungen eines jeden Haushalts in der Luft davor unterwegs waren, Aufzeichnungen, die nicht immer appetitlich und lecker, aber immer interessant und bezaubernd waren.
Wenn man die porte cochère passierte, wusste man mit einem Atemzug, welcher Art die Leute waren, die dahinter und darüber lebten, was sie aßen, was sie tranken, womit sie handelten; ob sie zu Hause wuschen, ob sie Talg oder Wachs (in ihren Lichtern) brannten, ob sie Zichorie in ihren Kaffee mischten und Gruyère-Käse sehr liebten – den größten, billigsten und ehrlichsten Käse der Welt; ob sie mit Öl oder mit Butter brieten, ob sie ihre Omeletts stark gebraten liebten und Knoblauch an ihren Salaten; ob sie Schwarzen Johannisbeer-Likör oder Anisette tranken; ob sie unter Mäuseplage litten oder Katzen und Mausefallen benutzten oder keins von beidem, um sie los zu werden; ob sie je nach Saison Veilchen, Nelken oder Levkojen kauften und sie zu lange aufbewahrten; ob sie an Freitagen mit roten oder weißen Bohnen oder Linsen fasteten oder einen Dispens vom Papst hatten oder zufällig sogar vom Dispens des Papstes dispensiert waren.
Denn von so verräterischer Art waren die Andeutungen in jenem vielschichtigen Geruchsturnier.
Ich will seine Grundnote nicht bestimmen – immer da, immer dieselbe; groß mit ihrer Warnung vor baldigem Leid für viele Haushalte; deren unbeachtete Wellen, langsam aber sicher und bedrohlich wie die, die sich bei großen Anlässen von le Bourdon de Notre Dame (dem Big Ben von Paris) wälzten, über die fröhliche Stadt und weiter trieben, Tag und Nacht – in jeden Winkel drangen, die heimlichsten Nischen fluteten, selbst den Weihrauch vor den Stufen des Altars löschten.
„Le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre
Est sujet à ses lois;
Et la garde qui veille aux barrières du Louvre
N’en défend point nos rois.“
[Der Arme in seiner Hütte, wo das Stroh ihn deckt,
ist seinen Gesetzen unterworfen;
Und die Wache an den Schranken des Louvre
schützt unsere Könige nicht vor ihm.]
(François de Malherbe: Consolation à M. Du Périer sur la mort de sa fille)
Und hier, während ich schreibe, kommt aus der Vergangenheit der zarte, kaum wahrnehmbare, geisterhafte Verdacht eines Dufts zu mir zurück – eine bloße sehnsüchtige Vorstellung, zusammengesetzt, speziell, künstlich und allumarmend – ein abstraktes olfaktorisches Symbol für „Tout Paris“ vor fünfzig Jahren; und gern würde ich ihn einatmen in all seiner unverfälschten Fülle und Kraft. Denn manchmal sublimieren Düfte wie Töne der Musik die Essenz der Erinnerung (das ist ein erstaunlich toller Satz – ich hoffe, er ist nicht sinnlos), und sie müssen nicht als solche verführerisch sein, um die Verführung vergangener Szenen und Tage zu beschwören.
Ach, Düfte können nicht nach Lust und Laune wieder zum Leben erweckt werden wie ein
„Air doux et tendre
Jadis aimé!”
[süßes und zärtliches,
einst geliebtes Lied!]
(Alfred de Musset)
O wenn ich doch einen alten französischen Duft summen oder pfeifen könnte! Ich könnte ganz Paris, das süße, präimperiale Paris in einem einzigen Hauch wieder erstehen lassen!
*****
Auf diese Weise haben wir drei kleinen Jungen wie die drei Musketiere (deren rühmliche Heldentaten damals ganz Frankreich erfüllten) süße Erinnerungen gesammelt und gestapelt um sie in späteren Jahren wiederzukäuen, wenn wir weit weg und voneinander getrennt sein würden.
Von der ganzen bande joyeuse – alt und jung und mittelalt, von Monsieur le Major bis zu Mimsey Seraskier – sind jetzt alle tot – außer mir – alle außer der lieben Madge, die so hübsch und fröhlich war; ich habe sie seither nicht gesehen.
*****
So habe ich versucht, in aller mir möglichen Eile (denn ich gehöre eher zu den Langsamen) die glückliche Zeit zu skizzieren, die, als ich zwölf Jahre alt war, plötzlich und tragisch zu Ende ging.
Mein lieber, heiterer und leichtlebiger Vater wurde binnen einer Minute durch die Explosion einer Sicherheitslampe eigener Erfindung getötet, die die von Sir Humphry Davy ersetzen und uns ein Vermögen einbringen sollte! Was für eine brutale Ironie des Schicksals!
So gewiss war er seines Erfolgs, so zuversichtlich, „sein Schiff sei endlich nach Hause gekommen“, dass er in Kaufverhandlungen für ein hübsches kleines altes Herrenhaus in Anjou eingetreten war (mit einem dazu passenden alten Schlösschen). Es hieß La Marière und hatte den Vorfahren gehört, von denen er unseren Namen ableitete (denn wir hießen Pasquier de la Marière, nach einer guten alten Familie); dort wollten wir als gentilshommes campagnards [Landedelleute] auf eigenem Grund und Boden leben und für immer Franzosen sein unter dem väterlichen, birnenköpfigen Bürgerkönig als einem vorübergehenden pis-aller [Notbehelf], bis Henri Cinq, Comte de Chambord [Henri d’Artois] wieder in seine Rechte eingesetzt werden würde, um uns zu Grafen, Baronen und Peers von Frankreich zu machen – der Himmel weiß, wofür!
Meine Mutter, die außer sich vor Trauer war, ging nach London, wo dieser schreckliche Unfall sich ereignet hatte, und war dort kaum angekommen, als sie eines toten Kindes entbunden wurde, und sofort starb; in weniger als einer Woche war ich zu einem mittellosen Waisenkind geworden. Denn es stellte sich heraus, dass mein Vater inzwischen jeden Penny seines eigenen und des Vermögens meiner Mutter ausgegeben hatte und bei seinem Tod hoch verschuldet war. Ich war zu jung und zu gramerfüllt, um irgendetwas außer Trauer um den schrecklichen Verlust zu verspüren, aber sehr bald ging mir auf, dass meine Lebensweise sich grundlegend ändern musste.
Ein Verwandter meiner Mutter, Colonel Ibbetson (der gut situiert war), kam nach Passy, um sein Bestes für mich zu tun, die in der Nachbarschaft aufgelaufenen Schulden zu begleichen und meine unglücklichen Angelegenheiten zu regeln.

Nach einiger Zeit entschied er zusammen mit dem Rest der Familie, dass ich mit ihm nach London zurückkehren und dort bestmöglich nach seinem Ermessen untergebracht werden sollte.
Und an einem schönen, stark nach Flieder duftenden Morgen voller Libellen, Schmetterlinge und Hummeln endete meine Kindheit, wie sie begonnen hatte. Der Abschied war herzzerreißend (für mich), zeigte mir aber, dass ich Zärtlichkeit nicht nur empfinden, sondern auch einflößen konnte, und das war Balsam für meinen Schmerz.
„Adieu, cher Monsieur Gogo. Bonne chance, et le Bon Dieu vous bénisse!“, sagten Vater und Mutter François. Tränen liefen an der Hakennase des Majors auf seinen nun fast weißen Schnurrbart herab.
Madame Seraskier presste mich an ihr freundliches Herz, segnete und küsste mich wieder und wieder, ihre warmen Tränen regneten auf mein Gesicht und ihres war das letzte, das ich sah, als wir auf unserem Flug Richtung London in die Rue de la Tour einbogen und Colonel Ibbetson ausrief:
„Rumtreiber! Wer ist die entzückende junge Riesin, die so scharf auf dich zu sein scheint, Lausekerl, hm? Beim heiligen Schorsch, du kleiner Don Juan, ich hätte was dafür gegeben, an deiner Stelle zu sein! Und wer ist der hübsche alte Knabe mit dem langen grünen Mantel und dem roten Ordensband? Eine vieille moustache, vermute ich; sieht fast wie ein Gentleman aus. Das können verdammt wenige Franzosen für sich in Anspruch nehmen!“
Das war Colonel Ibbetson.

Und dann, noch während er sprach, fiel plötzlich ein kleiner Tropfen trotzigen, kalten Hasses auf meinen Beschützer und Wohltäter, destilliert aus seiner Stimme, seinem Anblick, dem Ausdruck seines Gesichtes und seiner Art, Dinge auszusprechen, in mein Bewusstsein, wo er nie wieder weggewischt werden sollte.
Was die arme Mimsey betrifft, so war ihr Schmerz so überwältigend, dass sie nicht herauskommen und von mir Abschied nehmen konnte wie die anderen; und es kam, wie ich später hörte, zu einer langwierigen Erkrankung, der schlimmsten, die sie je hatte; und als sie sich erholte, musste sie entdecken, dass ihre schöne Mutter nicht mehr unter den Lebenden war.
Madame Seraskier starb an der Cholera wie auch Vater und Mutter François, Madame Pelé und einer der napoleonischen Gefangenen (nicht Monsieur le Major) und einige andere Leute, die wir gekannt hatten, einschließlich Thérèses, einer unserer Dienerinnen, die uns so ergeben gewesen war – und wir ihr ebenfalls. Das bösartige Gift, das ich mit der großen Glocke von Notre Dame verglichen habe, hatte gewarnt und gewarnt und hatte umsonst gewarnt.
Die maison de santé wurde aufgelöst. Monsieur le Major und seine Freunde verließen sie und wohnten auf Ehrenwort woanders, bis eine bessere Zeit für sie anbrach, als ihr verlorener Führer zurückkehrte und blieb – zunächst als Präsident der französischen Republik, dann als Kaiser aller Franzosen. Danach war kein Ehrenwort mehr nötig.
Meine Großmutter, Tante Plunket und ihre Kinder flohen schreckensstarr nach Tours, und Mimsey ging mit ihrem Vater nach Russland.
So trostlos endeten die allzu glücklichen sieben Jahre, und deshalb nicht mehr im Moment über
„Le joli lieu de ma naissance!“
[Der schöne Ort meiner Geburt!]
Teil zwei
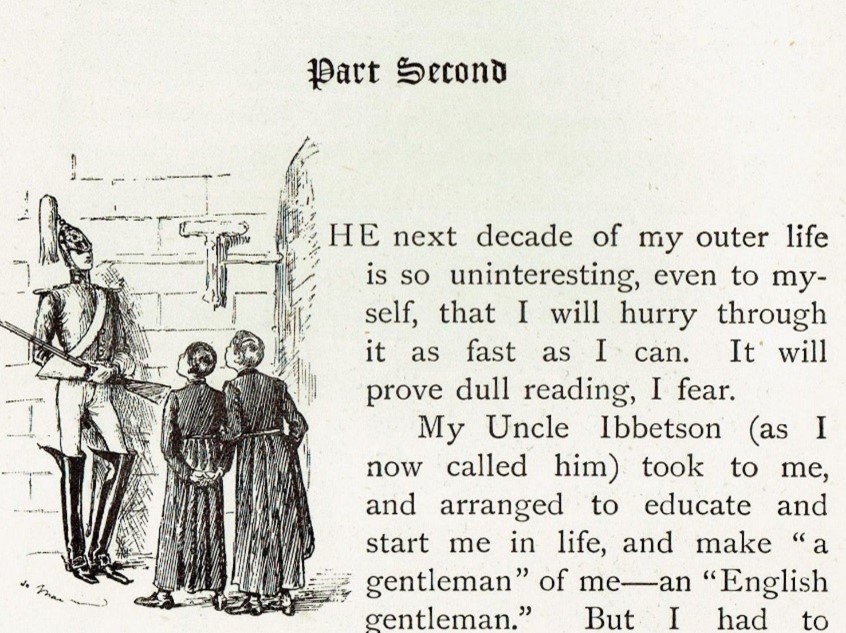
Die nächste Dekade meines äußeren Lebens ist so uninteressant sogar für mich selbst, dass ich sie so schnell wie möglich hinter mich bringen will. Ich fürchte, es wird eine langweilige Lektüre.
Onkel Ibbetson (wie ich ihn nun nennen werde) nahm mich zu sich, übernahm es, mich zu erziehen und ins Leben einzuführen und einen Gentleman aus mir zu machen, einen englischen Gentleman. Aber ich musste meinen Namen ablegen und seinen annehmen; aus einem mir unbekannten Grund mochte er meinen Vatersnamen nicht. Vielleicht weil er meinen Vater lebenslang auf vielerlei Weise gekränkt und dieser ihm immer verziehen hatte; ein sehr triftiger Grund! Vielleicht aber auch, weil er meiner Mutter, als sie noch ein Mädchen war, dreimal einen Antrag gemacht und dreimal einen Korb erhalten hatte! (Nach dem dritten Korb ging er für sieben Jahre nach Indien, kurz vor seiner Abreise heirateten meine Eltern, und ein Jahr später kam ich auf die Welt.)
So wurde aus Pierre Pasquier de la Marière, alias Monsieur Gogo, Meister Peter Ibbetson, und er besuchte Bluefriars, die Schule, in der man eine graue Kutte trug und in der er sechs Jahre verbrachte, ein wichtiger Abschnitt im Leben eines Mannes, vor allem in dem Alter.
Ich hasste die Tracht, ich hasste die Umgebung – das große Hospital hinter der Schule, den Gestank von Grausamkeit, Trunkenheit und Dreck, den Viehmarkt – hier war jedes Gebäude entweder ein Schlachthaus, eine Schnapsbude oder ein Leihhaus, mehr als alles aber hasste ich das düstere Gefängnis gegenüber, in dem man manchmal an einem Montagmorgen öffentlich jemanden henkte. Dieses bedrückende Gefängnis verfolgte mich in meinen Träumen, wenn ich von Passy träumen wollte, von meinem lieben toten Vater, meiner Mutter und von Madame Seraskier.
Im ersten Semester, oder auch noch im zweiten, waren sie immer in meiner Vorstellung, ich zeichnete ihre Profile auf Pulte, Schiefertafeln und Hefte, bis die Erinnerung an sie verblasste; und dann zeichnete ich Monsieur le Major, bis sein Profil völlig demoralisiert und unmöglich aussah und nichts Lebendigem mehr glich. Dann zog ich mich auf andere zurück: den Pater François mit seinem ewigen bonnet de colon und den mit Stroh ausgestopften Holzschuhen; den Hund Médor, das Schaukelpferd und den ganzen Rest der Menagerie; die Postkutsche, in der ich Paris verlassen hatte; die Kuriere mit schweren Schaftstiefeln, blanken Helmen und Zöpfen, blauen Mänteln mit Silberknöpfen und kurzen Schößen, die durch Passy zu reiten pflegten auf ihrem Weg von den Tuilerien nach St. Cloud und zurück, auf wiehernden kleinen grauen Hengsten mit Glocken um den Hals und hochgebundenen Schwänzen und Köpfen so schön wie die der Pferde in den Elgin Marbles.
In meinen Skizzen schauten und gingen und trabten sie stets in dieselbe Richtung: nach links oder, auf der Landkarte, westwärts. Monsieur le Major, Madame Seraskier, Médor, die Postkutschen und Kuriere, alle bewegten sich wie auf Verabredung westwärts – alle nach London, wie ich annehme, um nach mir zu sehen, der ich so völlig in sie vernarrt war.
Einige der Jungen mochten meine Skizzen und bewahrten sie auf – einige der älteren sollten meine idealisierten (!) Profile von Madame Seraskier schätzen, mit Wimpern von einem Zoll Länge und Augen, dreimal so groß wie ihr Mund; so verschaffte ich mir eine Zeit lang den Ruf eines Künstlers. Aber das dauerte nicht lange, denn mein Stil war beschränkt; und bald kam ein anderer Junge an die Schule, der mich an Vielseitigkeit und Themenvielfalt übertraf und mit gleicher Leichtigkeit rechts- und linksgewandte Profile zeichnen konnte; er ist jetzt ein berühmter akademischer Maler und scheint sich viel seiner früheren Leichtigkeit erhalten zu haben.[1]
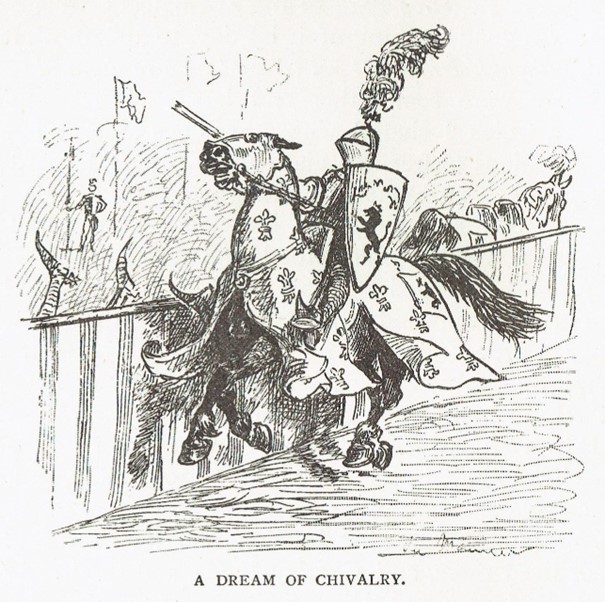
Aufs Ganze gesehen war also meine Schulkarriere weder glücklich noch unglücklich, auch zeichnete ich mich durch nichts sonderlich aus, und (obgleich ich eher gemocht als abgelehnt wurde) schloss ich keine großen und dauerhaften Freundschaften. Auch habe ich mich mit nichts blamiert und hatte meines Wissens keinen einzigen Feind. Außerdem wurde ich mehr als mittelgroß und recht kräftig; ein durchschnittlicherer Junge, als ich es offenbar war (nachdem mein künstlerisches Talent versiegte) hat nie eine Internatsschule besucht. So viel zu meinem äußeren Leben bei Bluefriars.
Aber ich hatte eine innere Welt für mich selbst, deren Hauptstadt war Passy, und ihre Fauna und Flora wurden durch nichts im Regent’s Park und im Tiergarten übertroffen.
Tagsüber tat es gut, daran zu denken, nachts, davon zu träumen, auch wenn ich noch nicht gelernt hatte, zu träumen!
Freilich gab es andere und weniger exklusive Bereiche, die ich mit anderen Jungen in jener vergangenen Zeit teilte. Bereiche der Freiheit und Freude, wo ich das unheilvolle Krachen des Jagdgewehrs vernahm und befreundet war mit Chingachgook und seinem edlen Sohn, dem letzten, o weh, der Mohikaner; wo Robin Hood und Friar Tuck feierten und mit Richard Löwenherz Püffe austauschten unter dem Baum im grünen Wald: wo Quentin Durward, der glückliche Knappe der Damen, mitternachts an ihrer Seite ritt durch die an Galgen und Zigeunern reichen Wälder der Touraine … O, mein Traum von Ritterlichkeit!
Glückliche Zeiten und Zonen! Man muss ein Schuljunge in grauer Kluft im Herzen des nebligen London sein, um dieses Heimweh zu kennen.
Doch auch London hat seine Vorzüge. Hier lebte Sam Weller und Charley Bates und der unwiderstehliche Artful Dodger – und Dick Swiveller, und seine anbetungswürdige Marquise, die sich meine Verehrung teilte mit Rebecca von York und der süßen Diana Vernon.
Es war gut zu jener Zeit ein englischer Junge zu sein und Freunde zu haben wie diese! Aber es war auch gut, ein französischer Junge zu sein: Paris zu kennen und über das wirklich französische Gefühl für die Dinge zu verfügen – und über die Sprache.
In der Tat, zweisprachige Jungen – doppelzüngig von Geburt an (besonders in Englisch und Französisch) – ihr genießt gewisse seltene Vorrechte! Es ist für einen Schuljungen nicht schlecht (ein Schuljunge muss es sein), wenn möglich aus zwei Mutterländern zu stammen und dann und wann in der Süße des Heimwehs zu schwelgen nach dem seiner beiden Mutterländer, in dem er zufällig gerade nicht ist; dann Les trois musquetaires in den Klöstern von Bluefriars zu lesen oder den Ivanhoe in dem trübseligen, staubigen Gefängnishof, der in so manchem französischen lycée als Spielplatz dient.
Ohne darauf zu achten, vernimmt er rund um sich her das fade Alltagsgeschwätz und das Geschrei seiner Mitschüler, der Stimmen, die er so gut kennt – die schrillen Soprane, die brüchigen Baritons und die froschartigen ersten Bässe! Da sind sie, blöken, quaken und gellen; Dick, Tom und Harry – oder Jules, Hector und Alphonse! So ermüdend, banal und alltäglich sie auch sein mögen, diese allzu vertrauten Laute, aber welchen zusätzlichen Zauber verleihen sie jenem so völlig anderen, aber ebenso vertrauten Wortstrom, der durch seine entzückt lesenden Augen leise in sein Bewusstsein dringt! Das genussvolle Empfinden geistiger Exklusivität und Selbstabsonderung verdoppelt sich durch den Kontrast!

Und damit er dieses seltsame Entzücken gut und gründlich fühlt, müssen beide Sprachen Muttersprachen sein, nicht erlernt, wie vollkommen auch immer. Jedes einzelne Wort muss seine Wurzeln in der Tiefe der eigenen Vergangenheit haben, so weit weg, dass sie kaum erinnerlich ist; der lautliche und der Druckaspekt eines jeden muss reich mit Kindheitserinnerungen an zu Hause verknüpft sein; in all den zahllosen, namenlosen, unbezahlbaren Assoziationen, die es süß, frisch, stark und erdhaft machen.
O Porthos, Athos und D’Artagnan – wie liebte ich euch und eure unsterblichen Knappen Planchet, Grimaud, Mousqueton! Wie gut und witzig spracht ihr die Sprache, die ich anbetete, besser sogar als der gute Monsieur Lallemand, der Französischlehrer in Bluefriars, der die unregelmäßigsten Konjunktive handhabte, Lappalien leicht wie Luft.
Dann kam der Graf von Monte-Christo, der mir (nur allzu nachhaltig!) seine furchtbare Lektion von Hass und Rache einprägte; und Les Mystères de Paris, Le Juif Errant, und andere.
Aber kein Wort, gleich in welcher meiner beiden Muttersprachen, kann ausdrücken, was ich fühlte, als zum ersten Mal durch diese meine tränenverschleierten Augen und tief in meine aufgewühlte Seele leise die unvergessliche Geschichte der armen Esmeralda hereingeflossen kam, meiner ersten Liebe! deren grausames Geschick mir im letzten Semester meiner Schulzeit Mitleid, Trauer und Entrüstung einflößte. Das war das wichtigste, das feierlichste und epochalste Ereignis meiner Schulzeit. Ich las es, las es erneut und las es noch einmal. Seither war ich nicht imstande, es wieder zu lesen – es ist ziemlich lang! aber wie gut ich mich daran erinnere, und wie kurz kam es mir damals vor – und wie kurz diese gut verbrachten Stunden!
Dies geheimnisvolle griechische Wort: Ananke! Ich schrieb es auf das Vorsatzblatt aller meiner Bücher. Ich schnitt es in mein Pult. Ich psalmodierte es in den widerhallenden Klöstern! Ich gelobte, eines Tages zur Kathedrale von Notre Dame zu pilgern, dort in jedem Loch und Eckchen nach ihm zu suchen, es mit meinen eigenen Augen zu lesen, mit meinem Zeigefinger zu ertasten.
Und dann dies furchtbare prophetische Lied, das die alte Hexe im dunklen Elendsquartier singt – wie auch das mich heimsuchte! Ich konnte es aus meinem aufgewühlten Bewusstsein für Monate nicht vertreiben:
Grève, aboie, Grève, grouille,
File, file, ma quenouille,
File sa corde au bourreau,
qui siffle dans le préau.
Άνάνκη! Άνάνκη! Άνάνκη!
(Woge, Menge, Menge, woge,
spinne, mein Spinnrocken, spinne!
spinne dem Henker sein Seil,
der auf dem Schulhof pfeift …
Notwendigkeit! Notwendigkeit! Notwendigkeit!)
Ja, es lohnte sich, für einige wenige Jahre ein kleiner französischer Junge gewesen zu sein.
Das empfand ich vor allem während der Ferien, die ich regelmäßig in Bluefriars verbrachte; denn es gab in der Nähe, in Holborn, eine zirkulierende Bibliothek – ein Paradies. Sie wurde von einer entzückenden alten Französin geführt, die auch mal bessere Tage gesehen hatte, die sehr nett zu mir war – und mir nicht alle Bücher auslieh, um die ich bat!
So unwiderstehlich betört von diesen Lichthexern unseres heruntergekommenen Zeitalters, träumte ich einen Großteil meiner Schulzeit einfach hinweg, völlig taub für die älteren Zauberern – Homer, Horaz, Vergil – mit denen mich anzufreunden ich eigentlich auf die Schule geschickt worden war; eine Taubheit, die ich wie andere Dummköpfe bedauern sollte, wenn es zu spät ist.
*****
Und ich träumte nicht nur bei Tag – ich träumte bei Nacht; mein Schlaf war voller Träume – furchtbarer Alpträume, erlesener Visionen, seltsamer Szenen voller unerklärlichen Erinnerungen; alles vage und unzusammenhängend wie alle Menschenträume bisher: Denn ich hatte das richtige Träumen noch nicht erlernt.
Eine unendliche Welt, ein furchtbares und schönes Chaos, ein ständig wechselndes Kaleidoskop des Lebens, zu schattenhaft und trübe, um dem fleißigen Wachbewusstsein irgendeinen dauerhaften Eindruck zu hinterlassen; hier und da prägten sich etwas lebhaftere Bilder von Schrecken und Entzücken ein, an die man sich für einige Stunden mit seltsam kopfschüttelnder Verwunderung erinnerte, wie Coleridge sich an sein abessinisches Mädchen erinnert hatte, das auf dem Hackbrett spielte (eine bezaubernde und sehr originelle Kombination).
Der ganze Kosmos in eines Menschen Kopf – zumindest so viel davon, wie ein Menschenkopf fassen kann; vielleicht ist er sonst nirgends. Und wenn Schlaf den Willen entspannt und keine irdischen Umgebungen die Aufmerksamkeit ablenken – keine Pflicht, kein Schmerz, keine Lust ihn nötigt – dann nimmt die ungezügelte Phantasie das Gebiss zwischen die Zähne, und der ganze Kosmos dreht durch und treibt Willkür mit uns.
Unbeschreibliche, irreale Freuden, unsagbare, irreale Schrecken und Qualen, seltsame Erscheinungen, nur wie durch ein dunkles Glas gesehen, jagen einander ohne Sinn und Verstand, spielen Blindekuh auf dem zwielichtigen Feld und in den dunklen Nischen unseres konfusen und unvollkommenen Bewusstseins.
Und die irrealen Schrecken und Qualen, so unaussprechlich sie sind, sind nicht schlimmer als die wirklichen Schrecken und Qualen, wie sie so oft das Los des Menschen sind, oder ebenso schlimm; aber die unbeschreiblichen, irrealen Freuden übersteigen alles menschenmögliche Glück, solange sie andauern, und das tun sie für eine kleine Weile! Wir erwachen, wir wundern uns und rekonstruieren die dürftige Grundlage, auf der eine so übermenschliche Seligkeit offenbar beruhte. Was geht die Grundlage uns an, wenn nur die Seligkeit da ist und das Hirn die Nerven hat, um sie zu empfinden?
Arme menschliche Natur, so reich sie ausgestattet ist mit Empfindungen der Angst, so glanzvoll organisiert für Schmerz und Leid, so dürftig ausgestattet ist sie für Freude.
Was für Höllen haben wir nicht für das Jenseits erfunden! Zu was für Höllen haben wir oft das Diesseits gemacht, sowohl für uns selbst wie für andre, und das wirklich bei einem sehr kleinen Aufwand an Erfindungskraft, alles was Recht ist!
Vielleicht waren die größten und am tiefsten umnachteten Irren die besten Höllenmacher.
Während das Beste unserer Paradiese nur eine armselig oberflächliche Vorstellung ist, obgleich die Höchsten und Klügsten unter uns ihr Äußerstes gegeben haben, um es zu schmücken, zu verschönen und das Leben dort lebenswert zu gestalten. So unmöglich ist es, etwas zu erfinden oder sich vorzustellen, was jenseits unserer Erfahrungswelt liegt.
Und beweisen diese meine Träume (vielen vertraut) von den irrealen, unaussprechlichen Freuden nicht, dass im menschlichen Hirn verborgene Fähigkeiten, schlummernde Möglichkeiten von Seligkeit existieren, mit denen bisher keiner gerechnet hat, die aber eines Tages vielleicht entwickelt und für Schläfer und Wachende gleichermaßen erreichbar werden?
Ein Gefühl unaussprechlicher Freude, willentlich erreichbar und an Intensität und Dauer einem (sagen wir mal) Anfall von Ischias vergleichbar würde die leidvollen, einseitigen Bedingungen, unter denen wir leben weit mehr als ausgleichen.
*****
Aber eines habe ich als Schuljunge nie geträumt, nämlich dass ich und ein anderer, eine Fackel in der Hand, eines Tages auf Grund gegenseitigem Einvernehmen unser Glück darin finden würden, diese geheimnisvollen Höhlen des Gehirns zu erforschen; und Ordnung begründen würden, wo bisher nur Unordnung herrschte: und aus all diesen irrealen, wüsten und vergänglichen Reichen der Einbildung eine wirkliche, stabile und bewohnbare Welt, die alle, die zu gehen vermögen, auch betreten können.
*****
Schließlich verließ ich die Schule für immer und stattete meinem Onkel Ibbetson in Hopshire einen Besuch ab, wo er sich auf eigenem Grund und Boden ein vornehmes neues Lustschlösschen errichtete, weil ihm das alte, das er ein oder zwei Jahre zuvor geerbt hatte, nicht mehr genügte.
Es war eine uninteressante Küste an der Nordsee, ohne einen Felsen, ohne ein Kliff, einen Hafendamm oder einen Baum, nicht einmal kalte graue Steine, an denen die See sich hätte brechen können, gab es – nichts als Sand! – eine spießige Sorte Meer, ohne Zauber, wenn es friedlich war, und nicht sonderlich schrecklich, wenn es wütete, außer für ein paar verirrte Fischer, die es beschäftigte, aber offenbar nicht sehr üppig belohnte.
Im Binnenland war es so ziemlich dasselbe. Man hielt es immer für grau, bis man genauer hinschaute und sah, dass es grün war. Und dann, wenn man alt und weise war, dachte man nicht länger darüber nach und wandte den Blick nach innen. Darüber hinaus schien es ständig zu regnen.
Aber es waren Land und See, nach Bluefriars und den Klöstern – nach Newgate, St. Bartholomew und Smithfield.
Und man konnte schließlich im Meer angeln und baden, über Land reiten und ein wenig später sogar den Jagdhunden folgen; was ein unvergleichliches Vergnügen gewesen wäre, wäre man nicht mit einem Onkel gesegnet, der dachte, man ritte wie ein französischer Schneider, der einem das auch sagte und einen nachäffte in Gegenwart bezaubernder junger Damen, die perfekt ritten.
In der Tat, es war vergleichsweise das Paradies selbst und wäre es auch noch längere Zeit geblieben, wenn Colonel Ibbetson sich nicht bemüht hätte, einen Gentleman aus mir zu machen – einen englischen Gentleman.
Was ist ein Gentleman? Das ist ein großer alter Begriff. Aber was bedeutet er?
Einerseits gesteht man einem Mann, von dem man sagt, dass er ein Gentleman ist, den höchsten Titel der Anerkennung zu, den wir kennen; selbst wenn es sich um einen Fürsten handelt.
Andererseits stigmatisieren wir einen Mann, von dem wir sagen, dass er kein Gentleman ist, fast als sozialen Paria, ungeeignet für die Gesellschaft von seinesgleichen, auch wenn nur ein Kurzwarenhändler über den anderen spricht.
Wer ist ein Gentleman, wer jedoch ist es nicht?
Der Prince of Darkness war einer, und ebenfalls Mr. John Halifax, wenn wir denjenigen Glauben schenken wollen, die sie am besten kannten; und das gilt auch für einen „Pelham“ nach dem jüngst verstorbenen Edward Bulwer, Earl von Lytton usw.; und er sollte es wohl gewusst haben.
Und ich sollte ein weiterer sein, wenn es nach Roger Ibbetson, Esquire, ging, früherem Colonel der –, und auch er sollte es gewusst haben! Er hatte das Wort ständig auf der Zunge (wenn er mit mir sprach), gerade als ob er nicht Beauftragter ihrer Majestät, sondern ein Friseurgeselle wäre, der gerade an ein unabhängiges Vermögen gelangt ist.
Diese Ausbildung begann erfreulich genug schon bevor ich London verließ, indem er mich zu seinen Schneidern schickte, die mir einige schöne Anzüge anfertigten: speziell einen Abendanzug, der mir mein Leben lang gedient hat, leider; und nach der Uniform der grauen Schulkutten waren diese Anzüge wie eine Einweihung in die Herrlichkeiten von Freiheit und Mannestum.
Colonel Ibbetson – oder Onkel Ibbetson, wie ich ihn zu nennen pflegte – war der erste Cousin meiner Mutter; meine Großmutter, Mrs Biddulph, war die Schwester seines Vaters, des früheren Archidiakons Ibbetson, eines sehr frommen, gelehrten und beispielhaften Gottesmannes aus guter Familie.
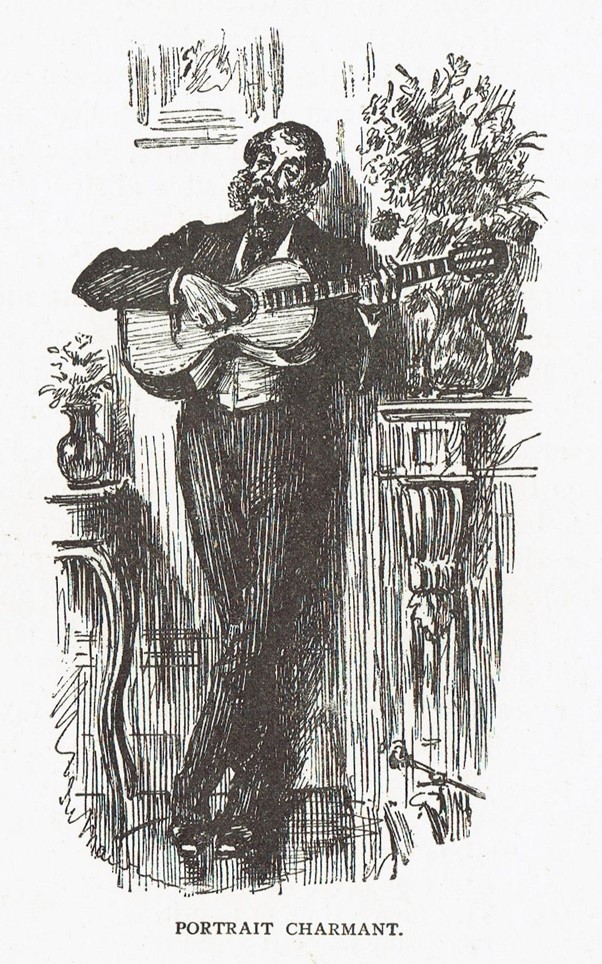
Aber seine Mutter (die zweite Frau des Archidiakons) war einziges Kind und Erbin eines immens reichen Pfandleihers namens Mendoza, eines portugiesischen Juden mit, nebenbei, einem Spritzer farbigen Blutes in seinen Adern, so hieß es jedenfalls; und tatsächlich zeigte sich diese entfernte afrikanische Belastung noch an Onkel Ibbetsons dicken Lippen, den weit offenen Nüstern und großen schwarzen Augen mit gelblichem Weiß, besonders aber in seinen langen, gespreizten, spitzhackigen Füßen, die sowohl ihm selbst als auch den besten Schuhmachern von London viele Probleme machten.
Andererseits, und trotz seines hässlichen Gesichts fehlte ihm keineswegs ein gewisses soldatisch-vornehmes Auftreten, zumal er groß und stattlich gebaut war. Er trug Korsett und eine ausgezeichnete Perücke, denn er war vorzeitig kahl; und setzte den Hut schief auf die Seite, was ihn (in meinen unerfahrenen Augen) eher aussehen ließ wie einen Stutzer und nicht ganz wie einen Gentleman.
Den Hut schrägfesch über einem Auge tragen und doch „wie ein Gentleman aussehen“!
Es kann gelingen, habe ich gehört; ist gelungen und gelingt noch! Es ist vielleicht nicht gerade ein vornehmer Effekt – aber so wie er ist, benötigt er eine irgendwie seltene Kombination von sozialen und physischen Eigenschaften des Hutträgers; und weder semitisches noch afrikanisches Blut dürfte dazu gehören.
Colonel Ibbetson konnte alles ein bisschen – zeichnen (besonders ein Dampfboot auf ruhiger See, mit schönem dickem Rauch, der sich im Wasser spiegelt), Gitarre spielen, Chansons und Kanzonen singen, Verse zu gesellschaftlichen Anlässen schreiben, de Musset zitieren …
„Avez vous vue dans Barcelone
Une Andalouse au sein bruni?“
Er pflegte Französisch zu sprechen, wann immer sich eine Gelegenheit dafür bot, auch mit einem englischen Stallknecht, sich dann aber plötzlich zu besinnen und für seine Gedankenlosigkeit zu entschuldigen; und selbst wenn er Englisch sprach, schmückte er es mit billigen französischen Etikettchen und Redensarten: „Pour tout potage“; „nous avons changé tout cela“; „que diable allait-il faire dans cette galère?“ usw. Oder Italienisch: „Qui lo sa?“ „Pazienza!“ „Ahimè!“ Oder sogar Lateinisch: „Eheu fugaces,“ und „Vidi tantum!“, denn er hatte in Eton studiert. Es muss sehr einfaches Latein gewesen sein, denn ich konnte es immer verstehen! Deutsch und Griechisch mied er; glücklicher Weise, denn das tue ich auch. Er war Junggeselle, aus seinem Privatleben will ich mich heraushalten; aber sein Haus versprach mehr, als es hielt.
Sein Architekt, Mr. Lintot, ein außerordentlich kleiner Mann, genial und Autodidakt, wurde mein Freund und lehrte mich rauchen und Gin mit Wasser trinken.
Er machte seine Arbeit gut; aber abends pflegte er mehr zu trinken, als gut für ihn war, und von Shelley zu schwärmen, seinem einzigen Dichter. Er rezitierte dann „Die Lerche“ (sein einziges Gedicht) mit H’s mal an falscher Stelle stumm, mal an falscher Stelle gesprochen, und einem deutlichen Cockney-Akzent:
“’ail to thee, blithe Sperrit!
Bird thou never wert,
That from ‘eaven, or near it,
Po’rest thy full ‘eart
In profuse strains of hunpremeditated hart.
[Hail to thee, blithe Spirit!
Bird thou never wert,
That from Heaven, or near it,
Pourest thy full heart
In profuse strains of unpremeditated art.]
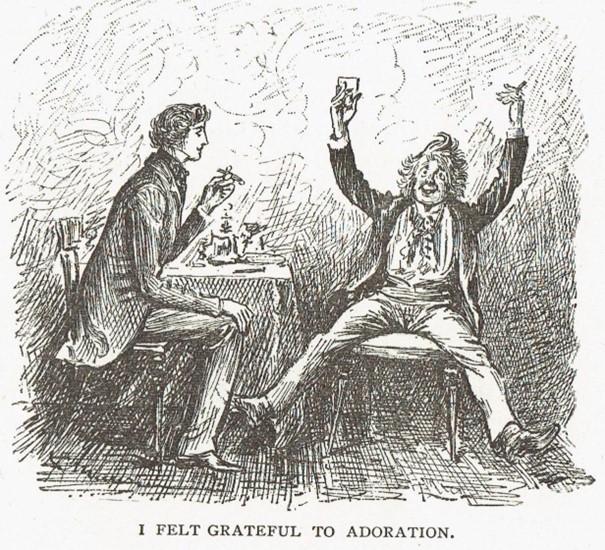
Wenn der Abend voranschritt, wurde sein Vortrag „leicht komisch” und immer bewundernswerter in Akzent und Humor. Er konnte alle Schauspieler von London (von denen ich keinen einzigen je gesehen hatte) so perfekt nachahmen, dass ich vor Entzücken und Erstaunen hingerissen war; und das nur mit mir als Publikum, während wir rauchend und trinkend beisammen saßen in seinem Zimmer in „Ibbetson’s Arms“.
Ich war dankbar, betete ihn an.
Später würde er wieder sentimental werden; würde sich über die Freuden seines Ehelebens verbreiten, über die außerordentliche Intelligenz und Schönheit von Mrs. Lintot. Zuerst würde er mir die Schönheiten ihres Geistes beschreiben, sie mit „L.E.L.“ und Felicia Hemans vergleichen. Dann würde er auf ihre physischen Vorzüge eingehen; es gab keine Frau, die es wert gewesen wäre, mit ihr in dieser Hinsicht verglichen zu werden – aber ich lasse den Vorhang fallen.
Er war sehr geltungsbedürftig. Was immer er tat, was immer er mochte, was immer ihm gehörte, war besser als alles andere in der Welt; und er war klüger als alle anderen, mit Ausnahme von Mrs. Lintot, der er die Palme reichte; dann würde er sich aufheitern und wieder lustig werden.
Seine Selbstzufriedenheit war in der Tat ungewöhnlich; und was noch ungewöhnlicher war: Sie war in keiner Weise aggressiv – zumindest mir gegenüber nicht; vielleicht weil er ein so winzig kleiner Mann war; oder weil viel seiner Eitelkeit keinen sehr soliden Grund hatte, denn auf die Gaben, die ich am meisten ihm bewunderte, bildete er sich am wenigsten ein; oder weil das meiste nur zum Vorschein kam, wenn er recht beschwipst war, und geniale Beschwipstheit rechtfertigt so manches; oder vielleicht auch, weil er auf Dinge am eingebildetsten war, auf die ich mir nie was hätte einbilden können; und die unverzeihlichste Eitelkeit bei anderen ist die, die insgeheim auch unsere eigene ist, ob es uns bewusst ist oder nicht.
Und dann war er der erste lustige Mann, den ich je getroffen habe. Was ist das für eine Gabe! Wann immer er lustig zu sein versuchte, war er es, gleich ob man mit ihm oder über ihn lachte, und dafür liebte ich ihn. Nichts auf Erden ist ja bedauerlicher und trauriger als ein Witzbold, der es immer noch sein möchte, aber nicht mehr ist.
Wenn Lintots komische Ader erschöpft war, dann war er so klug, aufzuhören, und fing an zu weinen, was auch wieder lustig war, und dann würde er aus seinen Kleidern ins Bett springen und in Sekunden eingeschlafen sein, während die Tränen noch von seiner kleinen Nase tropften – und sogar das war lustig!
Aber am nächsten Morgen war er ernst, geistesgegenwärtig und unermüdlich, als ob Gin, Poesie und Eheleben nie gewesen und Spaß ein Schwerverbrechen wäre.
Onkel Ibbetson achtete ihn sehr als Architekten, aber sonst nicht; er benutzte ihn einfach.
„Er ist natürlich ein schrecklicher kleiner Snob, und hat kein einziges richtiges H im Kopf (als ob das ein Kapitalverbrechen wäre); Aber er ist gut – schau dir den Campanile an – und dann: Er ist billig, mein Junge, billig.“
Es gab einige schöne Häuser in schönen Parks nicht weit von Ibbetson Hall; aber obgleich Onkel Ibbetson an Namen, Vermögen und gesellschaftlichem Rang ihren Besitzern durchaus gleichkam, stand er doch mit keinem von ihnen auf vertrautem Fuß, ja, soviel ich weiß, war er mit ihnen nicht einmal bekannt und sprach von ihnen mit Verachtung, als von Barbaren, mit denen ihn nichts verband. Vielleicht hatten sie diese Unverträglichkeit auch herausgefunden, insbesondere die Damen; denn Schuljunge der ich war, brauchte ich doch nicht lange, um zu entdecken, dass sein Verhalten dem anderen Geschlecht gegenüber nicht immer das war, das den Frauen, ihren Ehemännern, Vätern oder Brüdern gefiel. Die Art, wie er sie ansah, genügte. In der Tat hatten sein Leben lang die meisten seiner Freundinnen und Bekanntschaften dem corps de ballet, dem demi-monde usw. angehört, nicht, wie ich mir vorstellen konnte, die beste Schule der Welt für gute Sitten.
Andererseits war er gut befreundet mit einigen Familien in der Stadt; der des Arztes, des Rektors, seines eigenen Agenten (ein heruntergekommener Offizierskamerad und Busenfreund, der aufgehört hatte ihn zu lieben, seit er von ihm bezahlt wurde). Und er pflegte Mr. Lintot und mich auf Gesellschaften dort mitzunehmen, und er war der Mittelpunkt dieser Gesellschaften.
Er sang französische Liedchen, er hatte keine Stimme, aber gute französische Aussprache, und erzählte Anekdötchen ohne besondere Pointe, aber auf Französisch oder Italienisch (so dass niemand die Pointe vermisste); und wir alle lachten und bewunderten ihn, ohne so recht zu wissen, warum, außer, dass er der Besitzer des Herrenhauses war.
Bei diesen festlichen Anlässen schien Lintots Selbstvertrauen und Fähigkeit, zu belustigen, ihn völlig verlassen zu haben, er saß verdrießlich in einer Ecke.
Obgleich er ein Radikaler, ein Skeptiker und Pazifist war, beeindruckte der gesellschaftliche Rang von Armee und Kirche ihn doch stark.
Von dem Arzt, einem sehr klugen und kultivierten, dem am besten ausgebildeten Mann weit und breit, hielt er wenig; aber der Rektor, der Colonel, der arme Captain, der jetzt ja nur noch eine Art Landratten-Steward war, erfüllten ihn mit respektvoller Andacht. Und für all seine Leiden wurde er von Mrs. Captain und Mrs. Rector und ihren schlichten Töchtern grausam brüskiert, die kaum errieten, welche Talente in ihm steckten und ihn einfach für einen kleinen Mann hielten, der es kaum schaffte, ihnen die Seiten ihrer Noten umzublättern.
Es wurde bald offensichtlich, dass Ibbetson sehr in eine Mrs. Deane verliebt war, die Witwe eines Brauers, eine wirklich sehr gutaussehende Frau, was sie nicht weniger wusste als ich und jedermann sonst außer Mr. Lintot, der sagte: „Puh, Sie sollten meine Frau sehen!“
Ihre Mutter, Mrs. Glyn, übertraf uns alle in ihrer Bewunderung für Colonel Ibbetson.
Wenn Mrs. Deane zum Beispiel einen kleinen Walzer jener wohlfeilen Sorte spielte, an den sich keiner erinnert, den aber auch keiner vergisst, rief Mrs. Glyn aus: „Ist er nicht entzückend?“
Wenn Ibbetson dann sagte: „Bezaubernd! Bezaubernd! Von wem ist er? Rossini? Mozart?“
„Aber nein, lieber Colonel! Erinnern Sie sich nicht? Es ist Ihr eigener!“
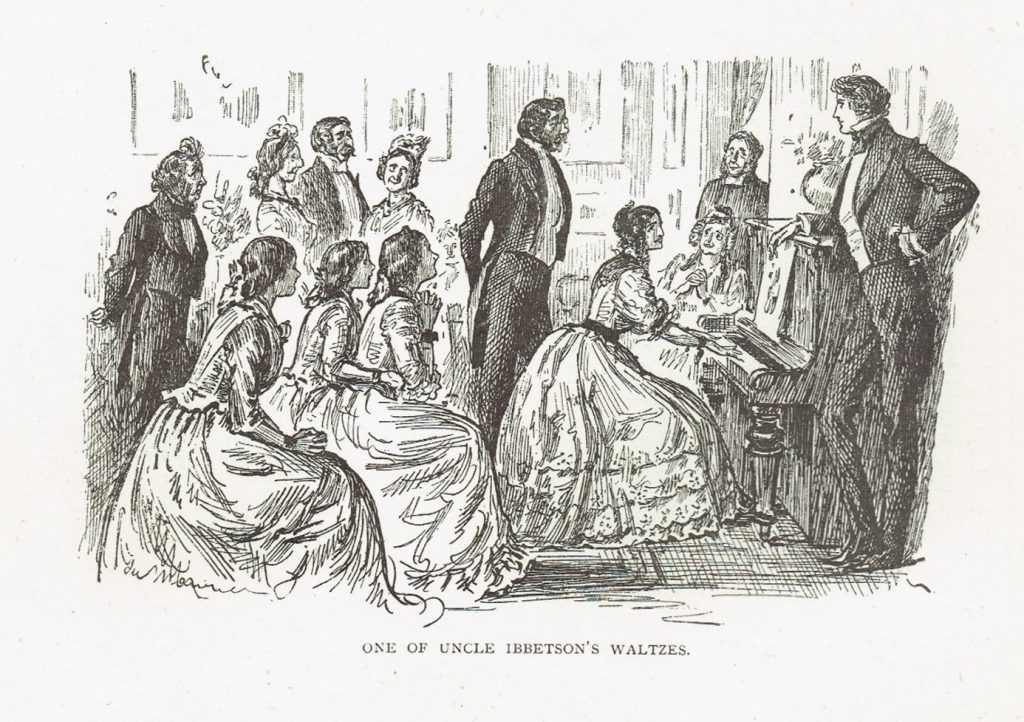
„Ach, so ist das! Ich hatte ihn völlig vergessen.“ Und allgemeines Gelächter und Beifall brachen aus ob eines so natürlichen Fehlers auf Seiten unseres großen Mannes.
Gut, ich konnte weder Klavier spielen noch singen und fand es bei diesen Gelegenheiten auch viel einfacher, Englisch als Französisch zu sprechen, insbesondere zu Engländern, die außer ihrer eigenen keine andere Sprache sprachen. Trotzdem war Colonel Ibbetson manchmal recht stolz auf mich.
„Deux mètres, bien sonnés!“, pflegte er auf meine Statur anzuspielen, „et le profil d’Antinoüs“, was er mit dem Trema auf dem U aussprach.
Und später, wenn ihm der Abend gefallen hatte, wenn er alles gesungen hatte, was er konnte, wenn Mrs. Deane zärtlicher und hingabewilliger gewesen war als normalerweise, wenn ich mich, sobald ihre Mutter Klavier spielte, durch sorgsames Umblättern der Noten ausgezeichnet hatte, dann pflegte er mir auf dem gemeinsamen Heimweg zu sagen, dass ich seinem Namen Ehre machte und dass ich in der Welt eine gute Figur abgeben würde, wenn ich mich selbst erst décrassé hätte; dass ich einen weiteren Anzug von seinem Schneider brauchte, mit nur einen Achtelzoll längeren Schößen; dass ich eine Empfehlung für sein altes Regiment (die Eleventeenth Royal Bounders) haben sollte, ein verteufeltes Kavallerie-Eliteregiment, die Welt sehen und ein paar Herzen brechen (nicht ohne Grund haben unsere Freunde hübsche Frauen und Schwestern); und schließlich die schöne junge Erbin eines Titels heiraten und ihm ein Zuhause anbieten, wenn er ein armer einsamer alter Kerl wäre. Er wäre mit wenig zufrieden: Eine Kruste Brot, ein Glas Wein und Wasser, eine saubere Serviette, ein paar Räume, ein altes Klavier und ein paar Bücher. Denn Ibbetson Hall würde natürlich mir gehören – wie auch jeder Groschen, den er irgendwo besäße.
All das in vertraulichem Französisch – damit die Wolken uns nicht zuhörten – und mit dem familiären Du und Dir der Blutsverwandten, das ich nur ungern erwiderte.
Es verriet keine sonderlich seriösen Absichten bezüglich Mrs Deane und würde ihrer Mutter kaum gefallen haben.
War ihm aber eine Laus über die Leber gelaufen, hatte Mrs Deane empörender Weise mit jemand anderem geflirtet, war er nicht gebeten worden zu singen (oder hatte jemand anderes es getan), dann würde er mir in gefeiltem Englisch versichern, ich sei der höllischste Tölpel, der je einen Salon verunziert oder einem Mann die Haare vom Kopf gefressen habe, und dass ich ihn krank machte und er sich meiner schäme. „Warum kannst du nicht singen, du verdammter welscher Milchbart? Dein Vater, dieser verdammte Rouladenhändler, wenn er nichts konnte, zur Hölle mit ihm! fix genug singen konnte er. Warum sprichst du kein Französisch, du infernalischer Britenteufel? Warum kannst du nicht Tee und Kuchen anbieten, zum Satan mit dir! Zweimal hat Mrs Glyn ihr Taschentuch fallen lassen, warum musste sie es selber aufheben? Was, ‚am anderen Ende des Salons‘ warst du? Warum bist du nicht quer durch den Salon gesprungen, hast es aufgehoben und ihr mit ein paar hübschen Worten wie ein echter Gentleman überreicht? Als ich in deinem Alter war, war ich immer auf dem Sprung: Wo ließ eine Lady ihr Taschentuch fallen – oder ihren Fächer? Ich habe nichts ausgelassen!“
Dann nahm er mich mit zum Schießen (denn es war für ihn ganz wesentlich: Ein englischer Gentleman sollte ein Sportsmann sein) – eine schreckliche Prüfung für uns beide.
Eine Schnepfe, die ich in keiner Weise zu töten gedachte, würde manchmal auffliegen und rechts und links wie der Blitz an mir vorbei – und ich würde sie verfehlen – immer; und er würde mich verfluchen als den Sohn eines verdammten französischen Micawber, würde das nächste ebenfalls verfehlen, wütend werden, seinen Hund verprügeln, eine Pointerhündin, die ich sehr gern hatte. Einmal verdrosch er sie so grausam, dass ich rot sah und beinahe dem Impuls nachgab, meine beiden Gewehrläufe in seinen breiten Rücken zu entleeren. Hätte ich es getan, es wäre als bloßer Jagdunfall durchgegangen und hätte mir viele künftige Schwierigkeiten erspart.
*****
Eines Tages zeigte er mir einen kleinen Vogel, der auf dem Feld pickte – einen besonders hübschen Vogel, ich glaube, es war eine Feldlerche – und flüsterte mir in seinem sehr sarkastischen Ton zu:
„Schau da, du Peter ohne Salz, glaubst du, wenn du dich hinknietest und dein Gewehr bequem und lautlos auf dies Gatter legtest und sorgfältig zieltest, du könntest den Vogel treffen, bevor er auffliegt? Ich hörte von einigen Franzosen, die das könnten!“
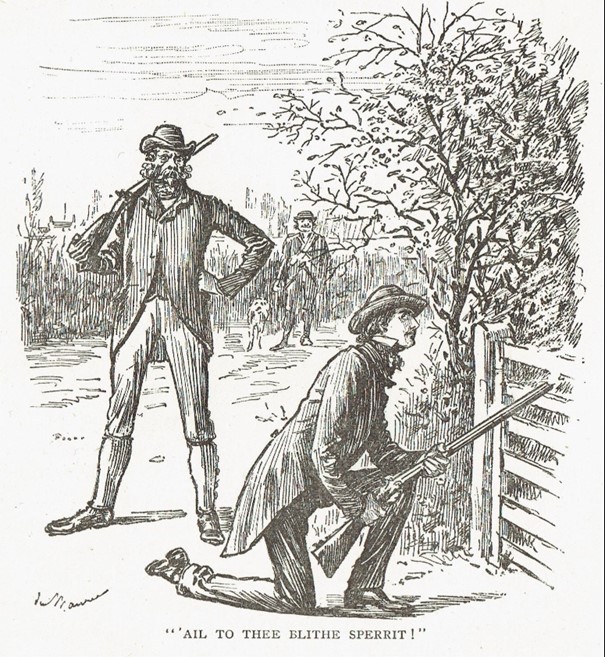
Ich sagte, ich würde es versuchen, legte mein Gewehr auf, wie er gesagt hatte, zielte sorgfältig ein paar Yard über den Kopf des Vogels, rief innerlich
“’ail to thee, blithe Sperrit!”
Und feuerte beide Läufe ab (aus Angst vor einem Missgeschick Ibbetsons), und der Vogel flog natürlich weg.
Danach nahm er mich nie wieder zum Schießen mit hinaus; und wirklich, ich hatte zu meinem Missbehagen entdeckt, dass ich, der Freund, Bewunderer und Nacheiferer des Wildtöters Natty Bumppo, der Vertraute des Letzten Mohikaners und seines skalpierenden Vaters, den Anblick von Blut nicht ertragen konnte, und am allerwenigsten den von Blut, das ich selbst und zu meinem bloßen Vergnügen vergossen hatte.
Das einzige Tier, das bei jenen Schießübungen mit Onkel Ibbetson meiner Waffe je zum Opfer fiel, und das mehr durch Zufall als absichtlich, was ich Onkel Ibbetson aber verschwieg, war ein junges Kaninchen.
Als ich es vom Boden aufhob und seine arme, warme, kleine und schmale Brust und die letzten Herzschläge unter den weichen Rippen spürte und das Blut auf seinem Fell sah, war ich von Mitleid, Scham und Reue wie zerschmettert; und ich machte mit mir selbst aus, dass ich einen anderen Weg finden wollte, ein englischer Gentleman zu werden, als den, zu dem es gehörte, Wildtiere zu töten, deren Leben so lebenswert erschien.
Ich muss sie wohl essen, aber ich will sie nicht mehr schießen; wenigstens meine Hände sollen hinfort nicht mehr mit Blut befleckt sein.
Ach, Ironie des Schicksals!
Das Ergebnis von all dem war, dass er Mrs Deane die Aufgabe übertrug, seinen Tolpatsch von Neffen auf Zack zu bringen. Sie nahm mich mit besten Absichten an die Hand, begann damit, dass sie mir das Tanzen beibrachte, damit ich beim bevorstehenden Jagdball mit ihr tanzen konnte; und das tat ich zu meiner grenzenlosen Freude die ganze Nacht hindurch, zur Empörung von Colonel Ibbetson, der sehr viel besser tanzen konnte als ich, zur Empörung auch von vielen hübschen Männern in Rot und in Schwarz, denn sie galt als die Schöne des Abends.

Natürlich verliebte ich mich in sie – oder glaubte zumindest, dass ich es täte. Zum großen Ärger ihrer Mutter ermutigte sie mich nach Kräften, zum Teil zu ihrem Spaß, zum Teil, um Colonel Ibbetson zu ärgern, den sie offenbar zu hassen begonnen hatte. Und wirklich, schon von der ganzen Art her, in der er zu mir von ihr sprach (dieser Erzieher englischer Gentlemen) verdiente er, dass sie ihn hasste. Er hatte nie auch nur im Geringstens die Absicht, sie zu ehelichen – das ist gewiss; und trotzdem hatte er sie zum Stadtgespräch gemacht.
Und hier muss ich klarstellen, dass Ibbetson einer jener einzigartigen Männer war, die ihr Leben lang von dem Wahn heimgesucht werden, sie seien für Frauen völlig unwiderstehlich.
Er wurde es nie müde, hinter ihnen her zu sein – nicht aus Liebe zur Galanterie um ihrer selbst willen, wie ich glaube, sondern einzig und allein getrieben von dem Wunsch, in den Augen der anderen als Don Juan zu erscheinen. Nichts machte ihn glücklicher, als in irgendeiner Ecke gesehen zu werden, wie er mit der hübschesten Frau des Salons geheimnisvoll wisperte. Er schien nicht zu erkennen, dass auf eine Frau, die albern, eitel oder vulgär genug war um sich von seiner idiotischen Courschneiderei geschmeichelt zu fühlen, Dutzende kamen, die seinen bloßen Anblick verabscheuten und das deutlich genug zeigten.
Diese Eitelkeit war mit den Jahren angewachsen und hatte eine sehr gefährliche Form angenommen. Er wurde indiskret, und schlimmer noch, er verbreitete Lügen! Nicht einmal die Toten, die geehrten und untadligen Toten, waren sicher in ihren Särgen. Das war seine Rache für unvergessene Kränkungen.
Wer küsst und darüber redet, und wer darüber redet, auch wenn er gar nicht geküsst hat, was lässt sich über ihn sagen, wie soll man ihn behandeln?
Ibbetson büßte seinen elenden Wahn eines Tages mit seinem Leben – und der Mann, der es ihm wirklich mehr durch Zufall als mit Vorsatz nahm, hat bisher in seinem Herzen weder Gewissensbisse noch Reue empfunden.
*****
So war zwischen Ibbetson und mir großer Aufruhr. Er verdammte, verfluchte und missbrauchte mich wie schon vorher meinen Vater in jeder Weise, und schließlich schlug er mich; und ich hatte genügend Selbstkontrolle um nicht zurückzuschlagen, aber ich verließ ihn dann und dort mit so viel Würde, wie ich aufbringen konnte.
So erfolglos endete meine kurze Erfahrung mit englischem Landleben – ein bisschen Jagen, ein bisschen Schießen und Fischen, ein bisschen Tanzen und Flirten; gerade genug von allem, um mir zu zeigen, dass ich für alles untauglich war.
Eine bittersüße Erinnerung, voller Demütigungen, aber insgesamt nicht ohne Zauber. Es gab die Schönheit des Meeres, des offenen Himmels und des wechselnden Landwetters; die Schönheit von Mrs Deane, die mich zum Narren machte, um sich an Colonel Ibbetson dafür zu rächen, dass er versuchte, sie zur Närrin zu machen, wodurch er für die Nachbarschaft für wenigstens neun Tage zum Gegenstand des Gelächters wurde.
Und ich rächte mich an beiden – heldenhaft, wie ich glaubte – obgleich die Verteilung von Heldentum und Rache nicht ganz klar erscheint.
Denn ich haute ab nach London und ließ mich von der Garde-Kavallerie ihrer Majestät anwerben, wo ich für zwölf Monate blieb, mich wohl fühlte und viel mehr Gutes als Schlechtes erfuhr.
*****
Dann wurde ich ausgezahlt und an Mr. Lintot weitergereicht, den Architekten und Bauführer: Eine Versammlung meiner Verwandten bewilligte mir für drei Jahre 90 Pfund jährlich, dann sollte ich meine Schulden an alle zurückzahlen.[2]
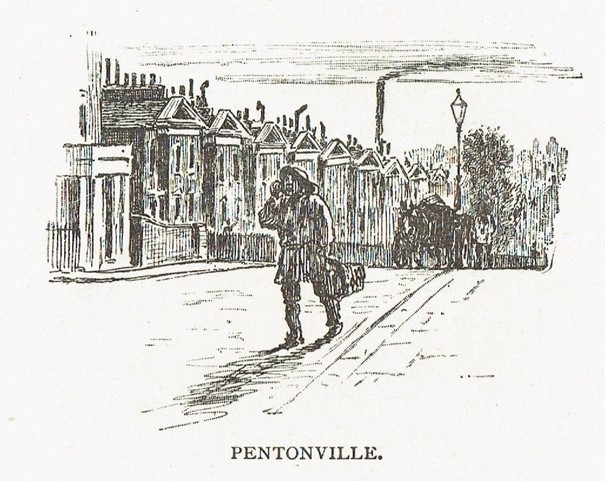
*****
So nahm ich mir eine kleine Wohnung in Pentonville, um in der Nähe von Mr. Lintot zu sein, und arbeitete drei Jahre lang hart in meinem neuen Beruf. In dieser Zeit geschah nichts von Bedeutung in meinem äußeren Leben. Anschließend beschäftigte Mr. Lintot mich als Angestellten auf Gehaltsbasis, und ich glaube, er hatte keinerlei Grund, sich über mich zu beklagen – und er beklagte sich auch nicht. Ich war mein Gehalt wert – und etwas darüber hinaus – was ich aber nie bekam und worum ich nie bat.
Noch beklage ich mich über ihn; denn trotz all seiner kleinen Marotten, seiner Eitelkeit, seiner Reizbarkeit und einer gewissen Knauserigkeit, war er ein guter und sehr kluger Bursche.
Seine angeblich so tolle Frau war in keiner Weise die schöne Person, die er aus ihr gemacht hatte, und niemand außer ihm hielt sie dafür.
Sie war etwas älter als er, sehr groß und massig, mit ernsten, aber nicht unregelmäßigen Zügen und einer sehr hohen Stirn; sie hatte eine leichte Neigung zur Kahlheit, trug das farblose Haar streng gelockt auf beiden Seiten ihres Gesichts und einen bedrohlichen kleinen Dutt an ihrem Hinterkopf. Sie war Unitarierin und Gouvernante gewesen, mochte lange Wörter wie Samuel Johnson, und war sehr kritisch. Die gelegentlichen Verfehlungen ihres Mannes in Sachen Grammtik und Aussprache müssen sie sehr belastet haben!
Sie hatte ihre eigene Meinung über alles unter der Sonne, erwartete, dass andere sie kannten und sie teilten. Doch war sie nicht stolz; sie war ein Drache der Bescheidenheit und hatte verletzte Sanftmut in den Rang einer militanten Tugend erhoben. Und sie wusste sehr gut, wie sie in ihrem eigenen Haus den Ton anzugeben hatte.
Bei all dem war sie eine ausgezeichnete Gattin für Mr. Lintot und eine hingebungsvolle Mutter für seine Kinder, die schlicht und leise waren (und ihren Vater anbeteten); so dass Lintot, der Venus, Diana und Minerva zugleich in ihr sah, der glücklichste Mann in Pentonville war.
Im Ganzen war sie mir gegenüber immer freundlich und fürsorglich, und ich gab immer mein Bestes, ihr zu gefallen.
Darüber hinaus schenkte sie mir ein altes Tafelklavier (ein Geschenk, für das ich ihr niemals dankbar genug sein kann). Es hatte ihrer Mutter gehört und ihr im Schulzimmer gedient, bis Lintot ihr ein neues schenkte (denn sie war eine hochkultivierte Musikerin des strengsten, klassischen Typs). Es wurde das wichtigste Schmuckstück meines kleinen Wohnzimmers, das es beinahe ausfüllte, auf ihm versuchte ich nach Noten spielen zu lernen und spielte mit einem Finger die alten, geliebten Melodien, die mein Vater zu singen und meine Mutter auf der Harfe zu spielen pflegte.
Selbst zu singen kam für mich anscheinend nicht in Frage; meine Stimme (die, wie ich glaube, nicht allzu unangenehm war, wenn ich mich damit zufrieden gab, nur zu sprechen) ähnelte der eines Ochsenfroschs unter einer Wolldecke, wann immer ich mich in Gestalt eines Liedes ausdrücken wollte; mein Kehlkopf weigerte sich, die Noten zu produzieren, die ich so genau im Gedächtnis hatte, und das Ergebnis war desaströs.
Andererseits konnte ich in meiner Vorstellung sehr schön singen. Einmal an einem regnerischen Tag in einem Islington Omnibus sang ich innerlich „Adelaida“ mit der Stimme von Mr. Sims Reeves – und nahm mir damit eine unverzeihliche Freiheit heraus; und obgleich ich es nicht sagen sollte, ich sang es noch besser als er, denn mir kamen die Tränen dabei, so sehr, dass ein freundlicher alter Herr, der mir gegenüber saß, sehr viel Mitgefühl für mich zu haben schien.
Ich konnte mich auch an jede Melodie erinnern, die ich je gehört hatte und konnte sie auch später noch völlig zutreffend pfeifen – sogar einen von Onkel Ibbetsons Walzern!
Erinnerungswert hierfür ist folgendes Beispiel: Eines Nachts fand ich mich in der Guildford Street und ging in derselben Richtung wie ein anderer Verspäteter (nur auf der anderen Seite der Straße), und der sah sich, als der Mond aus den Wolken kam, veranlasst zu pfeifen.
Er pfiff hervorragend, und, was noch wichtiger war, er pfiff die wohl schönste Melodie, die ich je gehört hatte. Ich fühlte all ihre Wechsel und Modulationen, ihr Dur und ihr Moll, gerade als ob ein ganzes Orchester die Begleitung spielte, ein so gewandter Pfeifer war er.
Und so bezaubert war ich, dass ich beschloss, hinüber zu gehen und ihn zu fragen, was er pfiff: „Melodie oder Leben!“ Aber er blieb plötzlich vor Nr. 48 stehen, öffnete mit seinem Schlüssel, bevor ich meine bescheidene Anfrage loswerden konnte.
Nun, ich pfiff diese Melodie den ganzen nächsten Tag, und noch viele Tage länger, ohne herauszufinden, was es war; bis ich eines Abends zufällig bei den Lintots war. Ich fragte Frau Lintot, die zufällig gerade am Klavier saß, ob sie die Melodie kenne und begann erneut, sie zu pfeifen. Zu meinem überraschten Entzücken begleitete sie mich schnurstracks von Anfang bis Ende – (eine reizende Herablassung, sie war eine so strenge Puristin), und ich pfiff keine einzige falsche Note.
„Ja,“ sagte Mrs. Lintot, „es ist eine hübsche, eingängige kleine Melodie – von der Art, die sofort populär wird.“
Ich entschuldige mich höflichst beim Leser für diese Abschweifung; aber er wird mir vergeben, wenn er musikalisch ist, denn diese Melodie war die „Serenade“ von Schubert, und ich hatte noch nicht einmal Schuberts Namen gehört!
Und da ich mich nun pflichtgemäß entschuldigt habe, will ich es wagen, erneut zu sündigen und abzuschweifen und hier eine Art von Melomanie erwähnen, eine spezielle Obession, deren Opfer ich bin und die ich unbewusste musikalische Hirntätigkeit nennen will.
Immer habe ich irgendeine Melodie in meinem Kopf, aber wirklich immer; mir ist das oft gar nicht bewusst; das Leben würde mir unerträglich, wenn ich es wäre. Welcher Teil meines Bewusstsein sie singt, besser: In welchem Teil meines Bewusstseins sie sich selbst singt, kann ich nicht sagen – wahrscheinlich in irgendeiner nutzlosen Ecke voller Spinnweben und Gerümpel, das zu nichts zu gebrauchen ist.
Aber es hört nie auf; jetzt ist es eine, dann eine andere Melodie, jetzt ein Lied ohne, dann eins mit Wörtern; manchmal es sie sozusagen dicht unter der Oberfläche, und ich bin mir dessen nur vage bewusst, während ich lese oder arbeite oder rede oder nachdenke; manchmal muss ich, um mich zu vergewissern, dass es da ist, tief in mich hinabtauchen, und immer finde ich es nach einer Weile und bringe es nach oben. Es ist wie der „Karneval von Venedig“; dann lasse ich es wieder hinabsinken, und ein anderes tritt an seine Stelle, ohne dass ich es merke; so dass, wenn ich erneut in den „Karneval von Venedig“ hinabtauche, „Il mio tesoro“ oder die „Marseillaise“ oder „Pretty Little Polly Perkins of Paddington Green“ daraus geworden ist. Und der Himmel allein weiß, welche Melodien, ungehört und unbemerkt, diese innere Drehorgel inzwischen spielt.
Manchmal drängt sie sich so beharrlich auf, dass sie lästig wird, und die einzige Methode, um sie los zu werden, besteht darin, dass ich selbst singe oder zu pfeife. Z.B. kann ich zu meiner Beruhigung und Freude innerlich irgendein sehr liebes Gedicht wie „The Waterfowl“ oder „Tears, Idle Tears“ oder „Break, Break, Break“ aufsagen, und die ganze Zeit wird dieser Unhold von einem unbewussten Sänger zwischen den Zeilen wie ein Wandermusiker auf einem entfernten Platz darauf bestehen, „Cheer, Boys, Cheer“ oder „Tommy make room for your uncle“ (Melodien, die ich nicht behalten kann) zu singen – mit Text, Begleitung und allem, nicht ganz so akzentfrei, wie ich es mir wünschen würde; so dass ich mit meiner inneren Rezitation aufhören und „J’ai du bon tabac“ pfeifen muss, um es zu bannen.
Aber zugunsten dieser meiner schwachen und nie stillen inneren Stimme kann ich sagen: Ihre Intonation ist immer perfekt, hält den Rhythmus völlig richtig, und ihre Qualität, obgleich ziemlich dünn und irgendwie nasal und ganz besonders, ist nicht unsympathisch.
Manchmal (wie in jenem Bus nach Islington) kann ich sie zwingen, à s’y méprendre, den Ton eines Sängers nachzuahmen, den ich kürzlich hörte, und so für mich selbst eine Geistermusik inszenieren, die nicht gering zu schätzen ist.
Gelegentlich und unerwartet würde sie auch kleine kleine Impromptus eigener Komposition in mir trällern, die mir oft extrem hübsch vorkamen, altmodisch und wunderlich; aber man ist kein guter Beurteiler eigener Hervorbringungen, am wenigsten während der Hitze der Inspiration; und ich hatte nicht die Mittel, sie aufzuzeichnen, da ich die Musiknoten nie erlernt habe. Was hat die Welt verloren!
Zu wem aber die schwache Stimme gehörte, das fand ich erst viele Jahre später heraus, denn es war nicht meine!
*****
Trotz solcher seltenen Fähigkeiten und Ressourcen in mir selbst war ich kein glücklicher oder zufriedener junger Mann, und meine Unzufriedenheit hatte in keiner Weise was Göttliches.
Mir missfiel mein Beruf, für den ich mich nicht sonderlich befähigt fühlte, und ich hätte mit Wonne einen anderen ergriffen – Poesie, Wissenschaft, Literatur, Musik, Malerei, Skulptur; für alle diese Fächer fühlte ich mich, ich sage es, ohne rot zu werden, von Natur aus besser begabt.
Mir missfiel Pentonville, das, obgleich sauber, rechtschaffen und achtbar, in puncto Aussehen, Farbe, romantischer Vergangenheit und örtlichem Liebreiz viel zu wünschen übrig ließ; viel lieber hätte ich irgendwo anders gelebt: zum Beispiel auf den Champs élysées, ja, selbst auf dem fünften Zweig des dritten Baumes auf der linken Seite, wenn man vom Arc de Triomphe kommt, wie einer der klassischen Helden der Vie de Bohème von Henri Murger.
Mir missfielen meine Mit-Lehrjungen und ich kam nicht gut mit ihnen aus, besonders mit einem sehr schlauen, aber hinterhältigen und hässlichen Jungen namens Judkins, der offenbar vom ersten Tag an einen Hass auf mich gefasst hatte. Er ist jetzt ein Mitarbeiter der Royal Academy. Sie hielten mich für eingebildet, weil ich an ihren Zerstreuungen nicht teilnahm; Zerstreuungen, die ich mir hätte leisten können und die in der Tat billig, aber widerwärtig waren.
Aber solche Wirtshausvergnügen schienen ihnen zu gefallen, denn sie suchten dort nicht nur Spaß, sondern waren auch stolz darauf.
Sie waren sogar stolz auf einen üblen Kopfschmerz und fanden es toll, wenn er die Folge der durchschwelgten letzten Nacht war; und waren angeberisch zerknirscht über ein blaues Auge, das sie sich bei einer Kabbelei in den Argyll Rooms zugezogen hatten, gerade als wäre es das Victoria-Kreuz. Eine Nacht im Polizeigewahrsam zu verbringen, war so glorios, dass sie es vortäuschten, wenn es gar nicht stimmte.
Sie betrachteten mich als Tölpel, als Milchbart und feinen Pinkel, und verachteten mich zutiefst; sie zeigten das nur deshalb nicht so nach außen, weil sie wohl doch nicht so scharf auf blaue Augen waren, wie sie taten.
So überließ ich sie ihren billigen Vergnügungen und ging meinen eigenen nach, u.a. indem ich meinen Körper nach Methoden trainierte, die ich bei den Life Guards gelernt hatte. Ich gehörte einem Turn-, Fecht und Boxclub an, dessen eifrigster Besucher ich war; es gab keinen eifrigeren Hantelstemmer und Keulenschwinger als mich, und aus mir wurde mit der Zeit ein vielseitiger Athlet, sehnig und mager wie ein Windhund, knapp unter 15 Stone (ca. 90 kg), und vier Zoll über sechs Fuß an Größe (ca. 1,90 m), was vor 30 Jahren als recht groß galt; besonders in Pentonville, wo mein Überragen mir oft eher Spott als Respekt einbrachte.
Im Ganzen also eine beeindruckende Person; wobei ich freilich von furchtsamer Natur war, Angst hatte, weh zu tun und der friedlichste Mensch der Welt war.
Meine alte Vorliebe für Slums lebte wieder auf, und ich fand und besuchte die schlimmsten von London. Es waren tolle Slums, aber es waren nicht die von Paris – darin ist Frankreich einfach besser.
Selbst Cow Cross, wo die S-Bahn jetzt zwischen King’s Cross und Farringdon Street entlangläuft, Cow Cross, weiland ein Labyrinth von Schlachthäusern, Schnapsbuden und Räuberhöhlen mit dem berühmten Fleet Ditch, der darunter einherströmt, selbst Cow Cross fehlten der Zauber und das Geheimnisvolle mittelalterlicher Romantik. Nirgends Erinnerungen an so charmante Leute wie den Roi des Truands, Gringoire und Esmeralda, mit einem Seufzer musste man sich mit Vorstellungen von Fagin, Bill Sykes und Nancy zufrieden geben.
Quelle dégringolade!
Und dann die heutigen Bewohner! Mit dumpfem, verwundertem Mitleid schaute man die armen, bleichen, rachitischen Kinder an, die schlampigen, rohen Weiber, die nie lachten (außer wenn sie betrunken waren), die ausdruckslosen, mürrischen Männer. Wie sehr fehlte ihnen die Anmut französischer Hässlichkeit, die Behaglichkeit und Leichtigkeit des französischen Lasters, die sympathische Vornehmheit des französisch Grotesken. Wie harmlos waren sie, die die Faust dem lautlosen und heimtückischen Messer vorzogen! Die treuherzig mit den Händen, statt mit den Füßen kämpften und die Tritte ihrer Nagelschuhe für ihre widerspenstigen Frauen aufhoben!
Und dann gab es dort keine Morgue; man vermisste seine Morgue sehr.
Und Smithfield! Es war herzzerreißend (wie Monsieur le Major zu sagen pflegte), die armen Viecher anzuschauen, die an bestimmten Tage kamen, um auf ihrem Weg ins Schlachthaus kurz Station zu machen auf diesem widerwärtigen Viehmarkt. Was für Knüppel habe ich auf schöne, verwirrte, benommene, demütige Augen niedersausen sehen, dicht bewimpert gegen die Sonne auf dem Land; auf weiche, feuchte Nüstern, die noch im giftigen Gestank den Duft ferner Felder witterten! Welche Qualen begriffsstutziger Schafe und freundlich-zynischer Schweine!
Selbst die Hunde schienen demoralisiert und brutal wie ihre Herrchen zu sein. Und dort hatte ich eines Tages ein Erlebnis, schmutzig und handgreiflich, sehr erniedrigend am Ende für mich, das mir zeigte: Ritterlichkeit trägt wie Tugend ihren Wert in sich, selbst wenn die Ritterlichen jung, groß und stark sind und gelernt haben zu boxen.
Ein brutaler junger Viehtreiber trat mutwillig ein Schaf und brach ihm, wie ich dachte, ein Hinterbein, und in meiner Wut nahm ich ihn beim Ohr und schleuderte ihn auf einen Haufen von Matsch und Dreck. Er stand auf und holte mutig gegen mich aus; er reichte mir kaum bis zum Kinn, und ich weigerte mich, mit ihm zu kämpfen. Es bildete sich um uns ein Menschenauflauf, und als ich den Umstehenden den Grund unseres Streits zu erklären versuchte, gelang es ihm, mich mit seiner dreckigen Faust ins Gesicht zu schlagen.
„Bravo, kleiner Hunne!“, riefen die Umstehenden, und er holte erneut aus. Ich fühlte mich erbärmlich und schämte mich, wehrte alle seine Schläge ab und sagte ihm, dass ich ihn umbringen würde, wenn ich zuschlüge.
„Los!“, rief die Menge ringsum, „zeig’s ihm, kleiner Hunne! Gib’s ihm! Der lange Hunne zeigt das weiße Handtuch,“ usw., und schließlich versetzte ich ihm eine leichte Rückhand, von der seine Nase blutete, was ihn völlig demoralisierte. „Los!“, brüllten die umstehenden, „der braucht einen von seiner Größe!“
Verzweifelt und wütend sah ich mich um, suchte mir den größten Mann heraus, sagte: „Bist du groß genug?“ Die Leute brüllten vor Lachen.
„Gut, Chef,“ antwortete er, „es soll nicht drauf ankommen.“ Ich versuchte, ihm ins Gesicht zu schlagen, verfehlte es aber und erhielt einen so heftigen Schlag aufs Ohr, dass ich für ein oder zwei Sekunden schwindlig war, und als ich zu mir kam, grinste er mich immer noch an. Wieder und wieder versuchte ich ihn zu treffen, verfehlte ihn aber immer; schließlich legte er mich dreimal flach, ohne mich sonderlich zu verletzen, und das auf dem Haufen, auf den ich den Viehtreiber geworfen hatte, die Leute klatschten wie verrückt Beifall. Benommen, ohne Hut, keuchend und dreckig, starrte ich ihn in hoffnungsloser Unfähigkeit an. Er streckte seine Hand aus und sagte: „Alles in Ordnung, Chef? Hoffe, ich hab dir nicht weh getan. Ich bin Tom Sayers. Wenn du mich getroffen hättest, ich wär umgeflogen wie ein Kegel, und ich bin nicht sicher, ob ich je wieder hochgekommen wär!“
Er sollte einmal der berühmteste Boxer von England werden!
Ich drückte ihm die Hand, dankte ihm und bot ihm einen Sovereign (Goldmünze) an, die er ablehnte; dann brachte er mich in ein Zimmer in einem Gasthaus, wo er mich wusch und abbürstete, und darauf bestand, mir ein Glas Brandy mit Wasser auszugeben.
Seither habe ich eine Vorliebe für Boxkämpfer und empfinde einen vorher ungekannten Respekt für ihre edle Wissenschaft. Er war viele Zoll kleiner als ich und sah überhaupt nicht nach dem Herkules aus, der er war.
Ich sei der der strammste junge Kerl, den er je erlebt habe, sagte er mir, und dabei „ziemlich langbeinig“. Ich weiß nicht, ob er ehrlich war, aber kein mögliches Kompliment hätte mich mehr erfreuen können. Das ist jugendliche Eitelkeit.
Und hier, obgleich es ein bisschen nach Angeberei schmeckt, kann ich der Versuchung nicht widerstehen, ein anderes Abenteuer derselben Art zu erzählen, in dem ich mich freilich vorteilhafter darstellte.
Es war am Tag eines Boxkampfs (seltsam genug), und ich kehrte mit Lintot und einem seiner Jungen von einem Spaziergang auf den Feldern von Highgate zurück.

Auf unserem schmutzigen Heimweg durch die Caledonian Street wurden wir von einer Menge vor einem Gasthaus aufgehalten. Ein riesiger Bierkutscher (die sehen immer größer aus, als sie wirklich sind) forderte einen armen betrunkenen Hilfsarbeiter heraus, der nicht halb so groß war wie er und der nicht einmal zu einem Versuch von Selbstverteidigung in der Lage war; er konnte kaum die Arme heben, ich dachte zuerst, es sei nur Unfug. Und weil der kleine Joe Lintot was sehen wollte, setzte ich ihn auf meine Schultern, gerade als der Bierkutscher, der getrunken hatte, aber nicht betrunken war, und ein teuflisch gerissenes Gesicht hatte, den betrunkenen armen Schlucker zwischen die Augen traf und zum Entzücken der Umstehenden fällte (wie man einen Ochsen mit dem Knüppel fällt).
Der kleine Joe, ein sanftmütiger und sensibler Junge, begann zu weinen, und sein Vater, der den Mut eines Bullterriers hatte, wollte trotz seiner Winzigkeit dazwischengehen. Ich war auch außer mir vor Wut, zog meinen Mantel aus, gab Lintot meinen Hut und bahnte mir meinen Weg zu dem Bierkutscher, der anbot, mit drei Mann aus der Menge zu kämpfen, ein Angebot, auf das es keinerlei Echo gab.
„Also dann, du feiges Stinktier!“ sagte ich und krempelte meine Ärmel auf; „steh auf und ich jag dir die Zähne durch deinen hässlichen Hals.“
Sein Gesicht nahm die Farbe eines marmorierten Stilton an, und er fragte, warum ich mich mit ihm anlegte. Es bildete sich ein Kreis um uns, und diesmal spürte ich, dass die Leute für mich waren – ein sehr angenehmes Gefühl!
„Nimm die Arme hoch! Sonst bring ich dich um!“
„Ich schlag mich nicht mit Ihnen, Mister. Ich schlag mich mit niemand. Lassen Sie mich in Ruhe!“
„Doch, das tun Sie, oder Sie kriechen auf Knien und flehen um Verzeihung dafür, dass sie ein brutales, feiges Stinktier sind.“ Und ich versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht, der wie ein Pistolenschuss klang, einen richtig tollen, zufrieden stellenden und erfolgreichen Schlag dies Mal. Meine Fingerspitzen prickeln bei der bloßen Erinnerung.
Er wollte weglaufen, wurde aber aufgehalten. Er fing an zu flennen und zu wimmern, und sagte, er hätte mir doch nichts getan und wollte wissen, wofür ich ihn bestrafte.
„Knie dich hin – schnell – sofort!“ Und ich tat, als ob ich ohne Wenn und Aber Ernst machen wollte.
Er sackte auf seine Knie – und verlor vor lauter Aufregung das Bewusstsein.
Als man mir wieder in den Mantel half, schmeckte ich zum ersten Mal in meinem Leben, wie süß es ist, beliebt zu sein, und begriff, was es bedeutete, zum Idol einer Meute zu werden.
Der kleine Joe Lintot und seine Brüder und Schwestern, die mich vorher weitgehend ignoriert hatten, beteten mich von diesem Tag an an.
Und es wäre unaufrichtig nicht zu bekennen, dass ich bei dieser Gelegenheit mit mir selbst recht zufrieden war, wiewohl ich, als der riesige Klotz von einem bierdurchtränkten Rohling (der von fern so furchtbar ausgesehen hatte) mit nicht unerheblicher Erleichterung fühlte, dass er keinerlei Chance hatte. Er war nichts als groß, und sogar an Größe übertraf ich ihn.
Die wirkliche Ehre des Tages gebührte Lintot, der, davon bin ich überzeugt, bereit war, diesem Goliath gegenüber den David zu geben. Er hatte den richtigen Kampfgeist, der mir wie so vielen langen Lulatschen abging.
Und deshalb habe ich wohl auch so viel über meine nicht sehr herausragende Tapferkeit bei dieser Gelegenheit geredet; ich bin wirklich körperlich kein Feigling, jedenfalls gehe ich davon aus. Wäre ich einer, es wäre mir nicht peinlicher, es zu gestehen, als wenn es um das Eingeständnis schlechter Verdauung oder eines schwachen Herzens ginge, das uns alle zu Feiglingen macht.
Ich hasse Krawall, Gewalt und Blutvergießen, selbst wenn nur eine Nase blutet, irgendeine, meine eigene oder die meines Nächsten.
*****
Es gibt Slums im Osten von London, von denen viele elegante Leute heutzutage Einiges wissen; ich lernte sie auswendig. Zusätzlich zum bloßen Reiz des Slums gab es dort die unvergängliche Faszination der Seefahrerei und von Janmaat auf Landgang – einem liebenswerten Geschöpf, das alles, was es berührt, auf seine ganz besondere Art und Weise verschönt.
Ich suchte immer wieder die Docks auf, wo der Geruch nach Teer und der Anblick von Tauen und Masten mich mit unaussprechlicher Sehnsucht nach dem Meer, nach fernen Ländern, nach jedem Ort erfüllte außer dem, an den mein Schicksal mich verschlagen hatte.
Ich sprach mit Schiffskapitänen, mit Maaten und Matrosen, hörte viele wunderbare Geschichten, wie der Leser sich wohl vorstellen kann, und entwickelte für mich selbst Visionen von wolkenlosen Himmeln, saphirblauer See und Korallenriffen; Gewürzwäldern, umherstreifenden dunklen Jugendlichen in bunter Federkleidung und freundlichen Eilanden, wo eine liebliche, halb bekleidete, barfüßige Neuha mit ihrer Fackel wedeln und mich, ihren Torquil, bei der Hand durch Höhlen des Entzückens leiten würde!
Besonders gern besuchte ich eine Werft bei der London Bridge, von wo aus zwei Dampfer – die Seine und der Dolphin, wenn ich mich recht erinnere – einen um den anderen Tag abwechselnd nach Boulogne-sur-Mer ablegten.

Ich pflegte die glücklichen Passagiere nach Frankreich zu beobachten, wie einige von ihnen, bereits in Ferienstimmung, sich schon auf dem Sonnendeck mit einander bekannt machten, herummachten mit Liegestühlen, Zeitschriften, Romanen und Flaschen bitteren Biers oder sich unter den Schornstein zurückzogen, um die Friedenspfeife zu rauchen.
Das Geräusch des Kessels, wenn der Dampfdruck zunahm – was für eine herrliche Musik war das! Würde sie auch mal für mich erklingen? Der bloße Duft der Kabinen, das Gefühl der Gangway aus Messing und der messingbeschlagenen und mit Wachstuch bedeckten Stufen war herrlich; und unten auf schneeweißen Tischdecken gab es kaltes Rind- und Hammelfleisch, schönen frischen Senf, Flaschen mit hellem und dunklem Bier. O ihr glücklichen Reisenden, die ihr euch dies alles leisten könnt, und Frankreich gibt’s noch dazu!
Bald würde ein großes weißes Sonnensegel das Achterdeck in ein Paradies verwandeln, von dem aus, nach und nach, das schnell vorbeigleitende Panorama der Themse anzuschauen war. Die Glocke würde Nichtpassagiere wie mich an Land treiben – „Que diable allait-il faire dans cette galère!“, wie Onkel Ibbetson gesagt hätte. Der Dampfer legte von der Werft mit einem fröhlichen Jauchzen aus Männerkehlen und dem langsam pulsierenden Plätschern der Schaufelräder ab, er würde seinen sonnigen Weg ostwärts durch die kleinen Flussschiffe nehmen, während einige Taschentücher geschwenkt wurden als ein freundlich gemeintes Lebewohl – auf Wiedersehen! [die letzten beiden Worte deutsch im Original]
O, als der unpassend zur Jahreszeit einen Südwester tragende Mann am Steuerrad stehen und St. Pauls, London Bridge und den Tower von London aus dem Auge verlieren – um sie nie, nie wieder zu sehen! Kein auf Wiedersehen [wie oben] für mich!
Manchmal würde ich meine Schritte nach Westen lenken und meine hungrigen, eifersüchtigen Augen mit dem Anblick des fröhlichen Sommerbetriebs im Hyde Park füllen oder der Kapelle in Kensington Gardens lauschen, schöne, gut angezogene Frauen sehen, ihre süßen, kultivierten Stimmen, ihr munteres Gelächter vernehmen; und eine Sehnsucht würde mein Herz erfüllen, leidenschaftlicher als die nach der See und nach Frankreich und entfernten Ländern, und ebenso unaussprechlich. Ich würde sogar Neuha und ihre Fackel vergessen.
Danach war es ein arger Absturz, für Tenpence ganz allein essen zu gehen und den Tag mit einem Buch in meiner einsamen Behausung in Pentonville zu beenden. Das Buch wollte nicht gelesen werden; es schmollte und musste abgelegt werden, denn „schöne Frau! Schönes Mädchen!“ buchstabierte es zwischen mir und der gedruckten Seite. Übersetz mir die Worte ins Französische, o du, der du Shakespeare in französische Alexandriner übertragen kannst – „Belle femme? Belle fille?“ Ha! Ha!
Wenn du so nah wie möglich herankommen willst, musst du „Belle Anglaise“ oder „Belle Américaine“; nur dann wird man dich verstehen, sogar in Frankreich!
Ah! Elle était bien belle, Madame Seraskier! [Ach! Wie schön war Madame Seraskier!]
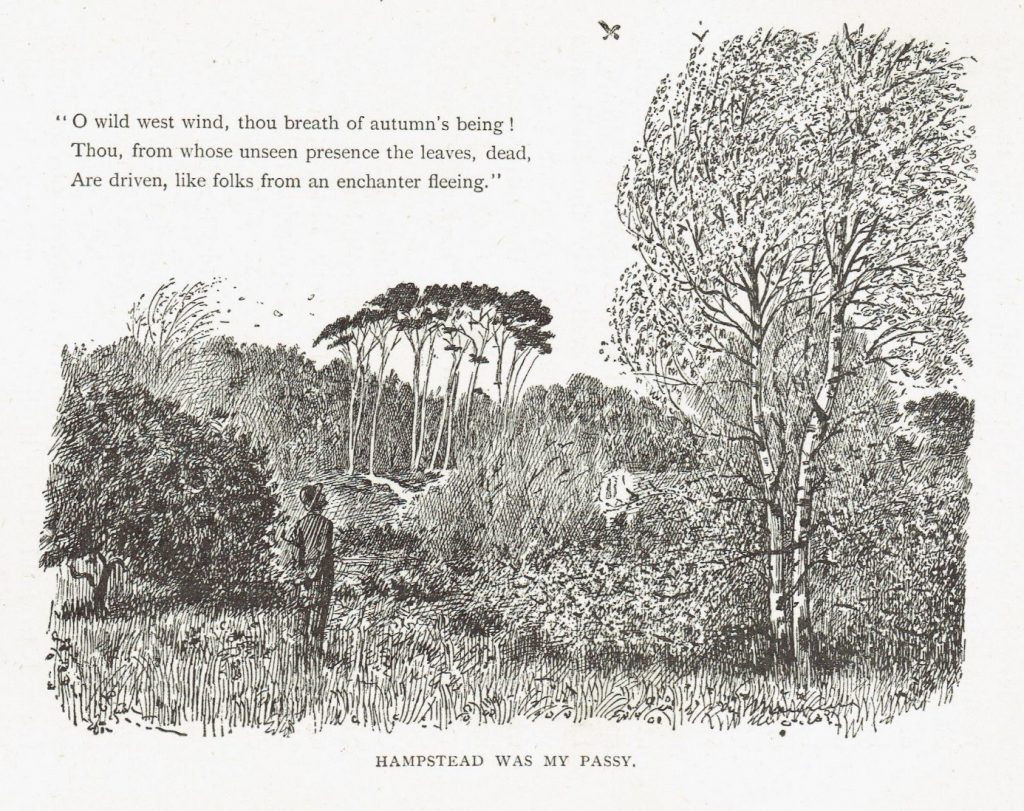
Zu anderen Zeiten hatte ich die glücklichere Eingebung, mein Verlangen nach Natur durch lange Wege über Land zu stillen. Hampstead war mein Passy – der Leg-of-Mutton-Pond mein Mare d’Auteuil; Richmond war mein St. Cloud mit Kew Gardens als Bois de Boulogne. Und Hampton Court gab ein recht hübsches Versailles – dass es unvergleichlich viel hübscher war, sollte sogar ein Schüler von Lintot wissen.
Und nach so heilsamer Anstrengung und duftigen Eindrücken schmeckte das Essen für Tenpence gleich besser, das kleine Vorderzimmer in Pentonville war heimeliger, das Buch mehr wie ein Freund.
Denn ich las alles, was ich an englischer oder französischer Literatur bekommen konnte. Romane, Reisebeschreibungen, Historisches, Dichtung, Wissenschaft – all das wanderte als Mahlgut in die höchst melancholische Mühle meines Gemüts.
Ich versuchte zu schreiben; ich versuchte zu zeichnen; ich versuchte, mir ein Innenleben aufzubauen, abseits von der kläglichen Alltagshässlichkeit meines äußeren, eine private Oase nur für mich selbst, um mich ein wenig, wenn auch nur im Geist, über die Umstände zu erheben, in die mich zu versetzen es dem Schicksal gefallen hatte.[3]
Ich brauche es nicht zu sagen: Wie viele nachdenkliche Jugendliche von melancholischem Temperament, mittellos und unzufrieden mit ihrem Los, dem Rauchen von starkem Tabak (auf leeren Magen) ergeben, brütete ich ständig über Fragen der Existenz – freier Wille und Determinismus, die Wohers, Warums und Wohins des Menschen, den Ursprung des Bösen, die Unsterblichkeit der Seele, die Sinnlosigkeit des Lebens usw., und wurde über all diese Fragen immer unglücklicher.
Hätte ein neugieriger Passant durch die Jalousien von Nr. -, Whartonstreet, Pentonville gelinst, er wäre oft belohnt worden von dem anrührenden Anblick eines großen, grobknochigen früheren Rekruten der Leibgarde ihrer Majestät, den Kopf gebeugt über die schwarze-gelbe Tastatur eines ehrwürdigen Tafelklaviers (auf dem er nicht spielen konnte), wie er die bitteren Tränen von Einsamkeit und Weltschmerz [deutsch im Or.] in Kombination vergoss.
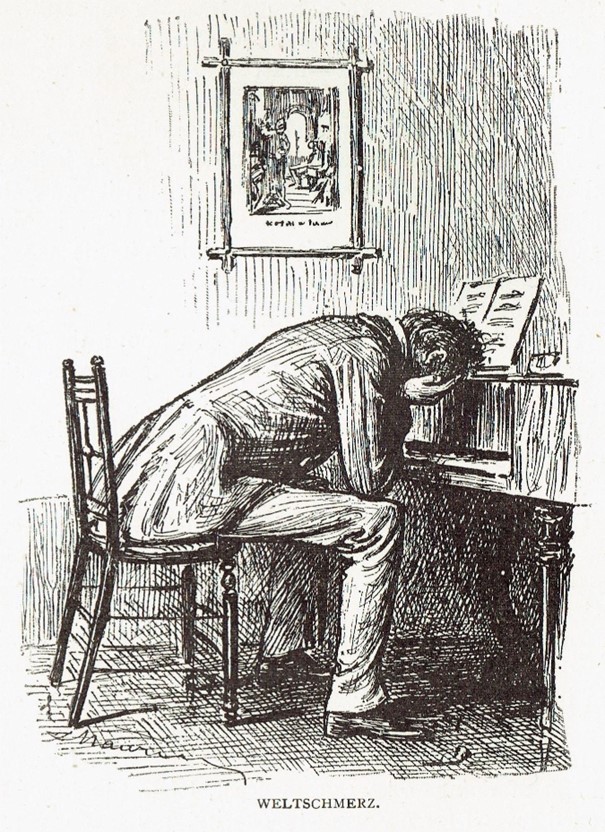
Nicht einmal widerfuhr es mir, dass ich Erleichterung im Schoß einer Kirche suchte.
Einige Charaktere werden geboren und nicht gemacht. Ich war ein geborener „Ungläubiger“. Wenn es je einen geborenen Agnostiker gab, zum Unglauben veranlagt von Geburt an, so war ich das. Dabei hatte ich den Ausdruck Agnostizismus nie gehört; er ist eine Erfindung späterer Jahre. …
„J’avais fait de la prose toute ma vie sans le savoir.“
[„Zeit meines Lebens hatte ich unbewusst Prosa geschrieben.“]
Der wohl erste bewusste Hass, an den ich mich erinnere, richtete sich auf die schwarze Gestalt des Priesters, und es gab mehrere dieser Gestalten in Passy.
Monsieur le Major nannte sie maîtres corbeaux, und schien sie nur wenig zu schätzen. Dr. Seraskier hasste sie; seine sanfte katholische Frau hatte gelernt, ihnen zu misstrauen. Meine liebevolle ketzerische Mutter liebte sie nicht; mein Vater, katholisch geboren und erzogen, hegte eine ähnliche Abneigung. Sie hatten seine Götter verfolgt – Galileo, Bruno, Kopernikus, und sein Bewusstsein mit den Gräueln der Inquisition und der Bartholomäusnacht konfrontiert. Und ich stellte sie mir immer vor, wie sie, wenn sie wollten, kleine Ketzer in Eton Jacketts, mit weißen Zylindern und allem Drum und Dran lebendig verbrannten!
Ich habe keinerlei Zweifel, dass sie in Wahrheit die besten und freundlichsten Menschen waren.
Der Pfarrer (und an Pfarrern war kein Mangel in Pentonville) war nicht so heimtückisch abstoßend wie die blauwangigen, blaukinnigen Priester in Passy; doch er war für mich in keiner Weise eine pittoreske oder sympathische Erscheinung mit seiner Vermähltheit, seinen Koteletten, seiner schwarzen Hose, seinem Gehrock, seinem hohen Hut, seinem Beffchen, seinem Bewusstsein, Gentleman von Berufs wegen zu sein. Ebenfalls sehr unattraktiv waren die billigen, brandneuen Kirchen, in denen er der düster aussehenden Herde im Sonntagsstaat das Wort verkündete – mit kaum einem dieser Kirchenbesucher hätte seine Frau sich an den Esstisch gesetzt – besonders wenn sie aus ihrer Mitte erwählt worden war.

Diese Herde sonntags am Morgen, Nachmittag oder Abend zum Läuten der Glocken einziehen und nach dem langen Gottesdienst mit seiner banalen, oberflächlichen Predigt wieder herauskommen zu sehen, war deprimierend. Wochentage in Pentonville waren deprimierend genug; aber Sonntage waren deprimierender, als man mit Worten ausdrücken kann, obgleich das niemand außer mir zu finden schien. Frühe Übung hatte sie daran gewöhnt.
Ich bin über die physischen Antipathien meiner Jugendtage hinweggekommen; nicht einmal der Anblick eines anglikanischen Bischofs erregt länger mein Missfallen; im Gegenteil; und über die Schönheit eines Kardinals könnte ich förmlich in Entzücken ausbrechen.
So bin ich jetzt gut befreundet sowohl mit einem Pfarrer als auch mit einem Priester und weiß nicht, welchen der beiden ich mehr liebe und respektiere. Sie sollten mich hassen, aber sie tun es nicht; ich glaube, sie bemitleiden mich einfach zu sehr. Ich bin zu negativ, um im einen oder anderen tiefen theologischen Hass zu erregen; und all den kleinen Hass, den die Praxis von Liebe und Barmherzigkeit in ihren freundlichen Herzen hinterlassen hat, reservieren sie für einander, ein unstillbarer Hass, den sie so richtig auskosten und der umso mehr rast, je tiefer er verborgen werden muss. Es betrübt mich zu denken, dass ich der Zankapfel zwischen ihnen bin!
Und doch war die Bibel, trotz all meines Unglaubens, mein liebstes Buch, und ich verehrte die Psalmen; und ich kann aufrichtig versichern, dass meine geistige Einstellung immer ehrerbietig und demütig war.
Aber all die Argumente, die je gegen das Christentum angeführt wurden (und ich glaube, ich kenne sie inzwischen alle), waren spontan und unaufgefordert in mir entstanden, und sie erschienen mir alle unbeantwortbar und sind in der Tat bis jetzt unbeantwortet. Und mir erschien auch kein Glaube, von dem ich je gehört habe jemals glaubwürdig oder attraktiv oder wenigstens nachvollziehbar – außer für die zentrale Gestalt der Gottheit – einer Gottheit, die in keinem Fall jemals die meine sein konnte.
Die Ehrfurcht gebietende und unveränderliche Konzeption die sich, ob ich wollte oder nicht, in mein Bewusstsein gearbeitet hatte, war die eines unendlich abstrakteren, abgeschiedeneren und unzugänglicheren Wesens, als der Genius der Menschheit je eines nach seinem eigenen Bild und nach den Bedürfnissen seines Herzens entwickelt hatte – unerforschlich, unvorstellbar, unsagbar; über allen menschlichen Leidenschaften stehend, jenseits der Reichweite jeder menschlichen Anrufung; Einer, über dessen Attribute zu spekulieren sinnlos war, Einer, dessen Name nicht Er war, sondern Es.
Der Gedanke totaler Vernichtung war unerfreulich, hatte aber keinerlei Schrecken.
Schon als Kind hatte ich scharfsinnig geargwöhnt, dass die Hölle nicht mehr war als eine abgeschmackte Drohung für freche kleine Jungen und Mädchen und der Himmel ein abgeschmackter Köder, nach der beiläufigen Art, in der beides durch Diener und solche Leute als die mir zustehende Portion an mich verteilt wurde, je nachdem, wie ich mich benahm. Weder mein Vater noch meine Mutter, weder Monsieur le Major noch die Seraskiers, also die einzigen Menschen, denen ich vertraute, erwähnten mir gegenüber Derartiges.
Was die Voreingenommenheit gegen die Priester betrifft, blieb ich in jenem zarten und empfänglichen Alter unbeeinflusst. Ich hatte meinen Katechismus gelernt, meine Bibel gelesen, pflegte das Vaterunser zu sprechen, wenn ich zu Bett ging, und „Gotte Segne Papa und Mama“ und all das in der üblichen, oberflächlichen Art.
Nie hörte ich, dass von denen, die mein kindliches Vertrauen besaßen, auch nur ein einziges Wort gegen die Religion gesagt wurde; auf der anderen Seite wurde ihr offenbar nicht die Wichtigkeit beigemessen wie den Tugenden der Wahrhaftigkeit, des Mutes, der Großzügigkeit, der Selbstverleugnung, der Höflichkeit und besonders der Rücksichtnahme auf andere, hoch oder niedrig, Mensch oder Tier.
Ich nehme an, dass meine Eltern sich hierüber abgesprochen und beschlossen haben, dass ich alle größeren Lebensprobleme allein lösen sollte, wenn ich alt genug wäre, um darüber nachzudenken, nach meinem eigenen Gewissen, meinem dann erreichten Wissensstand und mit der Hilfe, die sie mir nach bestem Wissen und Gewissen geleistet hätten, wären sie am Leben geblieben.
So machte ich es und entwickelte für mich einen Moralkodex, nach dem ich leben wollte, in dem Religion aber nur einen kleinen Platz einnahm.
Für mich gab es nur eine Sünde, und das war Grausamkeit, weil ich sie hasste; obgleich die Natur, aus den ihr eigenen rätselhaften Gründen, sie beinahe als Tugend lehrt. Alle Sünden, die keine Grausamkeit enthielten, waren nur Sünden gegen die Gesundheit, den Geschmack, das Gemeinwohl oder allgemeine Schicklichkeit.
Ein freier Wille war unmöglich. Nur scheinbar konnten wir frei wollen, und das nur innerhalb der Grenzen eines kleinen Dreiecks, dessen Seiten Vererbung, Erziehung und Umstände waren – eine geometrisches Arrangement eigener Erfindung, auf das ich kein bisschen stolz war, obgleich es nicht auf allen Vieren geht; vielleicht weil es nur ein Dreieck ist.
Das heißt, wir können schnell genug wollen – zu schnell; konnten aber nicht wollen, wie wir wollten: glücklicher Weise, denn wir wären dazu jetzt und sicherlich noch auf lange Zeit gar nicht fähig, so gebaut, wie wir sind.
Selbst die Figuren eines Romans müssen sich der Natur, der Ausbildung und den Motiven entsprechend verhalten, mit denen ihr Schöpfer, der Autor, sie ausgestattet hat, oder wir legen den Roman beiseite und lesen etwas anderes; denn gleich ob Fiktion oder Fakten, die menschliche Natur muss in sich stimmig sein. Sogar noch im Wahnsinn muss eine Methode stecken, wie also könnte der Wille frei sein?
Um irgendeine persönliche Wohltat oder den Erlass von Schlimmem zu beten – das Knie zu beugen oder die Stimme in Lobpreisung oder Dankbarkeit für irgendein irdisch Gutes zu erheben, das einem widerfahren ist, sei es durch Erbschaft, Glück oder erfolgreiche Anstrengung – war in meinen Augen einfach sinnlos; aber, mal abgesehen von der Sinnlosigkeit, war es ein Akt serviler Überheblichkeit, von bettelnder Unverfrorenheit, nicht ohne den Verdacht eines lebhaften Sinnes für künftige Vergünstigungen.
Mir kommt es so vor, als ob die Juden – ein abergläubisches und geschäftlich denkendes Volk, die wissen was sie wollen und sich nicht groß darum scheren, wie sie es kriegen – uns gelehrt haben müssen, so zu beten.
Es war nicht das süße, naive Kind, das unschuldig darum betet, der morgige Ferientag möge schön sein; oder dass Santa Claus sich als gebefreudig erweise; es war der gerissene Händler, katzbuckelnd, schmeichelnd, günstig stimmend mit übertriebenem, kriecherischem Lob (eine Beleidigung für sich), gerade so wie Brandopfer; nur den eigenen Erfolg für jetzt und später im Auge und die Verwirrung seines Feindes.
Es war das Kriechen eines Hundes ohne die aufrichtige Liebe des Hundes, die sogar seine Furcht oder seinen Sinn für sein eigenes Interesse an Stärke übertrifft.
Was für eine Haltung für jemanden, den Gott nach seinem eigenen Bilde geschaffen hatte – sogar vor seinem Schöpfer!
*****
Das einzige zulässige Gebet war ein Gebet um Kraft oder um Ergebung; denn das war ein nach innen gerichtetes Gebet, ein Appell an unser besseres Selbst – an unsere Ehre, unseren Stoizismus, unsere Selbstachtung.
Und zu einem kleinen Detail, das Danksagen vor und nach Mahlzeiten kam mir besonders selbstgefällig und ungerecht vor, solange es so viele gab, die kaum jemals eine Mahlzeit hatten, für die sie danken konnten. Die einzige annehmbare und angemessene Danksagung wäre gewesen, die Hälfte der Mahlzeit abzugeben – nicht dass ich gewohnt war, das zu tun! Aber ich hatte wenigstens die Güte, mich selbst für meinen Mangel an Barmherzigkeit zu tadeln, und das war meine einzige Danksagung.
*****
Glücklicherweise zeigte, da wir keinen eigenen freien Willen hatten, die Richtung, in die wir getrieben wurden, aufwärts wie die der Funken und trug uns wohl oder übel mit sich – das Gute und das Schlechte, das Schlechteste und das Beste.
Wenn wir das klar erkennen und uns zu Herzen nehmen, wurde uns auch ein Motiv geliefert, alles, was in unserer Macht steht, zu tun, um diese Aufwärtstendenz zu fördern – pour aider le bon Dieu – [Um dem lieben Gott zu helfen], dass wir uns schneller erhöben und Ihn, wenn es Ihn denn gibt, früher erreichen! Und wenn das Menschenwesen erst einmal unterwegs ist wie eine Rakete oder eine Uhr oder eine Dampfmaschine, und das in der richtigen Richtung, was kann es nicht erreichen?
Wir sollten rechtzeitig die Verhältnisse kontrollieren, statt von ihnen kontrolliert zu werden; die Erziehung würde täglich besser auf ein stimmiges Ziel ausgerichtet; und schließlich sollten wir gewissenhaft den Erbgang mit unseren eigenen Händen lenken, statt ihn dem blinden Glück zu überlassen; natürlich nur, wenn nicht eine gut angeleitete väterliche Regierung weise die Zügel in die Hand nimmt und ausschließlich nach gebührendem und sorgfältigem Ausschluss der Unfähigen die Vereinigung von Menschen genehmigt, die einander zutiefst lieben.
So sollte der Grausamkeit wenigstens ein Geschirr angelegt werden, und nichts von ihrer wertvollen Energie sollte auf mutwillige Experimente verschwendet werden, wie die Natur es tut.
Und so, da aus dem Jungen der Vater des Mannes wird, sollte die menschliche Rasse einstmals Vater werden – wovon?
An dieser Stelle endeten meine Spekulationen; das war das Ergebnis x einer Dreisatzaufgabe, die nicht gelöst werden sollte von Peter Ibbetson, Architekt und Bauführer, Wharton Street, Pentonville.
Wie sich der Orang-Utan zu Shakespeare verhält, so verhält sich Shakespeare zu … x?
Wie sich die Schimpansin zur Venus von Milo verhält, so die Venus von Milo zu … x?
Nimm diese beiden x schließlich mit einander mal und versuche das Ergebnis zu erfassen!
*****
Das war, grob umrissen, der schlichte Glaube, an den ich mich in dieser Zeit hielt; und so, wie er war, hatte ich ihn selbst ohne Hilfe von außen entwickelt – ein ärmlich Ding, aber meins; oder wie ich es in de Mussets Worten ausdrückte: „Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre.“ [Mein Glas ist nicht groß, aber ich trinke aus meinem Glas.]
Denn obgleich Ideen dieser Art in der Luft lagen wie heilsame Wolken, hatten sie sich noch nicht in gedruckte Wörter für Millionen niedergeschlagen. Die Menschen wagten es nicht, über diese Dinge zu schreiben, tun es auch heute noch nicht, weder in populären Romanen, noch in billigen Magazinen, die jeder, der läuft, lesen kann, um ein wenig selbstständig denken zu lernen und ehrlich auszusprechen, was man denkt, ohne ein Geheul der Verwünschung befürchten zu müssen, sei es nun von kirchlicher oder profaner Seite.
Und ich dachte nicht nur so und konnte nicht anders denken; ich fühlte auch so und konnte nicht anders fühlen. Und ich wäre mir selbst schlecht, schwach und niedrig vorgekommen, hätte ich auch nur anders denken oder fühlen wollen, so sehr ich auch an diesem Leben verzweifelte – ich wäre zum Verräter an dem geworden, was ich eifersüchtig als meine besten Instinkte hütete.
Und dennoch kam mir der Glaube anderer, wenn er friedlich, demütig und ehrlich war, oft berührend und herzergreifend vor, manchmal sogar schön, wie Kindliches einem manchmal schön erscheint, selbst bei denen, die keine Kinder mehr sind und es hinter sich haben sollten. Aus solchem Glauben erwuchsen viele Heldenleben und er machte so manche unbedeutende Existenz tadellos und glücklich; dann schienen seine Inbrunst und Leidenschaft mit unauslöschlicher Flamme zu brennen.
In kurzen Augen blicken dann und wann, und besonders in der Jugend, kann Unglaube so inbrünstig und leidenschaftlich sein wie Glaube, und ebenso engherzig und unvernünftig, wie ich herausfand; aber ach! seine Flamme brannte nur zeitweise, und ihr Licht war kein freundliches Licht.
Er hatte kein Essen für Kinder; er konnte die Kranken und Traurigen nicht trösten; konnte innerseelische Missstimmungen nicht in demütige Harmonie auflösen; konnte unsere eigenen Fehler und Mängel nicht ausgleichen, noch uns in irgendeiner Weise als Ersatz dienen für den Erfolg und Wohlstand derer, die sich nicht für unsere Denkungsweise entschieden hatten.
Er strich keinen Balsam auf verwundeten Stolz, bot schwächlicher Mutlosigkeit keinen Halt, tröstete nicht im Trauerfall; seine steilen und holprigen Durchfahrten führten in kein verheißenes Land der Schönheit, und es gab keine sanften Ruheplätze am Wegesrand.
Seine einzige Waffe war Standhaftigkeit; sein einziger Schild Ausdauer; seine irdische Hoffnung das Gemeinwohl; sein irdischer Lohn die Öffnung aller Straßen zum Wissen und die Erlösung von einer feigen Erbschaft der Angst; seine finale Entschädigung – Schlaf? Wer weiß?
Schlaf war nicht übel.
So dass jene schlichten, ehrlichen, demütigen, andächtigen, ernsten, inbrünstigen, leidenschaftlichen und übergewissenhaften jungen Ungläubigen wie ich selbst sehr stark und tapfer und selbstsicher sein (was ich nicht war) und sehr verliebt in das, was sie für die nackte Wahrheit hielten (einer Gestalt von, auf den ersten Blick, zweifelhafter persönlicher Anziehungskraft, um die Wege des Lebens mit jener unwandelbaren Fröhlichkeit, Zuversicht und Heiterkeit zu betreten, die der Gläubige für seine eigene besondere Apanage hält.
So viel zu meinem Bekenntnis des Unglaubens, den (hätte ich das doch nur gewusst) so viele teilten, die älter, weiser und gebildeter waren als ich, die nur nach großen Opfern lang gehegter Illusionen und schrecklichen Qualen der Herzensprüfung zu ihm gelangt waren – einem Kampf, einem Ringen, das mir erspart blieb durch die Bedachtsamkeit meiner lieben Eltern, als ich ein kleiner Junge war.
*****
Und so geziemte es sich für mich, aus meinem Leben das Beste zu machen, zumal wir nach allem, was wir wussten oder glaubten oder ganz im Gegenteil sogar hofften, morgen sterben mussten.
Nicht, in der Tat, dass ich essen und trinken und lustig sein sollte; Erbe und Erziehung hatten mich in dieser Weise nicht veranlagt, denke ich, und die Verhältnisse erlaubten es nicht; aber dass ich es versuchen und nach dem besten Ideal leben sollte, das ich aus meinem Gewissen und dem bilden konnte, was die Menschheit uns in der Vergangenheit gelehrt hatte. Und die Menschheit, deren Konzeption des Ewigen und des Göttlichen so unterschiedlich war, hat uns mit solchen menschlichen Beispielen versorgt (alt und modern, hebräisch, heidnisch, buddhistisch, christlich, agnostisch und was nicht noch alles), die Besten von uns können nur hoffen, ihnen aus einiger Entfernung zu folgen.
Ich ging manchmal morgens zu meiner Arbeit, das Herz erhoben von erhabener Hoffnung und hochfliegenden Entschlüssen.
Wie leicht und einfach es schien, ein Leben ohne Furcht, Vorwurf oder Selbstsuche oder irgendeine erbärmliche Hoffnung auf persönliche Belohnung jetzt oder später! ein Leben stoischer Ausdauer, unbesiegbarer Geduld und Sanftmut, unbezähmbarer Fröhlichkeit und Selbstverleugnung!
Schließlich war es nur für weitere vierzig oder höchstens fünfzig Jahre – was bedeutete das schon? Und danach – que sçais-je? (Michel de Montaigne)
Der Gedanke war wirklich begeisternd!
Um die Zeit des Mittagessens (es bestand aus einem Abernathy-Keks, einem Glas Wasser und mehreren Pfeifen billigen, starken Feinschnitts) würde sich der Geist meines Traums auf subtile Weise verändern.
Andere Leute hatten keine hochfliegenden Entschlüsse. Einige waren sehr schlechter Laune und verärgerten einen …
Was für ein grässlicher Ort war Pentonville, um dort sein Leben mit Maloche zu verbringen! …
Was für eine Schinderei war es, auf immerdar kleine neue Läden in der Rosoman Street zu planen, und das offenbar noch nicht einmal gut! …
Warum sollte ein schielender, pockennarbiger, o-beiniger, buckliger kleiner Judkins (einen rekrutierenden Feldwebel hätte sein Anblick erschauern lassen) einen auf ewig damit verspotten, dass man sich als Soldat hatte anwerben lassen? …
Und warum sollte man sich spöttisch sagen lassen, man solle sich „nur mit jemand von der gleichen Größe einlassen“ – nur weil man ihn, unerträglich provoziert, beim Hosenboden gepackt und sanft aus der Hose heraus auf den Boden geschüttelt hatte, was ihn erschreckte, aber nicht verletzte? …
Und so weiter, und so weiter … Ständige kleine Nadelstiche, erbärmliche Demütigungen, Hässlichkeiten, Bosheiten und Schmutz, und das mobilisierte im Gegenzug all das im eigenen Selbst, was am niedrigsten und am wenigstens lobenswert war.
Man hat seine Nerven daran gewöhnt, eine aussichtslose Hoffnung zu begraben, und ein Insekt kommt einem ins Auge oder ein Aschestäubchen, und da steckt es nun: und nun geht es nach allem nicht mehr um das Begraben einer aussichtslosen Hoffnung, wird auch nie darum gehen; die Vorstellung wird beherrscht von Insekten und Aschestäubchen, Insekten und Aschestäubchen.
Wenn es Abend wurde, war ich schmählich zusammengebrochen und in die Tiefen eines verzweifelten Pessimismus versackt, zu tief sogar für Tränen, und hielt mich für das gemeinste und erbärmlichste Menschenkind – freilich waren alle außer mir noch gemeiner und erbärmlicher als ich.
Sie konnten immer noch essen und trinken und lustig sein. Ich konnte es nicht und wollte es nicht einmal mehr.
*****
Und so weiter, Tag um Tag, Woche um Woche, für Monate und Jahre …
So wurde ich meiner immer mehr verblassenden Persönlichkeit müde, immer dasselbe durch all diese unkontrollierbaren Stimmungsschwankungen hindurch.
O dieser Wechsel von Ebbe und Flut in den Lebensgeistern! Er ist krankhaft, und was am betrüblichsten ist: es ist kein wirklicher Wechsel; er ist von widerwärtigerer Monotonie selbst als völlige Stagnation. Und dieser eintönigen Wippe konnte ich nie entrinnen außer durch die Tore traumlosen Schlafs, dem Tod im Leben; denn selbst in unseren Träumen sind wir immer noch wir selbst. Es gab kein Ausruhen.
Ich sah nur ungern mein Spiegelbild in den Schaufenstern, an denen ich vorbeiging; und dennoch schaute ich immer danach in der vergeblichen Hoffnung, wenigstens eine Änderung, und sei es zum Schlechteren, zu entdecken. Ich sehnte mich leidenschaftlich danach, jemand anderes zu sein; und dennoch habe ich nie jemanden getroffen, der zu sein ich auch nur für einen Augenblick hätte ertragen können.
Und dann unsere Einsamkeit!
Jede gesonderte Einheit unserer hilflosen Rasse ist unerbittlich begrenzt durch die innere Oberfläche ihres geistigen Umkreises, ein lückenloser Panzer, in dem es keine weiche Stelle gibt, keinen Fehler, auch nicht das geringste Loch, durch das wir entschlüpfen oder die nächste und liebste Miteinheit hereinkommen könnte. Nur an fünf Punkten können wir einander berühren, und all das ist – nur durch die Funktionsweise unserer armen Sinne – von außen. Vergebens strengen wir sie an, um den am meisten Geliebten und engsten Vertrauten ein wenig näher zu kommen; immer vergebens – von der Wiege bis zum Grabe.
Warum hat ein so phantastischer Gedanke mich so grausam verfolgt? Ich kannte niemanden, mit dem ich eine solche Seelenübertragung auch nur für eine Sekunde erträglich gefunden hätte. Ich weiß es nicht! Es war wie eine Viehbremse, die meinen Körper bis zur Ermüdung vor sich her trieb, damit ich tagsüber die phlegmatische Seelenruhe hatte, die auf gesunde physische Erschöpfung folgt; damit ich nachts den traumlosen Schlaf schlief – den Tod im Leben.
„Of such materials wretched men are made.“ (Lord Byron, Tasso)
„Aus solchem Stoff sind elende Männer gemacht.“
Besonders elende junge Männer; und je elender einer ist, desto mehr raucht er; je mehr er raucht, , desto elender wird er – ein Teufelskreis!
So lag mein Fall. Ich begann mich nach der Stunde meiner Erlösung zu sehnen (wie ich es traurig zu mir selber sagte) und liebäugelte mit der Idee, mich umzubringen. Ich entwarf für mich sogar einen kleinen gereimten französischen Grabspruch, den ich sehr hübsch fand –
Je n’étais point. Je fus.
Je ne suis plus.
[Ich war nicht. Bin nur eben gewesen;
Bin nicht mehr.]
*****
O aus edlem Anlass unterzugehen – zu sterben, wenn man einem anderen das Leben rettet, selbst wenn es ein wertloses Leben ist, an dem er hing!
Ich erinnere mich, diesen Wunsch in aller Ehrlichkeit formuliert zu haben, als ich in einer mondhellen Nacht die Frith Street in Soho hinaufging. Ich stieß auf eine kleine Gruppe aufgeregter Menschen, die sich am Sockel eines Hauses versammelt hatte, in dem sich ein Laden befand. Durch eine zerbrochene Fensterscheibe im zweiten Stock erhob sich eine bedrohliche Rauchwolke in den windstillen Himmel. Eine gewöhnliche Leiter war gegen das Haus gelehnt, das, wie es hieß, dicht bewohnt war. Aber es war noch keine Feuerspritze oder Drehleiter angekommen, und es schien nutzlos, noch länger zu versuchen, die Bewohner aufmerksam zu machen, indem man gegen die Tür trat und schlug.
Ein mutiger Mann wurde gebraucht, ein sehr mutiger Mann, der die Leiter hinaufkletterte und durch das zerbrochene Fenster in das Haus eindrang. Hier war endlich eine aussichtslose Hoffnung auzuloten!
Zu meiner ewigen Scham und Zerknirschung war ich es nicht.
Er war klein und dick und mittelalt und hatte ein sehr lustiges rotes Gesicht und gewaltige Koteletten – ein ganz normaler Mann, der auch in keiner Weise lebensmüde zu sein schien.
Sein Heldenmut war überflüssig, wie sich zeigte; denn das Haus stand leer, wie wir zu unserer großen Erleichterung erfuhren, noch bevor es ihm gelungen war, sich den Weg in das brennende Zimmer zu bahnen. Seine Koteletten wurden nicht einmal angesengt!
Nichtsdestotrotz schlich ich nach Hause und gab alle Gedanken an Selbstzerstörung auf – selbst aus edlem Anlass; und dort übergab ich bußfertig und allzu hastig die mühselige Arbeit vieler Nächte dem Feuer – eine bis ins Einzelne mit Feder und Tinte, Linie um Linie ausgearbeitete Kopie von Retels unsterblichem Holzschnitt „Der Tod als Freund“, [deutsch im Or.] den Mrs. Lintot mir netter Weise geliehen hatte; unter die Kopie hatte ich in schöner schwarzer Fraktur mit roten Anfangsbuchstaben (und ohne den leichtesten Anflug von Humor oder Respektlosigkeit) das folgende Gedicht geschrieben, das mich unendliche Qualen gekostet hatte:
| I F, i, fi-n, i, ni! Bon Dieu Père, j’ ai fini … Vous, qui m’avez tant puni, Dans ma triste vie, Pour tant d’horribles forfaits Que je ne commis jamais, Laissez-moi jouir en paix De mon agonie! | I B, bi, bin am En-, am Ende! Lieber Gottvater, ich bin am Ende … Du, der du mich so gestraft hast in meinem traurigen Leben für so viele schreckliche Untaten, die ich nie beging, lass mich in Frieden meinen Todeskampf genießen! |
| II Les faveurs que je Vous dois, Je les compte sur mes doigts: Tout infirme que je sois, Ça se fait bien vite! Prenez patience, et comptez Tous mes maux – puis computez Toutes Vos sévérités – vous me tiendrez quitte! | II Die Wohltaten, die ich Dir danke, kann ich an meinen fünf Fingern abzählen: Behindert, wie ich bin, ist das schnell getan! Hab Geduld und zähle alle meine Schmerzen, dann rechne alle deine Strafen – Du wirst finden, dass wir quitt sind. |
| III Né pour souffrir, et souffrant – Bas, honni, bête, ignorant, Vieux, laid, chétif – et mourant Dans mon trou sans plainte, Je suis aussi sans désir Autre que d’en bien finir – Sans regret, sans repentir – Sans espoir ni crainte. | III Geboren um zu leiden und leidend – Niedrig, missachtet, dumm, unwissend, alt, hässlich, ärmlich – und klaglos verendend in meinem Loch, habe ich keinerlei anderen Wunsch als es gut zu Ende zu bringen ohne Reue, ohne Bedauern, ohne Hoffnung, ohne Furcht. |
| IV Père inflexible et jaloux, Votre fils est mort pour nous! Aussi, je reste envers Vous Si bien sans rancune, Que je voudrais, sans façon, Faire, au seuil de ma prison, Quelque petite oraison … Je n’en sais pas une! | IV Unerbittlicher und eifersüchtiger Vater, Dein Sohn ist gestorben für uns! Dir gegenüber empfinde ich so wenig Groll, dass ich Dir ohne weitere Umstände auf der Schwelle meines Gefängnisses ein kleines Gebet sprechen würde … Ich kenne keins. |
| V J’entends sonner l’Angélus Qui rassemble Vos Elus: Pour moi, du bercail exclus, C’est la mort qui sonne! Prier ne profite rien … Pardonner est le seul bien: C’est le Vôtre, et c’est le mien: Moi, je Vous pardonne. | V Ich höre das Angelus läuten, das Deine Erwählten versammelt: Für mich, den vom Schoß (der Kirche) Ausgeschlossenen, ist es der Tod, der läutet! Beten nützt nichts … Verzeihen ist das einzige Gute, das Deine und das meine: Ich, ich verzeihe dir. |
| VI Soyez d’un égard pareil! S’il est quelque vrai sommeil Sans ni rêve, ni reveil, Ouvrez m’en la porte – Faites, que l’immense Oubli Couvre, sous un dernier pli, Dans mon corps enséveli, Ma conscience morte! | VI Sei ebenso rücksichtsvoll! Wenn es wirklichen Schlaf gibt, ohne Traum, ohne Erwachen, mach mir die Tür zu ihm auf – mach, dass das unermessliche Vergessen unter einer letzten Falte meines verhüllten Körpers mein totes Bewusstsein bedecke! |
O ich Niete! Was für ein hoffnungsloser Versager war ich im Kleinen wie im Großen!
Teil drei
Ich hatte keine Freunde außer den Lintots und ihren Freunden
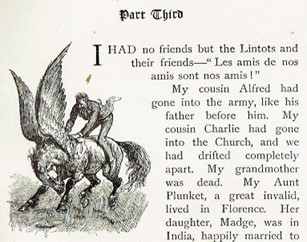
Ich hatte keine Freunde außer den Lintots und ihren Freunden. „Les amis de nos amis sont nos amis.“ [Die Freunde unserer Freunde sind unsere Freunde.]
Mein Cousin Alfred war wie sein Vater vor ihm Soldat geworden. Mein Cousin Charlie war in kirchliche Dienste getreten, und wir waren vollständig auseinander geraten. Meine Großmutter war tot. Meine Tante Plunket lebte sehr krank in Florenz. Ihre Tochter Madge war in Indien glücklich verheiratet mit einem jungen Soldaten, der jetzt ein angesehener General ist.
Die Lintots hielten den Kopf hoch als Vertreter eines liberalen Berufs und als alte Familie von Pentonville! Die Menschen gaben sich meist exklusiv in jener Zeit – eine Exklusivität, die vor allem von den Damen aufrechterhalten wurde. Es gab solche zauberhaften Kreise sogar in Pentonville.
Unter den exklusivsten waren die Lintots. Aus allgemeiner Gerechtigkeit wollen wir hoffen, dass diejenigen, die sie ausschlossen, wenigstens in der Lage waren, andere auszuschließen!
Ich habe ihr Brot und Salz gegessen, und es stünde mir nicht gut an, zu leugnen, dass ihr Kreis ebenso bezaubernd wie bezaubert war. Aber ich hatte nicht die Gabe, mir Freunde zu machen, obgleich ich mich oft von Menschen angezogen fühlte, die mir sehr entgegengesetzt waren, besonders durch kleine, kluge, schnelle aber nicht zu vertraute Männer. Aber selbst wenn sie sich geneigt zeigten, mir entgegen zu kommen, errichtete die elende Schüchternheit und Steifheit meines Verhaltens, gegen die ich nicht ankam, eine Barriere aus Eis zwischen uns.
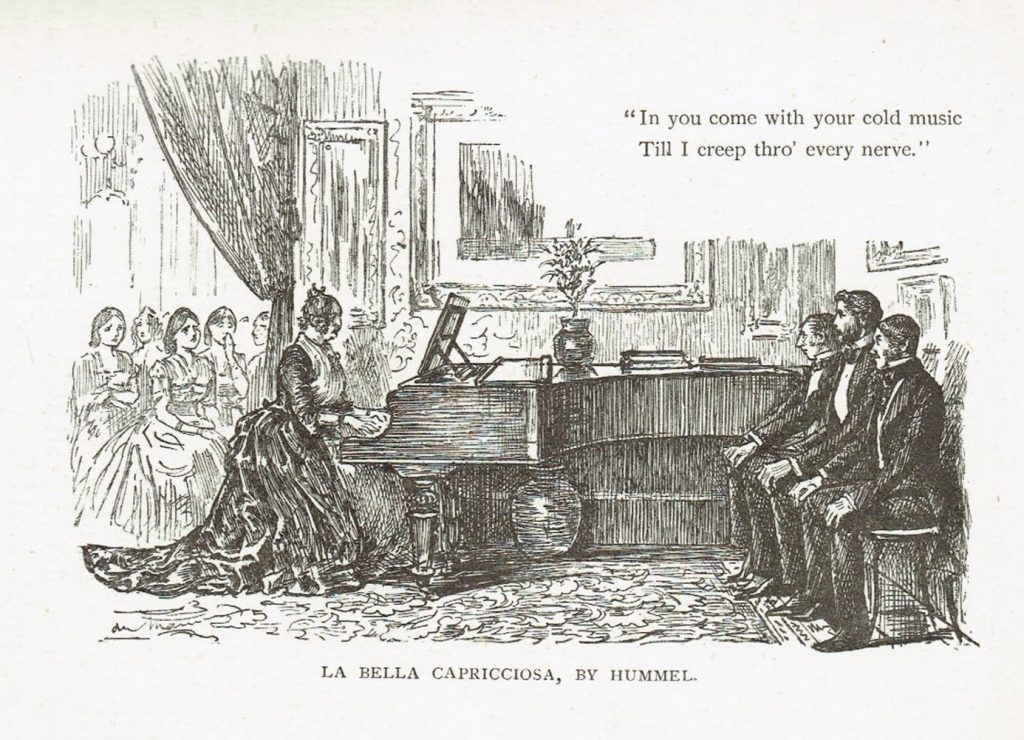
Die guten Lintots waren sehr gastlich, sie hatten viele Freunde und gaben viele Partys, die wirklich zu genießen meine elende Schüchternheit mich hinderte. Sie waren beides: sie zu steif und er zu frei.
Im Salon spielten Mrs. Lintot und ein oder zwei andere Damen, streng gekleidet, die strengste Musik auf eine Weise, die ihre Strenge nicht milderte. Sie waren gnadenlos! Es war fast immer Bach oder Hummel oder Scarlatti, denn alle drei, sagten sie, konnten komponieren wie ein Künstler und ein Gentleman zugleich – eine sehr seltene, aber unerlässliche Kombination, wie es schien.
Andere Damen im jugendlichen und mittleren Alter, und einige junge Männer, denen es die Sprache verschlagen hatte wie mir, wurden als Zuhörer geduldet, aber nicht als Partner oder um selber zu spielen und zu singen.
Wenn man es wagte, um ein „Lied ohne Worte“ von Mendelssohn zu bitten – oder ein Lied mit Text, sogar von Schubert, sogar mit deutschem Text – wurde man zurechtgewiesen und musste erröten ob des Verbrechens musikalischer Frivolität.
In Lintots Büro (von ihm selbst im Garten hinter dem Haus gebaut) waren unterdessen wichtige und wahre Männer bis zur Abendessenszeit beisammen, rauchten, tranken verdünnten Schnaps und redeten über die Arbeit, förmlich zunächst und sehr höflich. Aber allmählich kamen sie einander näher, wurden aufgeknöpfter, ließen das „Mister“ vor dem jeweiligen Namen weg (um es am nächsten Morgen wieder in Kraft zu setzen) und frönten lebhafter Witzelei, die bald persönlich, frei und ausgelassen wurde, eine gutgelaunte Art von Kriegsführung, in der ich aus Mangel an Schnelligkeit und Schlagfertigkeit nicht glänzte. Zum Beispiel fragten sie mich, ob ich lieber ein größerer Narr sein wollte, als ich zu sein schien, oder als ein größerer Narr erscheinen, als ich war; und wie immer ich die Frage beantwortete, es wurde erwidert: „Das ist unmöglich!“ inmitten des brüllenden Gelächters aller bis auf einen.
So dass ich einen Mittelkurs einschlug und den größten Teil des Abends auf der Treppe oder in der Halle verbrachte (wo ich mit einem zu perfekt vorgetäuschten gebannten Interesse, als dass es natürlich aussah) die Fotografien berühmter Kathedralen und öffentlicher Gebäude betrachtete, bis das Abendessen begann; wo ich den Damen so beflissen aufwartete, dass meine elende Existenz erinnert und vergeben und alsbald wieder vergessen wurde, fürchte ich.
Ich hoffe, man sieht mich nicht als eingebildeten Stutzer an, wenn ich sage, dass ich im Ganzen mehr Gefallen an den Damen als an den Herren fand, besonders zur Abendessenszeit.
Nach dem Abendessen gab es einen Wechsel – zum Besseren, dachten manche. Lintot, ermutigt von Beifall und Kollegialität wurde trotz seiner Frau über alle Maßen urkomisch. Er hatte eine Naturbegabung zum Possenreißer. Seine Freunde flüsterten einander zu, Lintot sei „drauf“, und ermunterten ihn. Bach, Hummel und Scarlatti wurden aufs Regal gelegt, und die jungen Leute unterhielten sich gut. Es gab Scherzlieder, Negermelodien und Chorgesang in der Runde. Lintot sang im Stil von Mr. Robson „Vilikins and his Dinah“ so schön, dass selbst Mrs. Lintots ernste Maske sich zu nachsichtigem Lächeln entspannte. Es war unwiderstehlich. Und wenn die Gesellschaft aufbrach, konnten wir (dank unseres Gastgebers) der Gastgeberin herzlich für „einen sehr amüsanten Abend“ danken und ihr aufgeräumt, fast bedauernd, gute Nacht wünschen.
Es tut gut, manchmal zu lachen – weise, wenn man kann; wenn nicht, quocumque modo! Es gibt Zeiten, in denen sogar „das Knacken von Dornen unter einem Topf“ (Like the crackling of thorns under the pot, so is the laughter of fools. This too is meaningless. Prediger 7,6) seinen Nutzen hat. Es scheint den Topf zu wärmen – alle Töpfe, und all ihre Leere, wenn sie denn leer sind.
*****
Einmal allerdings fand ich einen Freund, aber er blieb mir nicht lange erhalten.
Das kam so: Mrs. Lintot gab eine größere Party als üblich. Einer der Eingeladenen war Mr. Moses Lyon, der große Kunsthändler, ein Kunde von Lintot; er brachte den jungen Raphael Merridew mit, Maler, schon berühmt, und der attraktivste junge Mann, den ich je gesehen habe. Klein und schlank, aber von schöner Gestalt, äußerst modisch gekleidet, mit einem hübschen Gesicht, glänzenden und höflichen Manieren und einer unwiderstehlichen Stimme, stand ihm sein Lorbeer gut; auch ohne ihn wäre er umwerfend genug gewesen. Nie waren die gastlichen Türen am Middleton Square einem so glanzvollen Gast geöffnet worden.
Ich wurde ihm vorgestellt, er entdeckte, dass mein Nasenrücken genau zum Gesicht des Sonnengottes auf seinem Bild „Der Sonnengott und die Jungfern der Dämmerung“ passte, und bat mich um die Gefälligkeit von ein oder zwei Sitzungen.
Ich war stolz, einer solchen Bitte stattzugeben, und gewährte ihm viele Sitzungen. Ich pflegte im Morgengrauen aufzustehen, um ihm zu sitzen, bevor meine Arbeit bei Lintot begann; und ihm erneut zu sitzen, sobald ich nicht mehr gebraucht wurde.
Offenbar hatte ich nicht nur die Nase und Stirn eines Sonnengottes (der keine sehr gebildete Person gewesen sein soll), sondern auch die Arme und seinen Körper, und saß auch für die Modell. Seither bin ich auf mich ziemlich eingebildet.
Während dieser Sitzungen, die er reizend machte, fing ich an, ihn zu lieben, wie David Jonathan liebte.
Wir verabredeten, dass wir in einem Hansom zum Derby fahren wollten. Ich mietete schon Tage zuvor den hübschesten Hansom von London. Am Morgen des großen Tages, eines Mittwochs, war ich pünktlich mit ihm an seiner Tür in der Charlotte-Street. Da stand aber schon ein anderer Hansom, ein noch hübscherer als meiner, denn es war ein privater – und Merridew kam herunter und sagte mir, er habe umgeplant und würde mit Lyon fahren, der ihn am Abend zuvor darum gebeten habe.
„Einer der ersten Kunsthändler in London, lieber Freund. Zum Henker, weißt du, ich konnte nicht ablehnen, tut mir schrecklich leid!“
So fuhr ich in einsamer Herrlichkeit zum Derby; aber das schöne Wetter, die Stimmungen des Wegs, all die fröhlichen Szenen waren an mich verschwendet, so verbittert war ich im Herzen.
Am frühen Nachmittag sah ich Merridew auf dem Dach eines Wagens unter eleganten Männern von aristokratischem Aussehen lunchen. Er schien der Mittelpunkt der Gesellschaft zu sein und nickte mir wohlwollend zu, als ich vorbeiging. Bald fand ich Lyon, der untröstlich in seinem Hansom saß, missmutig und einsam; er lud mich ein, mit ihm zu lunchen und offenbarte ein Maß an Verbitterung, das meinem gleichkam (was ich für mich behielt). An die Stelle des gewandten hebräischen Händlers war der warmherzige, verletzte Freund getreten. Merridew hatte Lyon für den Earl of Chiselhurst sitzen lassen, genau wie er mich für Lyon hatte sitzen lassen.
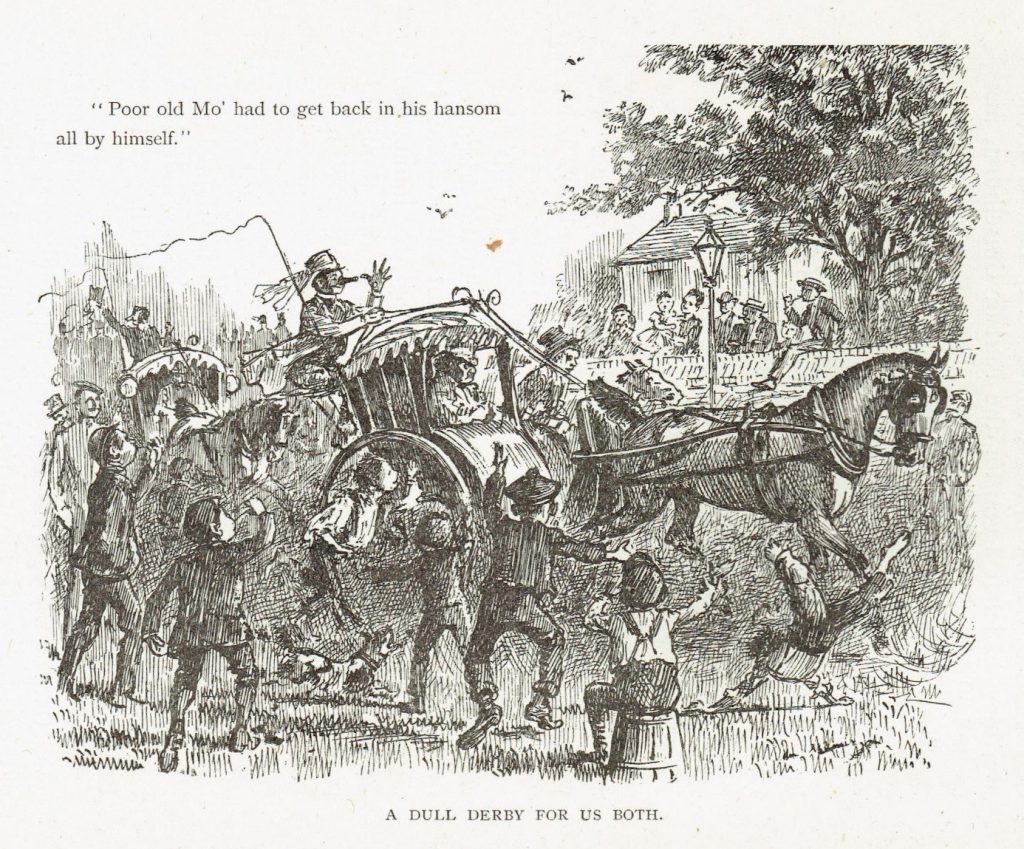
Das war ein trübseliges Derby für uns beide.
Einige Tage später traf ich Merridew, er strahlte wie immer. Alles, was er sagte, war:
„Schande über mich, dass ich Lyon für Chiselhurst sausen ließ, eh! Aber ein Earl, lieber Freund! Zum Henker, weißt du! Der arme alte Mo‘ (Moses) musste in seinem Hansom ganz alleine zurückfahren; aber er hat den Sonnengott trotzdem gekauft.“
Merridew ließ mich bald gänzlich sausen, zu meinem großen Bedauern, denn ich vergab ihm seine Fahnenflucht beim Derby ebenso schnell wie Lyon, und hätte ihm alles vergeben. Er war einer von denen, denen immer gern Nachlass gewährt wird.
Er starb, bevor er dreißig war, armer Junge; aber sein Ruhm wird nie sterben. Der Sonnengott (sogar mit dem Nasenrücken, der so schmerzhaft gekränkt worden war) genügt, um ihn unter den Unsterblichen zu platzieren. Lyon verkaufte das Bild an Chiselhurst für dreitausend Pfund – es hatte ihn fünfhundert gekostet. Es hängt jetzt in der Nationalgalerie.
Die poetische Gerechtigkeit war hergestellt!
*****
Doch auch in der Liebe war ich nicht glücklicher als in der Freundschaft.
Alle Exklusivität der Welt kann gute und schöne Mädchen nicht fernhalten, und an denen fehlte es nicht, auch nicht in Pentonville.
Es gibt immer ein Mädchen, das schöner und besser als alle anderen ist – wie Esmeralda unter den Damen des Hôtel de Gondelaurier. Solch ein Mädchen gab es in Pentonville, oder vielmehr in Clerkenville, ganz in der Nähe. Aber ihr Stand war so niedrig (wie der Esmeraldas), dass auch die am wenigsten Exklusiven vor ihr die Grenze gezogen hätten! Sie stammte aus einer großen Familie, und sie verkauften Kutteln, Schweinefüße und Futter für Katzen und Hunde in einem sehr kleinen Laden gegenüber der Westwand des Gefängnisses von Middlesex. Sie war die älteste Tochter und war die fleißige Verantwortliche hinter diesem armen Ladentisch. Sie war eine der Töchter, eine der Göttinnen von Mutter Natur – eine Königin! Dessen war ich mir immer sicher, wenn ich an ihrem Laden vorbeiging und schüchtern ihren freundlichen, freien, unkoketten Blick erhaschte. Es näherte sich der Zeitpunkt, dass ich meine Schüchternheit überwinden und ihr sagen sollte, dass sie unter allen Frauen diejenige welche sei, und dass es unerlässlich, völlig unerlässlich sei, dass aus uns beiden ein Paar würde – sofort! auf der Stelle! für immer!
Aber bevor ich mich dazu überwinden konnte, heiratete sie jemand anderen, und wir hatten nie ein einziges Wort mit einander gesprochen!
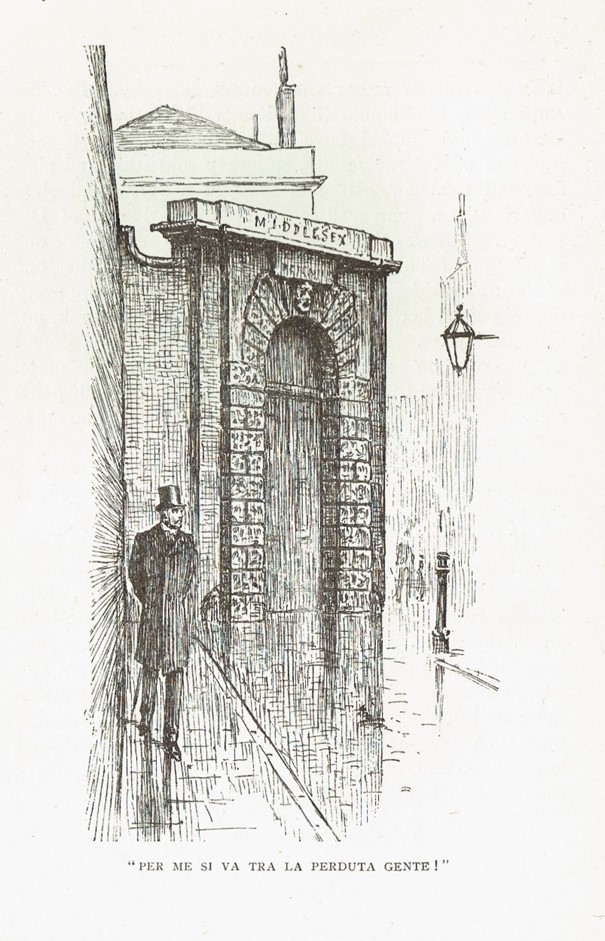
Wenn sie heute noch lebt, ist sie eine alte Frau – eine gute und schöne alte Frau, da bin ich sicher, wo immer sie ist und was immer ihr Rang im Leben ist. Sollte sie dieses Buch lesen, was nicht sehr wahrscheinlich ist, möge sie diesen kleinen Tribut eines ihr unbekannten Bewunderers akzeptieren, für den sie vor vielen Jahren die hässliche Straße verschönte und poetisierte, die immer noch das Gefängnis von Middlesex auf seiner westlichen Seite begrenzt; und möge sie nicht geringer davon denken, weil sein Verfasser seither auf der falschen Seite der langen, kahlen Mauer gelebt hat, von jenem trübseligen Portal, von dem das gequälte Steingesicht herabblickt auf das trostlose Elendsviertel –
„Per me si va tra la perduta gente …!“
(Der Eingang bin ich zum verlornen Volke.
Dante, Inferno, III, 3)
*****
Nach dieser Enttäuschung besorgte ich mir einen großen Hund (wie Byron, Bismarck und Wagner), aber nicht, um sie nachzuahmen. Freilich hatte ich zu jener Zeit weder von Bismarck noch von Wagner noch von ihren Hunden gehört, hatte meine Begeisterung für Byron und jeden Wunsch verloren, ihn in irgendwas nachzuahmen; ich sehnte mich nur nach etwas, was ich lieben konnte und was meine Liebe mit Sicherheit erwiderte.
Als ich ihn kaufte, war er noch kein großer Hund, sondern nur eine orange-braune Fellkugel, die ich auf einem Arm tragen konnte. Ich gab für ihn all das Geld aus, das ich für eine Ferienreise nach Passy gespart hatte. Ich hatte auf einer Hundeausstellung seinen Vater, einen Bernhardiner-Champion, gesehen und das Gefühl bekommen, dass das Leben mit einem solchen Kumpel lebenswert wäre; aber sein Preis belief sich auf fünfhundert Guinees. Als ich den nur sechs Wochen alten unwiderstehlichen Sohn sah und vernahm, dass er nur ein Fünfzigstel vom Preis des Vatertiers kosten sollte, entschied ich, dass Passy warten musste, und wurde sein Besitzer.
Ich gab ihm das Beste, was man für Geld haben kann – täglich drei Viertel Vollmilch für Fivepence das Viertel. Ich kämmte ihm jeden Morgen das Fell aus, wusch ihn dreimal wöchentlich und tötete seine Flöhe einen um den anderen, ein Liebesdienst, den ich ihm jeden Sonnabend erwies, und bemerkte, dass er wöchentlich um eine Rate zwischen sechs und neun Pfund schwerer wurde; und die Stärke seiner Zuneigung wuchs im Quadrat seines Gewichtszuwachses. Ich taufte ihn Porthos, weil er so groß, dick und lustig war. Aber in seinem edlen Welpengesicht und seinen herzergreifend schönen Augen sah ich bereits für sein mittleres Alter die distinguierte und melancholische Großartigkeit voraus, die den erhabenen Athos, Comte de la Fère, auszeichnete. (Figur aus „Die drei Musketiere“ von Alexandre Dumas)
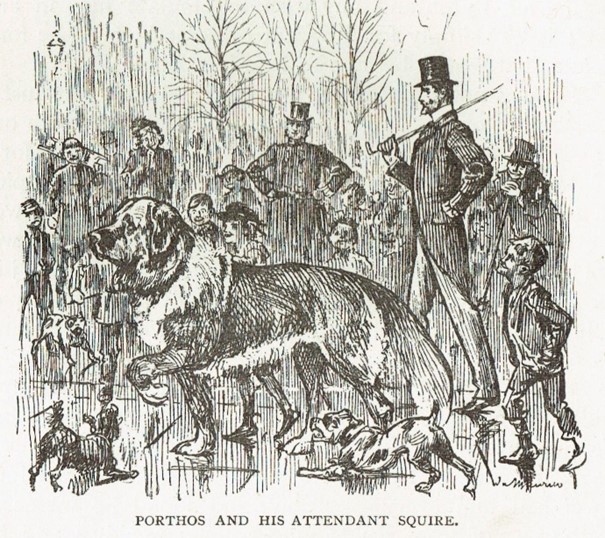
Er war die Freude als solche. Es war schön, abends einzuschlafen in dem Wissen, dass er am Morgen da sein würde. Wann immer wir draußen spazieren gingen, drehten sich alle Leute nach ihm um und bewunderten ihn, fragten, ob er gutartig, was seine besondere Rasse sei und womit ich ihn fütterte. Er wurde monströs groß, ein schönes, verspieltes, anmutig einher trampelndes und zärtliches Monster, und ich, sein glücklicher Frankenstein, beglückwünschte mich zum Besitz eines Schatzes, der mir wenigstens zwölf, vielleicht sogar vierzehn Jahre erhalten bleiben würde bei der Liebe, mit der ich ihn zu pflegen glaubte. Aber mit nur elf Monaten starb er an der Staupe.
Ich weiß nicht, ob man um kleine Hunde, wenn sie sterben, ebenso trauert wie um große. Aber ich beschloss, dass es für mich weder große noch kleine Hunde mehr geben sollte.
*****
Hiernach wandte ich mich dem Schreiben von Versen zu, die ich an Zeitschriften sandte, in denen sie nie erschienen. Sie handelten meist davon, dass eine Melodie mich an Dinge erinnerte, die vor langer Zeit passiert waren: Meine poetische wie meine künstlerische Ader war begrenzt.
Hier sind die letzten, die ich vor dreißig Jahren verfasste. Meine einzige Rechtfertigung dafür, dass ich sie hier einrücke, ist, dass sie so einzigartig prophetisch sind!
Die auslösende Melodie (ein altes französisches Lied vom Glockenschlag, das mein Vater zu singen pflegte), ist sehr einfach und anrührend. Und der alte französische Text lautet
„Orléans, Beaugency!
Notre Dame de Cléry!
Vendôme! Vendôme!
Quel chagrin, quell ennui
De compter toute la nuit
Les heures – les heures!”
(Orléans, Beaugency!
Notre Dame von Cléry!
Vendôme, Vendôme!
Welches Grauen, wenn mir die
Nacht kein Stündchen Schlaf verlieh –
die Stunden – die Stunden!)
Das ist alles. Man muss sich vorstellen, dass sie von einem schlaflosen Gefangenen des Mittelalters gesungen werden, der, um die Langeweile seiner Schlaflosigkeit zu täuschen, alle Worte, die ihm in den Sinn kommen, mit der Melodie des Glockenspiels verbindet, mit dem ein benachbarter Belfried die Stunden markiert. Ich versuchte mir vorzustellen, er hieße Pasquier de la Marière und sei mein Vorfahr.
| THE CHIME | DAS GLOCKENSPIEL |
| There is an old French air, A little song of loneliness and grief – Simple as nature, sweet beyond compare – And sad – past all belief! | Ein altes französisches Lied, singt von Einsamkeit und Schmerz, schlicht und unvergleichlich süß und so traurig, man glaubt es kaum! |
| Nameless is he that wrote The melody – but this much I opine: Whoever made the words was some remote French ancestor of mine. | Keiner weiß, wer die Melodie als erster sang, aber eins weiß ich: den Text muss ein welscher Vorfahr von mir verfasst haben. |
| I know the dungeon deep Where long he lay – and why he lay therein; And all his anguish, that he could not sleep For conscience of a sin. | Ich kenne den tiefen Kerker, in dem er schmachtete, weiß, warum er da lag, kenne seine Angst vor Schlaflosigkeit, denn Reue nagte an ihm. |
| I see this cold hard bed; I hear the chime that jingled in his ears As he pressed nightly, with that wakeful head A pillow wet with tears. | Ich sehe seine kalte Pritsche; höre das Glockenspiel in sein Ohr bimmeln, während er nachts den schlaflosen Kopf ins nassgeweinte Kissen drückte. |
| O restless little chime! It never changed – but rang its roundelay For each dark hour of that unhappy time That sighed itself away. | O ruheloses kleines Glockenspiel! Immer gleich kündete dein Rundgesang jede dunkle Stunde dieser Unglückszeit, die sich selbst hinwegseufzte. |
| And ever, more and more, Its burden grew of its lost self a part – And mingled with his memories, and wore Its way into his heart. | Und immer mehr verwuchs ihre Last mit einem Teil seines verlorenen Selbst, mischte sich mit seinen Erinnerungen und bahnte sich einen Weg in sein Herz. |
| And there it wove the name Of many a town he loved, for one dear sake, Into its web of music; thus he came His little song to make. | Dort verwoben sich die Namen vieler wegen einer einzigen geliebten Städte Mit dem Gewebe der Musik; deshalb dichtete er dies kleine Lied. |
| Of all that ever heard And loved it for its sweetness, none but I Divined the clue that, as a hidden word, The notes doth underlie. | Viele hörten und liebten es ob seiner Süße, aber nur ich erriet den Schlüssel, das verborgene Wort unter den Noten. |
| That wail from lips long dead Has found its echo in this breast alone! Only to me, by blood-remembrance led, is that wild story known. | Die Klage längst toter Lippen hat nur in meiner Brust ein Echo. Nur meiner Bluterinnerung ist jene wüste Geschichte vertraut. |
| And though ‘tis mine, by right! Of treasure-trove, to rifle and lay bare – A heritage of sorrow and delight The world would gladly share – | Es wäre meine Pflicht, den Schatz euch vorzuzeigen, denn dies Erbe von Schmerz und Wonne würde die Welt gern kennenlernen. |
| Yet must I not unfold For evermore, nor whisper late or soon, A secret that a few light bars thus hold Imprisoned in a tune. | Aber warum sollte ich ein Geheimnis für alle Zeit jetzt oder später enthüllen, das einige leichte Takte enthalten, eingesperrt in eine Melodie? |
| For when that little song Goes ringing in my head, I know that he My luckless loan forefather, dust so long, Relives his life in me! | Denn wenn das kleine Lied in meinem Kopf erklingt, weiß ich, dass mein glückloser Vorfahr, längst zu Staub zerfallen, in mir wieder lebt! |
Ich schickte die Verse an –‘s Magazine, mit den sechs französischen Zeilen, auf denen sie aufbauten, an der Spitze. Das Magazin veröffentlichte nur die sechs französischen Zeilen, die einzigen Zeilen in meiner Handschrift, die je in Druck gingen. Und sie stammen aus dem 15. Jahrhundert!
So war mein kleines Lied für die Welt verloren und zeitweise auch für mich. Aber viel, viel später fand ich es wieder, wo Mr. Longfellow einst eines seiner Lieder fand: „im Herzen eines Freundes, einer Freundin“ – sicher der süßeste Quell, den es für ein Lied geben kann.
Ich sah kaum voraus, dass der Tag nicht fern war, an dem wirklich Blutserinnerung mich tragen würde – aber das kommt noch.
*****
Ich hatte in der Dichtung, der Freundschaft und der Liebe versagt, deshalb suchte ich Trost in der Kunst, ging oft in die National Gallery, Marlborough House (wo es die Vernon-Sammlung gab), das Britische Museum, die Royal Academy und andere Ausstellungen.
Ich warf mich nieder vor Tizian, Rembrandt, Velasquez, Veronese, Leonardo, Botticelli, Signorelli – je älter, desto besser; und gab mein Bestes, deren Größe, um die ich wusste und weiß, ehrlich zu empfinden; aber aus Mangel an geeignetem Training vermochte ich jene Höhen nicht zu erreichen und bewunderte sie wie die meisten Nichteingeweihten für die falschen Dinge, nämlich genau für die Schönheiten, die ihnen fehlen – überweltliche, unbeschreibliche Schönheiten der Gesichtszüge, der Form und des Ausdrucks, nach denen der Uneingeweihte immer bei den alten Meistern sucht, oft redet er sich ein, er finde sie dort – und noch häufiger täuscht er es vor!
Ich war weitaus bewegter (auch wenn ich es nicht zu sagen wagte) von einige Werken unserer Zeit, zum Beispiel durch das „Tal der Ruhe“, die „Herbstblätter“, den „Hugenotten“ des jungen Millais – desgleichen waren mir Gedichte wie Maud und In Memoriam von Alfred Tennyson unendlich viel teurer und lieber als Miltons Verlorenes Paradies und Spensers Faerie Queene.
Ja, ich war hoffnungslos modern in jener Zeit – eben ein rechter Alltagsjüngling. Die Namen, die ich am tiefsten verehrte, waren die von noch lebenden Männern und Frauen. Darwin, Browning und George Eliot, das ist wahr, existierten für mich noch nicht, aber Tennyson, Thackeray, Dickens, Millais, John Leech, George Sand, Balzac, der ältere Dumas, Victor Hugo und Alfred de Musset!
Ich bin ihnen im richtigen Leben nie begegnet; aber wie alle Welt kenne ich ihr Aussehen gut und würde eine strenge Prüfung, in der es um das geht, was sie geschrieben, gezeichnet oder gemalt haben, bestehen.
Andere Sterne der Größe sind inzwischen aufgegangen; aber von der alten Galaxie scheinen wenigstens vier noch mit unverdunkeltem Glanz aus der Vergangenheit in meine Augen – Thackeray, der liebe John Leech, der immer noch die Kraft hat, mich lachen zu machen, wie ich zu lachen liebe. Und für die beiden anderen ist klar, dass die Queen, die Welt und ich einer Meinung sind, was ihre Verdienste betrifft, denn einer von ihnen ist jetzt eine Zierde des britischen Adels, der andere ein Baron und Millionär, nur dass ich sie sofort zu Herzögen gemacht und über den Erzbischof von Canterbury gestellt hätte, wenn sie denn Wert darauf gelegt hätten.
Mit vollem, aber demütigem Herzen wage ich so, meine lange Verschuldung schriftlich niederzulegen und diesen kleinen Tribut zu entrichten, noch frisch aus den Tagen meiner bedingungslosen Heldenverehrung. Das hilft meinem Leser (falls ich je einen habe, der sich hinreichend dafür interessiert), zu erkennen, unter welchen geistigen Längen- und Breitengraden derjenige wohnte, der für eine so einzigartige Erfahrung ausersehen war – eine Art von Quellenangabe sozusagen – damit er mir auf einen Blick einen Platz zuweisen kann, entsprechend der Wertschätzung, die er diesen berühmten und vielleicht unsterblichen Namen entgegenbringt.
Man wird wenigstens zugeben müssen, dass mein Geschmack der normale war und von einer großen Mehrheit geteilt wurde – der Geschmack eines Allerweltsjünglings jenes besonderen Abschnitts des 19. Jahrhunderts – der sich für Sport und kalte Bäder begeisterte, für leichte Lektüre und billigen Tabak, und der mit der üblichen Unzufriedenheit ausgestattet war; die letzte Person, von der oder für die man irgendetwas Ungewöhnliches erwartet hätte.
*****
Aber der Glanz der Elgin Marbles! Ich begriff ihn sofort – vielleicht, weil es da so viel nicht zu begreifen gibt. Schöne Menschen, auch wenn sie nur körperlich schön sind, fesseln uns alle, ob in Wirklichkeit oder aus Marmor.
Durch irgendeine merkwürdige Eingebung oder einen natürlichen Instinkt wusste ich, dass Menschen so gebaut sein sollten, bevor ich je eine einzige Statue in diesem wundersamen Raum gesehen hatte. Ich hatte sie vorausgeahnt – so vollkommen verkörperten sie ein ästhetisches Ideal, das ich immer gefühlt hatte.
Wenn ich durch die Londoner Straßen ging, habe ich sie oft mit einigen hundert Wesen meiner eigenen Vorstellungswelt bevölkert, gemacht aus Fleisch und Blut, und habe sie mir vorgestellt als ein wohltätige Aristokraten von sieben Fuß Größe, mit Gesinnungen und Sitten, die zu ihrer physischen Erscheinung passten und habe sie über den Rest der Welt gestellt zu deren Wohl; denn ich fand es notwendig (damit mein Traum auch eine Pointe hatte) sie mit einem Hintergrund von Millionen solcher Leute zu versehen, wie wir sie jeden Tag sehen. Ich war egoistisch und selbstsucherisch genug, das ist wahr, mich selbst unter die ersteren einzureihen, und hatte für meinen eigenen Gebrauch, meine Bekleidung gerade eine solche Gestalt wie die des Theseus ausgesucht, natürlich mit Nase, Händen und Füßen (derer die Zeit ihn beraubt hat) wieder hergestellt, und alle Verstümmelungen behoben.
Und zu meiner Geliebten und Begleiterin hatte ich ordnungsgemäß keine geringere Person als die Venus von Milo (nicht länger armlos) ausgesucht, von der Lintot einen Gipsabguss besaß und deren Schönheiten ich vorausgesehen hatte, bevor ich sie je mit meinem leiblichen Auge sah.
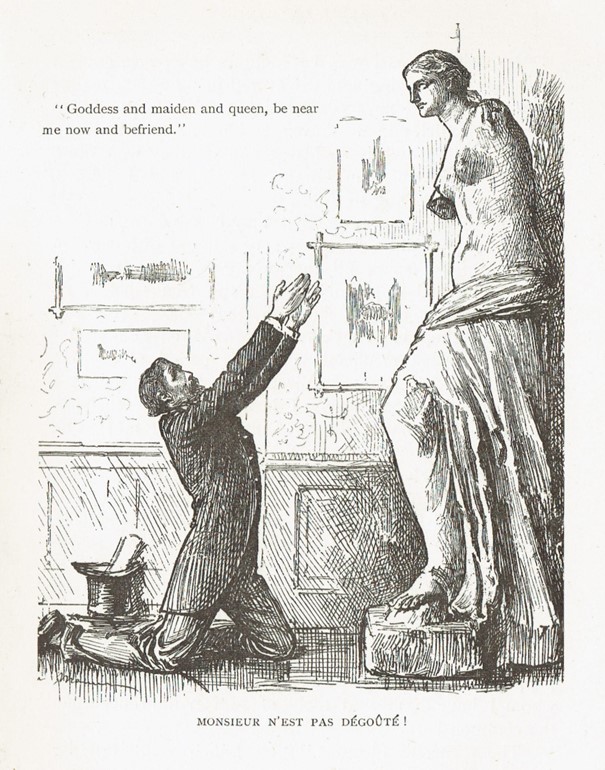
„Monsieur n’est pas dégoûté!“ (Der Herr ist nicht angewidert!) hätte Ibbetson bemerkt.
*****
Aber am meisten lechzte ich nach Musik, die göttlich ist.
Aber ach, der Eintritt in Konzerte, Opern- und Oratorienaufführungen ist für den Unbemittelten nicht frei wie der in die Nationalgalerie und das Britische Museum! – ein Privileg, das nicht missbraucht wird!
Mittellos wie ich war, hatte ich doch manchmal Pence genug, um dies Verlangen zu befriedigen, und mit der Zeit entdeckte ich Königreiche der Freude, von denen ich mir nie hätte träumen lassen; Könige wie Mozart, Händel und Beethoven, und andere, von denen mein Vater offensichtlich wenig gewusst hatte; und dennoch waren sie noch größere Zauberer als Grétry, Hérold und Boieldieu, deren Arien er so schön sang.
Darüber hinaus entdeckte ich, dass sie mehr konnten als bezaubern. Sie konnten mein überdrüssiges Selbst aus meiner überdrüssigen Seele vertreiben und diese überdrüssige Seele für einen Zeitraum mit Kraft, Demut und Hoffnung erfüllen. Kein Tizian, kein Shakespeare, kein Phidias hätten das je vermocht – nicht einmal Mr. Makepeace Thackeray oder Mr. Alfred Tennyson.
Meine süßesten Erinnerungen aus dieser Zeit meines Lebens (ja, die einzigen süßen Erinnerungen) kreisen um die Musik, die ich hörte und die Orte, an denen ich sie hörte; das war Entzücken! Mit welcher Lebhaftigkeit ich es heraufrufen kann! Die tagelange große Vorfreude; die sorgfältige Auswahl vorweg aus dem embarras de richesses, (Qual der Wahl unter Schätzen), wie er rechtzeitig angekündigt wurde; dann das lange Warten auf der Straße vor den Türen, die für diejenigen reserviert sind, die einen Platz auf der Galerie haben. Der hart erkämpfte Sitz droben wird schließlich nach einem eigennützigen aber gutgelaunten Kampf die lange Steintreppe hinauf (man hat Mitleid mit den Schwachen, aber ein ausgehungertes Ohr kennt kein Gewissen) schließlich erreicht. Das fröhliche und glänzende Haus ist gestopft voll; der riesige Kronleuchter ist ein Feuerbrand; erwartungsvolles Entzücken liegt in der Luft, außerdem der Geruch nach Gas, Pfefferminz und Orangenschalen; und der einer Musik liebenden Menschheit, die süßer riecht, wie ich entdeckt habe, als die allgemeine Herde.
Das Orchester trifft ein, einer um den anderen; die Instrumente stimmen – eine vertraute Kokophonie, süß von verführerischer Verheißung. Der Dirigent nimmt seinen Platz ein – Applaus – Stille – drei Schläge, der Stab hebt und senkt sich einmal, zweimal, dreimal – der ewige Quell des Zaubers wird entfesselt, und beim ersten Strahl
„The cares that infest the day
Shall fold their tents like the Arabs,
And as silently steal away.”
(Die Sorgen, die den Tag heimsuchen,
sollen ihre Zelte wie Araber zusammenfalten
und sich leise davonschleichen.
Henry Wadsworth Lonfgellow: The Day is Done)
Und siehe! der Vorhang hebt sich, und wir sind geradeswegs in Sevilla – Sevilla – nach Pentonville! Graf Almaviva, edel, galant und vergnügt unter seiner Maske, lässt seine Gitarre erklingen, und was für Töne er ihr entlockt! Denn jedes Instrument, das je erfunden wurde, ist in dieser Gitarre – das gesamte Orchester!
„Ecco ridente il cielo …“ (Sieh den lachenden Himmel) So singt er (mit der schönsten Männerstimme seiner Zeit) unter Rosinas Balkon; und bald ist auch Rosinas Stimme (die schönste Frauenstimme ihrer Zeit) zu hören hinter ihrer Gardine – so mädchenhaft, unschuldig, so jung und leichtherzig, dass die Augen sich mit unfreiwilligen Tränen füllen.
So ermutigt, trällert er, sein Name sei Lindoro und dass er sie gern heiraten würde; dass er keine großen weltlichen Reichtümer habe, aber mit unmäßiger, unerschöpflicher Liebeskraft begabt sei (wie Peter Ibbetson); und schwört ihr, er wolle immer auf diese Weise trällern für sie – von der Morgendämmerung, bis das Tageslicht hinter den Bergen versinkt. Aber was bedeuten schon Worte?
„Weiter so, Liebster, weiter genauso!“ trällert Rosina zurück – kein Wunder – bis das dumpfe, bedrückte Alltagsherz von Peter Ibbetson für nichts anderes mehr Platz hat als für sonnige Hoffnung, Liebe und Freude! Und dennoch ist alles bloßer Schall – unmöglicher, unnatürlicher, unwirklicher Unsinn!
Oder anders: In einem quadratischen Gebäude, ordentlich und gut genug erleuchtet, aber sonst wenig bemerkenswert, einem wahren Gotteshaus der Musik, nehmen vier geschäftlich aussehende Herren, modern gekleidet, Brillen, begleitet von gedämpftem Applaus, Platz auf einer schlichten Plattform; und bald vibriert die ruhige Luft vom Schwingen von sechzehn Saiten – nur das und nicht mehr!
Aber darin steckt alles, was Beethoven oder Schubert oder Schumann uns im Augenblick zu sagen hat – und was für ein Sagen ist das! Und mit welch einer großartigen Genauigkeit und Perfektion es gesagt wird – mit welcher mathematischen Bestimmtheit; und zugleich mit welcher Artigkeit, Würde, Anmut und Vornehmheit!
Sie sind die vier bedeutendsten Quartettspieler der Welt – vielleicht; aber sie vergessen sich selbst, und wir vergessen sie (was ihrem Wunsch entspricht) über den Meister, dessen Werk sie so andachtsvoll zu Gehör bringen, dass wir mit seinem gewaltigen Begehren schmachten, zittern mit seiner Hingerissenheit, seinem Triumph, oder leiden mit seiner himmlischen Pein und uns unterwerfen seinem göttlichen Verzicht.
Alle Wörter in allen Sprachen der Welt – verbinde sie, reime sie, alliteriere sie, quäle sie, soviel du willst – können niemals in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele vordringen und einen Funken des Unendlichen hineinlassen, wie es die unartikulierten Schwingungen dieser sechzehn Saiten tun.
Ja, Lieder ohne Worte sind die besten Lieder!
Dann setzt sich ein zigeunerartiger kleiner Kerl, drahtig und ungekämmt, der aussieht, als ob er sein Leben damit verbracht hätte, auf die Stimmen der Nacht in nur der Himmel weiß welchen litauischen Wäldern zu lauschen, mit Wölfen und wilden Ebern als seinen Vertrauten und dem Wind in den Bäumen als seinem Lehrer, dieser kleine Kerl also setzt sich an das messingbeschlagene eichene Broadwood-Pianoforte. Und unter seinen phänomenalen Fingern atmet sich ein unvergesslicher, zarter Weltschmerz voller Fragen – ein dunkles Mysterium von mondloser, sternheller Natur – aus in Nocturnes, in Impromptus, in Préludes, sogar in bloße Walzer und Mazurken! Aber Walzer und Mazurken, nach denen die Frivolsten auch im Traum nicht würden tanzen wollen. Eine launische, bezaubernde Trauer – nicht zu tief für Tränen, wenn man überhaupt geneigt sein sollte, sie zu vergießen – so filigran, so frisch und doch so vornehm, so himmlisch gesittet, weltlich und wohlerzogen, dass es sich in eine Salonekstase auskristallisiert hat, die ewig anhält. Es scheint, als ob das, was für ihn, der es fühlte, Tod (oder Sterbehilfe) war, für uns ein Spiel sei – sicherlich ein unsterblicher Schmerz, dessen Wiedergabe niemals, niemals schal werden wird – die Trauer von Chopin.
Obgleich wir nicht einmal erraten können, warum Chopin so traurig gewesen sein sollte; Trauer um der Trauer willen vielleicht; der bloße Luxus des Schmerzes – die wirkliche Trauer, die keinen wirklichen Grund hat (wie meine in jenen Tagen); und das ist die beste und billigste Art von Trauer überhaupt, um daraus Musik zu machen!
Und dieser großartige kleine Zigeunerpianist, der seinen Chopin so ausgezeichnet spielt, offenkundig hat er sein Leben nicht in litauischen Wäldern verbracht, sondern Tag und Nacht fest am Klavier; und er hatte einen besseren Lehrer als den Wind in den Bäumen, nämlich Chopin selbst (so steht es im Programmheft). Es waren sein Vater und seine Mutter vor ihm und ihre Vorfahren, die die Stimmen der Nacht hörten; aber er erinnert all das, legt es alles in die Musik seines Meisters, so dass auch wir uns erinnern.
Oder betrachte den Chor, der Schicht auf Schicht häuft und in der riesigen Orgel kulminiert. Aber deren Donner ist gerade verstummt.
Eine liliputanerhafte Gestalt, je nachdem männlich oder weiblich, erhebt sich auf ihren kleinen Beinen inmitten des großen liliputanischen Gewimmels, und aus der heiligen Stimme läutet eine vollkommene Stimme hervor (die in keiner Weise liliputanisch ist). Sie bittet uns „Ruhet im Herrn“, oder sie erzählt uns, dass „er verschmäht und zurückgewiesen wurde von den Menschen“; aber noch einmal: Was bedeuten schon Worte? Sie sind fast nur ein Hindernis, so schön sie auch sein mögen.
Die verhärtete Seele schmilzt unter den Tönen des Sängers, unter dem unaussprechlichen Pathos der Laute, die nicht lügen können; man glaubt beinahe – man glaubt wenigstens an den Glauben der anderen. Zuletzt versteht man und ist gereinigt von Intoleranz und zynischer Verachtung, und würde mit allen anderen hinknien aus rein menschlicher Sympathie!
O elender Außenseiter, der man ist (wenn das alles wahr ist) – einer, dessen Herz für das geschriebene Wort so hoffnungslos unerreichbar ist, der so hilflos gleichgültig ist für die gesprochene Botschaft und nur berührt werden kann durch die organisierten Schwingungen eines trainierten Kehlkopfs, einer metallenen Pfeife, eines Rohrblatts, einer Geigensaite – durch unsichtbare, unfühlbare, unbegreiflich kleine Luftschwingungen in mathematischem Verhältnis, die auf eine winzige Trommel im Ohrinnern treffen. Und diese mathematischen Verhältnisse und die Gesetze, die sie regieren, gab es schon immer, vor Moses, vor Pan, lange bevor weder ein Kehlkopf noch ein Trommelfell sich je entwickelt hatte. Sie sind absolut!
O Geheimnis der Geheimnisse!
Euterpe, Muse der Musen, welch eine Persönlichkeit bist du geworden, seit du zum ersten Mal Modell saßest für dein Bildnis (mit der lächerlichen Lyra in den ungeschickten Händen) für einen griechischen Bildhauer, der so viel besser meißeln konnte als du spielen!
Vier Saiten; aber nicht die berührbaren Saiten einer Stradivari. Nein, Verzeihung – fünf; denn deine Tonleiter, glaube ich, war pentatonisch. Orpheus selbst hatte keine bessere, das ist wahr. Mit einem solchen Instrument zauberte er seine Eurydike so gut wie aus dem Hades. Aber ach, sie kehrte zurück; bei näherem Nachdenken zog sie den Hades vor!
Wie konntest Du das Herz entzünden, rasend machen und auspressen und es dann schmelzen, trösten und bezaubern in einen Frieden hinein, der alle Vernunft übersteigt, allein mit fünf elementaren Noten und nichts dazwischen?
Konntest du aus jenen fünf Tönen gleicher, unveränderlicher Tonlage nicht etwa einen sechsten Ton, sondern einen Stern machen?
Was waren das für fünf Töne? „Do, re, mi, fa, sol?“ Woraus haben deine Lieder ohne Worte bestanden, wenn du denn je welche anstimmtest?
Du warst ein rechtes Alltagsfräulein in jenen Tagen, Euterpe, während deine acht Zwillingsschwestern bereits erwachsen und dem Hause waren; und nun übertriffst du sie alle um wenigstens einen halben Kopf. „Tu leur mangerais des petits pâtés sur la tête – comme Madame Seraskier!“
Und o, wie du sie an Schönheit alle übertriffst! Nach meiner Einschätzung zumindest – wie – wie wiederum Madame Seraskier!
Und hast du mit Wachsen schließlich aufgehört?
Nein fürwahr; du bist noch nicht einmal ein Alltagsfräulein – du bist nur ein süßes Baby, ein Jahr alt und sieben Fuß groß, taumelnd zwischen einem gesegneten Himmel, den du gerade verlassen hast, und der öden Heimat von uns armen Sterblichen.
Das süße einjährige Baby unserer Sippe legt seine Hände auf unsere Knie und blickt auf in unsere Augen mit Augen voll unsäglicher Bedeutsamkeit. Es hat so viel zu sagen! Es kann nur „ga-ga“ und „ba-ba“ sagen; aber mit einer wie sehr suchenden Stimme, mit einem wie sehr berührenden Blick – natürlich nur für jemanden, der Babys mag! Wir sind bis ins innerste bewegt; wir möchten verstehen, denn es betrifft uns alle; wir waren einmal selbst genauso – der Einzelne und die Rasse – aber wir können uns um keinen Preis erinnern.
Und was kannst du uns noch sagen, Euterpe außer deinem „ga-ga“ und „ba-ba“, der unartikulierten Süße, die wir fühlen, aber nicht verstehen können? Aber wie schön es ist – und was für einen Blick du hast, was für eine Stimme – für den, der Musik mag!
„Je suis las des mots – je suis las d’entendre
Ce qui peut mentir;
J’aime mieux les sons, qu’au lieu de comprendre,
Je n’ai qu’à sentir.“
(Ich bin die Worte leid, bin leid,
Lügen zu hören;
ich bevorzuge die Töne, damit ich, statt zu verstehen,
nur zu fühlen habe.“
Sully Prudhomme, l’agonie)
*****
Am nächsten Tag würde ich die Musik, die mich mit so viel Gefühl und Entzücken beschenkt hatte, kaufen, leihen oder ausbitten, sie mit nach Hause nehmen zu meinem kleinen Tafelklavier und versuchen, es mit eigenen Fingern zusammenzuklimpern. Aber ich hatte zu spät damit angefangen.
Sehnsüchtig und hilflos vor einem Instrument zu sitzen, das man nicht spielen kann, mit einer reizenden Partitur, die man nicht lesen kann! Selbst Tantalus blieb eine solche Prüfung erspart.
Es erscheint unwahrscheinlich, dass mein lieber Vater, meine liebe Mutter, die selbst so musikbewandert waren, mir die Musiknoten nicht beigebracht haben sollen in einem Alter, in dem es mir so leicht gefallen wäre, sie zu lernen; sie hätten mich befreit von der Wunderwelt des Klangs, an der ich ein so außergewöhnliches Entzücken fand, und in der ich es – vielleicht – zu Ansehen gebracht hätte.
Aber nein, mein Vater hatte mich schon vor meiner Geburt der Göttin der Wissenschaft geweiht, damit ich eines Tages besser gerüstet sei für die Verfolgung, Eroberung und Nutzbarmachung der tieferen Geheimnisse der Natur. Es sollte kein Tändeln mit leichten Musen geben. O weh! Ich bin zwischen zwei Stühle geraten!
Und so, in ihrer Abwesenheit, verblasste die Bezauberung durch Euterpe. Ich hatte ihre Handschrift vor mir, aber ich hatte nicht gelernt, sie zu entziffern, und mein erschöpftes Selbst verkroch sich wieder in seinem alten Gefängnis – meiner Seele.
Self-sickness – Selbstschmerz (deutsch im Or.) – le mal de soi! Was für eine Krankheit! Sie findet sich in keinem Wörterbuch, egal ob medizinisch oder allgemein.
Ich hätte dafür ausgepeitscht werden müssen, das weiß ich; aber niemand war groß oder freundlich genug, um es zu tun!
*****
Auf die Dauer kam der Tag, an dem mein müdes, schwaches und höchst lächerliches Selbst ausgetrieben und für immer exorzisiert wurde von einem noch mächtigeren Zauber, als Händel oder Beethoven oder Schubert ihn ausübten!
Es gab einen gewissen Lord Cray, für den Lintot einige Arbeiterhäuser in Hertfordshire gebaut hatte, und ich ging manchmal dorthin, um die Arbeiter zu beaufsichtigen. Als die Häuser fertig waren, kamen Lord Cray und seine Frau (eine sehr charmante Dame mittleren Alters) zur Besichtigung, waren sehr angetan von allem, was gemacht worden war, und schienen auch großes Interesse ausgerechnet an mir unter allen Erdenkindern zu finden! und Einige Tage später erhielt ich eine Einladung zu einem Konzert in ihrem Stadthaus.
Zuerst fühlte ich mich zu schüchtern, um hinzugehen; aber Mr. Lintot bestand darauf, es sei meine Pflicht, hinzugehen, weil es zu weiteren Aufträgen führen konnte; so dass ich, als der Abend kam, meinen Mut bis zum Punkt des Halts schraubte (Shakespeare Macbeth I,7) und ging.
Der Abend war reines Entzücken oder wäre es gewesen ohne das irgendwie schmerzliche Gefühl, dass ich ein solcher Außenseiter war.
Aber ich war immer völlig damit zufrieden, der am wenigsten Beobachtete aller Beobachter zu sein, und fühlte mich glücklich in der Gewissheit, dass ich hier wenigstens in Ruhe gelassen werden, dass kein völlig Fremder versuchen würde, zu meiner Behaglichkeit beizutragen, indem er mich zur Zielscheibe freundschaftlicher und familiärer Neckerei machte; dass kein Herzog mit Hosenband oder Earl mit Gürtel (zweifellos waren sie so zahlreich anwesend wie Brombeeren, obgleich sie ihre Insignien nicht trugen) mir auf die Schulter klopfen und mich fragen würde, ob ich lieber wie ein größerer Narr aussehen wollte, als ich einer war, oder lieber ein größerer Narr sein, als ich aussah. (Ich habe bisher keine schlagfertige Antwort auf diese Frage gefunden, weshalb sie mich so sehr wurmt.)
Ich hatte oft gehört, dass die Engländer ein steifes Volk seien. Bei Lady Cray schien es keine Steifheit zu geben; noch gab es irgendwelche Scherzhaftigkeit; man fühlte sich wohl, wenn man die Anwesenden nur ansah. Sie waren überwiegend groß, stark, gesund, ruhig und gut gelaunt; hatten weiche und angenehm gedämpfte Stimmen. Die großen, gut erleuchteten Räume waren weder heiß noch kalt; es gab schöne Bilder an den Wänden, und aus einem riesigen Wintergarten drang erlesener Blumenduft. Ich war nie auf einer solchen Zusammenkunft gewesen; alles war neu und überraschend und, ich gestehe es, sehr nach meinem Geschmack. Es war mein erster flüchtiger Eindruck von „Gesellschaft“; und der letzte – aber immerhin einer!
Es gab Mengen von Leuten – aber keine Menge; alle schienen alle recht gut zu kennen und Gespräche wieder aufzunehmen, die sie irgendwo sonst vor einer Stunde begonnen hatten.
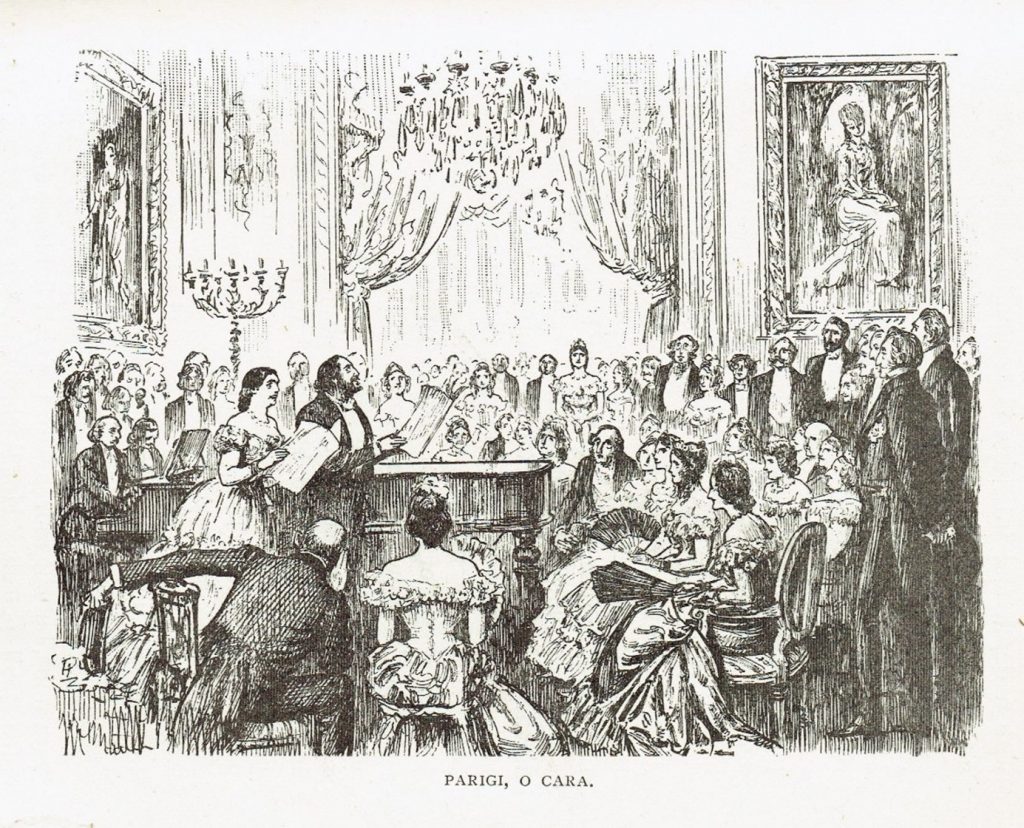
Im Moment verstummten diese Gespräche, die Grisi und Mario sangen! Ich tat alles, was ich konnte, um meine Begeisterung und mein Entzücken zu bändigen. Fast wäre es laut aus mir herausgebrochen und ich hätte selbst gesungen!
In der Mitte des Beifalls, der auf dieses himmlische Duett folgte, betraten eine Lady und ein Gentleman den Raum, und beim Anblick der Lady erwachte ein neues Interesse in meinem Leben; all die halb vergessenen Gefühle stummer Pein und Hingerissenheit, die die Schönheit von Madame Seraskier mir als Kind zu vermitteln pflegte, lebten wieder auf; aber mit einer Tiefe und Intensität, die sich dazu verhielt wie der Bariton eines erwachsenen Mannes zum Sopran eines kleinen Jungen.

Es war der schnelle, scharfe, grausame Stich, der coup de poignard (Dolchstoß), die eine Schönheit der offensichtlichsten, gleichwohl subtilen, vollendeten und hoch organisierten Größenordnung einem sorgfältig vorbereiteten Opfer versetzen kann.
Und ein wie sorgfältig vorbereitetes Opfer war ich! Ein armer, schüchterner, überempfänglicher, jungfräulicher Wilder – Unkas, der Sohn von Chingachgook, verirrt zum ersten Mal in einen eleganten Londoner Salon.
Ein keuscher mittelalterlicher Ritter, außerhalb der ihm gebührenden Zeit geboren, asketisch aus Ehrerbietung und Ekel, für den die Frau im Abstrakten die einzige Religion, im Konkreten die Ursache für fünfzig Ernüchterungen am Tag war!
Ein gesunder, liebeshungriger, warmblütiger Heide, gestrandet in der Mitte des 19. Jahrhunderts; in den ein seltsamer ererbter Instinkt eine endgültige, vollständige und bis ins Einzelne ausgeführte Vorstellung gepflanzt hatte davon, wie die ewiggeliebte Gestalt des Weibes sein sollte – von der Art, wie das Haar aus ihrer Stirn, den Schläfen und dem Nacken zu sprießen hatte, abwärts zu dem Rhythmus, der die Größe, Wölbung und Position jedes einzelnen individuellen Zehs regelte! Und der stolz und entzückt herausgefunden hatte, dass sein vorgefasstes Ideal dem des Phidias so nahe kam, als hätte er in der Zeit von Perikles und Aspasia gelebt.
Denn so war dieser armselige Schreiberling, und so war er von Kindesbeinen auf gewesen, bis diese schöne Lady zum ersten Mal in seinen Gesichtskreis schwamm.
Sie war so groß, dass wir uns fast auf gleicher Augenhöhe begegneten, aber sie bewegte sich mit der flinken Leichtigkeit und Grazie einer kleinen Person. Ihr dickes, schweres Haar war von einem dunklen Kupferbraun; ihre Hautfarbe hell und blass, ihre Brauen und Wimpern schwarz, ihre Augen ein helles Blaugrau. Ihre Nase war kurz und schmal und ziemlich schräg an der Spitze, ihr roter Mund groß und sehr beweglich; und hier wich sie von meinem vorgefassten Ideal ab und bewies mir, wie zahm es war. Ihr vollkommener Kopf war klein, und um ihre lange, dicke Kehle schlangen sich zwei unbedeutende parallele Falten und erzeugten le collier de Vénus, wie französische Bildhauer es nennen; die Haut ihres Nackens glich einer weißen Kamelie, und schlank und breitschultrig, wie sie war, zeigte sie doch keinen einzigen Knochen. Sie gehörte dem schönen Typus an, den die Franzosen la fausse maigre nennen, was nicht „falsch-dünne Frau“ bedeutet.
Sie schien nachdenklich und fröhlich zugleich und so freundlich, wie ich noch nie jemand erlebt hatte – eine Person, der man vertrauen, der man all seine Kümmernisse erzählen konnte, sogar ohne Einleitung! Wenn sie lachte, zeigte sie Ober- und Unterzähne, die makellos waren, ihre Augen schlossen sich beinahe, so dass man sie durch die dichten Wimpern, die Ober- und Unterlid säumten, nicht mehr sehen konnte; in diesem Moment war der Ausdruck ihres Gesichts so leidenschaftlich und grausam süß, dass er einen wie ein Messer durchschnitt. Dann würde ihr Lachen plötzlich enden, ihre vollen Lippen würden sich schließen, und ihre Augen würden wieder hervorstrahlen wie zwei sanfte graue Sonnen, wohlwollend heiter und freundlich fragend voller Interesse an allem und jedem um sie her. Aber dort – ich kann sie nicht besser beschreiben, als man eine schöne Melodie beschreiben kann.
Aus jenen herrlichen Kugeln strömten Freundlichkeit, Güte und Menschenliebe wie ein Balsam; und nach einer Weile wurde dieser Balsam zufällig für wenige Augenblicke zu meiner süßen aber schrecklichen Bestürzung auf mich verströmt. Dann sah ich, dass sie meine Gastgeberin fragte, wer ich sei, und die Antwort erhielt; woraufhin sie ihren Balsam auf mich noch einen Augenblick länger ergoss und mich aus ihren Gedanken entließ.
Die Grisi sang wieder – Desdemonas Arie aus Othello – und die schöne Lady dankte der göttlichen Sängerin, die sie ganz genau zu kennen schien; und ich fand ihre – italienischen – Dankesbezeugungen noch göttlicher als die Arie – nicht dass ich sie verstehen oder auch nur gut hören konnte – ich war zu weit weg; aber sie dankte mit Augen, Händen und Schultern – leichten, glücklichen Bewegungen – so gut wie Worte; sicherlich die süßesten und aufrichtigsten Worte, die je gesprochen wurden.
Sie wurde viel umringt und beachtet – war offenbar eine Person von großer Bedeutung; ich wagte einen anderen schüchternen Mann, der mit mir in derselben Ecke stand, zu fragen, wer sie war, und er erwiderte –
„Die Herzogin von Towers.“
Sie blieb nicht lange, und als sie ging, wurde alles trüb und alltäglich, was vorher so licht erschienen war, bevor sie kam; und als ich sah, dass es nicht nötig war, mich von meiner Gastgeberin zu verabschieden und ihr für den schönen Abend zu danken, wie es in Pentonville üblich war, verließ ich das Haus und kehrte an meine Wohnstatt zurück – als ein gewandelter Mann.
Ich würde diese liebliche junge Herzogin wahrscheinlich nie wieder sehen; aber ihr Pfeil war direkt und wahrhaftig mitten in mein Herz eingedrungen, und ich spürte, mit einem wie scharfen Widerhaken er ausgestattet war – es bestand keinerlei Möglichkeit, ihn je wieder aus der gesegneten Wunde zu entfernen; möge sie niemals heilen; möge sie bluten für immer!
Sie sollte das ideal meines einsamen Lebens sein, für das ich in Gedanken, in Wort und Tat leben wollte. Ein Instinkt, dessen Unfehlbarkeit ich spürte, sagte mir, dass ihre Güte ihrer Schönheit gleichkam –
„Dowered with the hate of hate, the scorn of scorn,
The love of love.”
(Ausgesteuert mit dem Hass auf den Hass, der Verachtung der Verachtung,
der Liebe zur Liebe.
Alfred Tennyson)
Und just als das Bild von Madame Seraskier verblasste, war dieser neue Stern aufgegangen, um mich mit seinem Licht zu führen, auch wenn ich es nur für einen Moment gesehen hatte; nachdem es einmal durch eine sich teilende Wolke gebrochen war, wusste ich, an welcher Stelle des Himmels es daheim war und unter günstigsten Bedingungen hervorleuchtete; und immerdar wandte ich hinfort mein Gesicht in diese Richtung. Niemals mehr in meinem Leben wollte ich etwas Böses, etwas Unreines oder Unfreundliches sagen oder denken, wenn ich irgend anders konnte.
*****
Als wir tags darauf zum Foundling Hospital in den Gottesdienst gingen, geruhte Mrs. Lintot in aller Strenge – unter Protest sozusagen – mich nach den Abenteuern des Abends ins Kreuzverhör zu nehmen.
Ich erwähnte die Herzogin von Towers nicht und war auch nicht imstande, die Garderoben der verschiedenen Damen zu beschreiben; aber ich beschrieb alles andere auf eine Weise, die berechnet war, ihr starkes Interesse zu wecken – die Blumen, die glanzvollen Gemälde, die Vorhänge und Vitrinen, die schöne Musik, die vielen Herrn und fröhlichen Damen.
Sie missbilligte es alles.
„Ein Leben in solcher Üppigkeit war unzuträglich für Eigenschaften von wirklich gediegenem Wert, gleich ob moralischer oder geistiger Art. Gib ihr zum Beispiel einfaches Leben und hohes Denken!“ (Wer spricht/denkt hier? Wer ist her/ihr?)
„Nebenbei“, fragte sie, „was für ein Abendessen servierte man dir? Zweifellos irgendetwas außerordentlich recherché (gesucht). Ortolane, Nachtigallenzungen, in Wein aufgelöste Perlen?“
Aufrichtigkeit verpflichtete mich zu dem Eingeständnis, dass es kein Abendessen gegeben hatte, oder wenn doch, dass ich fertiggebracht hatte, es zu verpassen. Ich deutete an, dass vielleicht alle spät gegessen hatten; und die Perlen, sagte ich ihr, waren an den Hälsen und in den Haaren der Damen; und da ich keinen Hunger hatte, hätte ich sie mir auch nirgendwo anders gewünscht; und die Nachtigallenzungen seien in ihren Kehlen gewesen, und es seien himmlische italienische Duette damit gesungen worden.
„Und das nennen sie Gastlichkeit!“, rief Lintot aus, der sein Abendessen liebte; und dann, da er gern zusammenfasste und das Gesetzt formulierte, sobald seine Frau ihm die Richtung vorgegeben hatte, tat er das mit dem Ergebnis, dass, auch wenn es den Großen auf ihre oberflächliche Weise allen sehr gut gehe und sie mancherlei äußerlichen Reiz für einander und für alle besitzen mochten, die so beklagenswert schwach waren, in die Sphäre ihrer Anziehungskraft zu geraten, doch eine tiefe Kluft zwischen ihres- und unseresgleichen liege, die man besser nicht zu überbrücken suchen sollte, wenn man seine Unabhängigkeit und Selbstachtung behalten wolle; außer natürlich, wenn es zu einem Geschäft kommen konnte; aber das würde, fürchte er, bei mir nie passieren.
„Sie nehmen dich am einen Tag auf und lassen dich am nächsten wie eine `eiße Kartoffel fallen; und darüber hinaus, lieber Peter“, schloss er und schob zärtlich seinen Arm unter meinen, wie er es oft tat, wenn wir zusammen gingen (obgleich er gut zwölf Zoll kleiner war als ich), „darüber hinaus verhindert soziale Ungleichheit jede wirkliche Vertrautheit. Sie ähnelt der Ungleichheit der körperlichen Statur. Man kann Arm in Arm nur mit einem Mann der eigenen Größe gehen.“
Diese Zusammenfassung schien so vernünftig und unanfechtbar, dass ich, weil ich spürte, ich war beklagenswert schwach genug, in die Sphäre von Lady Crays Anziehungskraft zu geraten, wenn ich sie öfter sah, und würde dadurch meine Selbstachtung verlieren, dass ich aus diesem Grunde also beklagenswert schwach genug war, ihr nach dem glücklichen Abend, den ich in ihrem Haus verbracht hatte, keine Karte zu hinterlassen.
Snob, der ich war, ließ ich sie fallen – „wie eine `eiße Kartoffel“ – aus Angst, von ihr fallen gelassen zu werden.
Nebenher drückte mein Gewissen ein versnobtes Schuldgefühl, dass zumindest in den nur äußerlichem Reizen diese feinen Leute mehr nach meinem Geschmack waren als der Zauberkreis der netten alten Freunde der Lintots, so minderwertig jene im Vergleich zu diesen auch sein mochten (nach allem was ich wusste) in gediegenen Eigenschaften des Herzens und des Kopfes – genauso wie ich den äußeren Anblick von Park Lane und Piccadilly attraktiver fand als den von Pentonville, obgleich es sicherlich für Leute wie mich bekömmlicher war, im letzteren zu leben.
Aber Leute, die Mario und die Grisi kommen und für sich singen (und die Herzogin von Towers kommen und zuhören) lassen konnten; Leute, deren Wände mit schönen Gemälden bedeckt sind; Leute, für die die geschmeidige und harmonische Ordnung all der kleinen äußeren Dinge des gesellschaftlichen Lebens zur Gewohnheit und zum Beruf geworden ist – solche Leute lässt man nicht ohne Schmerz fallen.
So kehrte ich schmerzvoll in meine übliche Runde zurück, als ob nichts geschehen wäre; aber Tag und Nacht war mir das Antlitz der Herzogin von Towers wie eine fixe Idee, die das Leben beherrscht, immer gegenwärtig.
*****
Lese ich die letzten Seiten und lese sie wieder, finde ich, dass ich auf unverzeihliche Weise egozentrisch und unverschämt weitschweifig und verworren war; und das, obgleich ich doch nur Dünnbier zu verzapfen habe.
Dennoch fühle ich, dass ich, wenn ich dies streiche, auch jenes streichen muss; was dazu führen würde, dass ich, total entmutigt, alles streiche. Und dabei habe ich eine Geschichte zu erzählen, die es mehr als wert ist, erzählt zu werden!
Einmal auf deren Weg geraten, muss ich vermutlich die Versuchung, über mich selbst zu sprechen, unwiderstehlich gefunden haben.
Es ist offenbar eine Sitte, die man leicht annimmt – besonders im höheren Alter – vielleicht vor allem in diesem, denn früher habe ich nicht dazu geneigt. Früher hätte ich mit dir über dich geredet, Leser, oder über dich mit einem Dritten – deinem Freund oder sogar deinem Feind; oder über sie mit dir.
Aber wahrhaftig, in der Gegenwart und bis zu meinem Tod, habe ich keine Seele, mit der ich über irgendjemanden oder irgendetwas reden könnte, was wert ist, dass man drüber spricht, so dass all mein Sprechen mit Feder und Tinte erfolgt – ein einseitiges Gespräch mit dir, o geduldiger Leser! Ich bin der einsamste alte Mann in der Welt, wiewohl vielleicht der glücklichste.
Gleichwohl ist es nicht immer lustig hier, wo ich lebe und freudig auf meine Überführung in eine andere Sphäre warte.
Hier gibt es den guten Kaplan, das ist wahr, und den guten Priester; die, kommt es mir vor, ein wenig zu viel mit mir über mich selber reden; und den Arzt, der mit mir über den Kaplan und den Priester spricht, was besser ist. Er scheint sie nicht zu mögen. Er ist ein sehr geistreicher Mann.
Aber meine Mitverrückten!
Sie sind im Grunde beklagenswert comme tout le monde. Sie sind nur interessant, wenn ein Wahnsinnsanfall sie überwältigt. Sind sie von ihrem schrecklichen Leiden frei, so sind sie in der Mehrzahl ganz normale Sterbliche: konventionelle Philister, dumme Hunde wie ich, und dumme Hunde mögen einander nicht.
Zwei der Verständigsten (der eine ein Fälscher, der andere ein Kleptomane hohen Grades) sind mit mir befreundet. Sie sind recht gebildet, achtbare Stadtmenschen, reinlich, feierlich, trübselig, förmlich und schicksalsergeben, aber sie sind beide unglücklich; nicht weil sie mit dem doppelten Brandzeichen des Wahnsinns und des Verbrechens beladen sind und folglich ihre Freiheit verwirkt haben; sondern weil es ihrer Meinung nach in einem Asyl für kriminelle Wahnsinnige so wenige „Ladys und Gentlemen“ gibt, und sie seien immer an „den Umgang mit Ladys und Gentlemen“ gewöhnt gewesen. Wäre das nicht, so wären sie recht zufrieden, hier leben zu dürfen. Und der eine wie der andere vertraut mir an, dass er den jeweils anderen für einen hochgeistigen, vertrauenswürdigen usw. Burschen hält, aber insgesamt nicht für einen „richtigen Gentleman“. Ich weiß nicht, wofür sie mich halten; sie vertrauen sich das wahrscheinlich gegenseitig an.
Kann irgendetwas weniger skurril, weniger exzentrisch oder weniger interessant sein?
Ein anderer spricht, wenn er bei normalem Verstand ist, Englisch mit französischem Akzent und demonstrativen französischen Gesten, beklagt den verlorenen Glanz des alten französischen Regimes und tut, als habe er die einfachsten englischen Wörter vergessen. Er kann jedoch kein einziges französisches Wort. Aber wenn sein Wahnsinn über ihn kommt und er in eine Zwangsjacke gesteckt wird, kommt all sein Englisch zurück, ein sehr gutes, fließendes, idiomatisches Englisch mit stärkstem Cockney-Einschlag mit allen „Hs“ gebührend ersetzt.
Ein anderer (die unerfreulichste und widerlichste Person hier) hat mich zum Mitwisser seiner vergangenen Amouren erwählt; er nennt mir die Namen, die Daten und alles. Je weniger ich ihm zuhöre, desto mehr vertraut er mir an. Er macht mich krank. Was kann ich tun, um zu verhindern, dass er glaubt, ich glaubte ihm? Ich bin es müde, Leute zu töten, weil sie Lügen über Frauen verbreiten. Wenn ich ihn einen Lügner und Schurken nenne, kann das, der Himmel weiß, was für einen in ihm schlummernden Wahnsinn wecken – denn ich tappe völlig im Dunkeln, was die Natur seiner Geisteskrankheit betrifft.
Ein anderer, ein charakterschwacher, aber liebenswerter und wohlmeinender junger Mann, möchte glauben, dass er ein leidenschaftlicher Musikliebhaber ist. Aber ist, mit Verlaub, so dünkelhaft, dass er nur Bach und Beethoven ertragen kann, und wenn er Mendelssohn oder Chopin hört, muss er den Raum verlassen. Wenn ich ihm eine Freude machen will, pfeife ich Le bon roi Dagobert und sage ihm, dies sei das Motiv einer Fuge von Bach; um ihn loszuwerden, pfeife ich es erneut und behaupte, es sei aus einem von Chopins Impromptus. Was eigentlich sein Wahnsinn ist, bin ich nie ganz sicher, denn er ist sehr verschlossen, aber ich habe gehört, dass er es liebt, Katzen lebendig zu braten; und dass der bloße Anblick einer Katze genügt, um die schreckliche Neigung in ihm zu erregen und alle gesunde, unschuldige, harmlose, natürliche Zärtlichkeit aus seinem Kopf zu vertreiben.
Es gibt hier einen Maler, der (wie andere, die man draußen getroffen hat) glaubt, er sei der einzige lebende Maler, der dieses Namens würdig ist. Tatsächlich hat er die Namen aller anderen vergessen und kann sie nur alle auf einmal verachten und beschimpfen. Triumphierend zeigt er dir sein eigenes Werk, das aus genau der Sorte von geschmacklosen, halbschlauen, unverantwortlichen impressionistischen Schmierereien besteht, wie man sie von einem Amateur, der so redet, erwarten kann; und man fragt sich, warum er um Himmels Willen von allen Orten in der Welt ausgerechnet in einem Asyl für Geisteskranke sein muss. Und (wie es draußen ebenso geschehen würde) übernehmen einige seiner Mitinsassen seine eigene Wertschätzung und halten ihn für ein großes Genie; einige von ihnen wollen ihn als dreisten Schwindler verjagen (aber er ist so klein); und der Mehrheit ist es egal.
Er ist Pyromane, der arme Kerl! Und wenn der schreckliche Wunsch ihn überkommt, das Haus in Brand zu setzen, vergisst er seinen Künstlerdünkel, und sein gemeines, weiches, blödes Gesicht wird beinahe erhaben.
Und mit den weiblichen Insassen ist es genau dasselbe. Es gibt eine Dame, die zwanzig Jahre ihres Lebens hier verbracht hat. Ihr Vater war ein kleiner Landarzt namens Snogget; ihr Ehemann ein unbedeutender, hart arbeitender Hilfsprediger; und sie ist völlig normal, gewöhnlich und sogar vulgär. Denn ihr Hobby ist es, über hochgeborene Leute mit Titel und aus Familien der Grafschaft zu reden, mit denen (und keinen anderen) bekannt zu werden sie immer gehofft und ersehnt hat; und das tut sie noch, obgleich ihr Haar beinahe weiß und sie immer noch hier ist. Ihre Gedanken, Reden und Sorgen kreisen um nichts anderes als um „elegante Leute“, und sie hat für mich eine sehr warme Hochachtung entwickelt, die auf das Konto Leutnant-Colonel Ibbetsons von Ibbetson Hall, Hopshire, geht; nicht weil ich ihn umgebracht habe und dafür zum Strang verurteilt wurde, oder weil er ein größerer Verbrecher war als ich (was ja alles interessant genug ist); sondern weil er mein Verwandter war und weil ich durch ihn, denkt sie, entfernt verbunden bin mit den Ibbetsons von Lechmere – wer immer sie sind und die weder sie noch ich je getroffen habe (ich hatte in der Tat nie von ihnen gehört), deren Familiengeschichte sie aber fast auswendig kann. Was kann harmloser, langweiliger, prosaischer, erbärmlicher, stumpfsinniger, hoffnungsloser gesund und charakteristischer für allgemeine Unerzogenheit sein als dies provinzielle weibliche Geschnatter?
Und doch hat diese Frau in einem Anfall ehelicher Eifersucht ihre eigenen Kinder ermordet, ihr Vater wurde darüber verrückt, und ihr Ehemann schnitt sich die Kehle durch.
Tatsächlich käme es einem in ihren lichten Momenten nicht in den Sinn, dass sie überhaupt wahnsinnig sind, so absolut ähneln sie den Menschen, die man täglich draußen in der Welt trifft – ebensolchen engherzigen Idioten, ebensolchen tödlichen Langweilern! Man könnte gerade so gut wieder in Pentonville oder Hopshire sein oder im heißblütigen Brompton leben (wie man es angeblich nennt); oder sogar in Belgravia, wenn wir schon dabei sind!
Denn wir haben einen jungen Lord und einen Baron mittleren Alters, denen es nicht erlaubt sein sollte zu leben; aber ohne den Einfluss ihrer Familien würden sie ihre zwanzig Jahre Freiheitsentzug im Gefängnis absitzen, statt bequem abgesondert hier zu leben. Wie Ouidas (Ouida, engl.-franz. Schriftstellerin, Zeitgenossin du Mauriers) hochgeborene Helden „bleiben sie unter sich“ und vermischen sich nicht mit dem Rest von uns. Sie ignorieren uns so vollständig, dass wir nicht anders können, als trotz ihrer Laster zu ihnen aufzublicken – wie wir es auch draußen täten.
Und wir aus der Mittelklasse halten uns auch an unseresgleichen, und vermischen uns nicht mit den kleinen Ladenbesitzern – die sich nicht mit den Arbeitern, Künstlern und Handwerkern vermischen, die (was für ein Jammer) niemanden haben, auf den sie herabblicken können – außer auf einander; und sie sind die besterzogenen Leute des Hauses.
Das sind wir! Nur wenn der Wahnsinn über uns kommt, hören wir auf, normal zu sein und werden tragisch und groß, oder auch originell, grotesk und komisch – durch jenen wahren, tiefen Humor, der uns lachen und weinen macht und uns älter, trauriger und weiser zurücklässt, als er uns angetroffen hat.
„Sunt lacrimae rerum, et mentem mortalia tangunt”.
(Es gibt Tränen um Dinge, und Sterbliches rührt das Herz. Äneis I, 462)
(So viel, wenn auch nur wenig mehr, erinnere ich von dem lieben Virgil.)
Und nun wieder zurück zu meinem Dünnbier, das künftig ein bisschen mehr Substanz haben soll.
*****
So verfolgte ich meinen einsamen Weg wie Bryants Wasservogel, nur mit einem weniger klaren Ziel vor mir – bis mir schließlich ein unvergesslicher Samstag im Juni dämmerte.

Ich hatte wieder genug Geld gespart, um meinen lange ersehnten und gehegten Plan einer Reise nach Paris in die Tat umzusetzen. Der Dampfkessel der Seine nahm Druck auf, das weiße Sonnensegel der Seine wurde für mich wie für alle anderen aufgezogen; und an einem schönen wolkenlosen englischen Morgen stand ich bei dem Mann am Steuerrad und sah St. Pauls, die London Bridge und den Tower aus meinem Blickfeld verschwinden, mit wieviel Hoffnung und Freude, kann ich nicht beschreiben. Ich vergaß beinahe, dass ich ich war!
Und wie frohlockte ich am nächsten Morgen (einem schönen französischen Morgen), als ich die Champs Élysées hinauf- und unter dem vertrauten Arc de Triomphe hindurchging auf meinem Weg zur Rue de la Pompe in Passy, und überall um mich her die vertraute Sprache hörte, die ich noch so gut kannte, und den lange verlorenen, halb vergessenen und nun leidenschaftlich erinnerten Duft des genius loci atmete; das vage, leichte, unbeschreibliche und fast unwahrnehmbare Aroma eines Ortes, das für diejenigen, die vor langer Zeit dort gelebt haben, so schwer beladen ist mit Vergangenheit – der feinste und giftigste Äther, den es gibt!
Als ich an die Stelle kam, wo die Rue de la Tour sich mit der Rue de la Pompe trifft und in den Krämerladen an der Ecke schaute, erkannte ich die hübsch beschnurrbartete Krämerin, Madame Liard (deren Schnurrbart in zwölf erfolgreichen Jahren grau geworden war), und ich wurde fast ohnmächtig vor Aufregung. Hatte je zuvor dieses Gesicht einen jungen Menschen so bewegt?
Dort, hinter dem Fenster (das jetzt aus Flachglas war) und unter herrlichen napoleonischen Waren einer späteren Zeit gab es dieselben alten indischen Gummibälle in bunten Netzen; dieselben zitternden Klumpen frischen Teigs in braunem Papier, die so kühl und verführerisch aussahen; dieselben Dreisou-Schachteln mit Wasserfarben (die jetzt 25 Centimes kosteten), von denen ich so viele in Diensten von Mimsey Seraskier verbraucht hatte! Ich ging hinein und kaufte eine und roch entzückt wieder den Geruch all meiner vergangenen Einkäufe hier und hörte ihr vertraut klingendes
„Merci, monsieur! Faudrait-il autre chose?“, (Danke, mein Herr. Möchten Sie noch etwas?) als wäre es ein Segensspruch; aber ich war zu schüchtern, um mich in ihre Arme zu werfen und ihr zu sagen, dass ich der „einsame, wandernde aber nicht verlorene“ Gogo Pasquier war. Sie hätte gesagt:
„Eh bien, et après?“ (Nun gut – und weiter?)
Der Tag hatte gut angefangen.
Wie ein Epikuäer überlegte ich, ob ich zum alten Tor in der Rue de la Pompe gehen sollte, die Straße hinauf und zurück zu unserem alten Garten, oder lieber herumgehen sollte zu der Lücke in der Parkhecke, die wir vorzeiten durch unser häufiges Hinein- und Hinausgehen zum und vom Bois de Boulogne ausgetreten hatten.
Ich wählte das letztere, weil es mir mehr zu versprechen schien in der köstlichen Stufenfolge des Entzückens.
Die Lücke in der Parkhecke, fürwahr! Die Parkhecke war verschwunden, den Park selber gab es nicht mehr, gefällt, zerstört, alles in kleine Gärten parzelliert, mit gepflegten weißen Villen mit Ausnahme des tiefen Einschnitts, durch den eine Bahnstrecke verlief. Ein Zug schnaufte und keuchte vorbei und schockierte mich mit seinem schmutzigen Dampf, während ich betäubt über die Ruinen meiner lange in Ehren gehaltenen Hoffnung blickte.
Wenn der Zug über mich hinweggefahren wäre und ich das überlebt hätte, ich hätte kaum schockierter sein können; als zu grausame, zu brutale Schandtat kam es mir vor.
Mitten durchs Herz der Wildnis war eine gewundene Kutschenstraße gebohrt worden; daran grenzten säuberlich eingezäunte, nagelneue Gärten, in denen ich hier und da in Gestalt eines Baums, an den ich mich gut erinnerte, weil ich als Junge oft hinaufgeklettert war, einen alten Freund wiedererkannte, der von vielen übrig geblieben war, so verändert durch den Verlust seiner alten Umgebung, dass er gezähmt, eingesperrt und verpflanzt aussah, als müsse er sich entschuldigen und schäme sich, schließlich doch noch entdeckt worden zu sein!
Nichts sonst war geblieben. Kleine Hügel, Klippen, Täler und Kreidebrüche, die mir einmal groß erschienen waren, waren eingeebnet oder ganz weg, ich verlor völlig meine Orientierung und fühlte einen seltsamen, kriechenden Schauer von Leere und Verlust.
Aber wie stand es um die Straße und mein altes Zuhause? Ich rannte zur Rue de la Pompe im Eilschritt erregter Angst zurück. Die Straße war weg, zwölf Yards hinter dem Tor versperrt durch einen riesigen Ziegelbau, ganz bedeckt mit frisch gestrichenem Gitterwerk. Mein altes Haus gab es nicht mehr, aber an seiner Stelle ein viel größeres und eleganteres Gebäude aus behauenem Stein. Das alte Tor wenigstens und die Pförtner-Loge waren nicht verschwunden. Ich fixierte meinen trauervollen Blick auf diese armseligen Überbleibsel, die vernachlässigt, heruntergekommen und inmitten all des neuen Glanzes fehl am Platze aussahen.
In diesem Moment kam eine schmucke Concierge mit einer rosa bebänderten Haube heraus, starrte mich eine Weile an und fragte, ob Monsieur etwas wolle.
Ich brachte kein Wort heraus.
„Est-ce que monsieur est indisposé? Cette chaleur! Monsieur ne parle pas le Français, peut-être?“ (Fühlen der Herr sich nicht wohl? Diese Hitze! Der Herr spricht vielleicht kein Französisch?)
Als ich die Sprache wiederfand, erklärte ich ihr, dass ich hier einmal gewohnt hatte in einem bescheidenen Haus mit Blick über die Straße, welches aber durch diese palastartigere Bleibe ersetzt worden sei.
„O oui, Monsieur, on a balayé tout ça!” (O ja, mein Herr, man hat das alles weggefegt) antwortete sie.
„Balayé!“ Was für ein Ausdruck in meinen Ohren!
Und sie erklärte, wie die Änderungen sich vollzogen hätten und wie wertvoll das Besitztum geworden sei. Sie zeigte mir ein kleines Gartenstück, ein Fragment meines alten Gartens, das noch vorhanden war und in dem der alte Apfelbaum noch hätte stehen können, aber er war gefällt worden. Ich sah den Stumpf, der als rustikaler Tisch diente.

Über eine neue Mauer blickend, sah ich alsbald einen anderen kleinen Garten und darin die Ruine des alten Schuppens, in dem ich die Spielzeugschubkarre gefunden hatte – davon würde nichts bleiben, da sie auch dort bauten.
Ich fragte nach all den Leuten, an die ich mich erinnerte, und fing mit den unwichtigsten an – dem Metzger, dem Bäcker, dem Kerzenhaltermacher.
Einige waren tot; einige hatten sich zurückgezogen und hatten ihren commerce den Kindern oder Schwiegerkindern übergeben. Drei verschiedene Lehrer hatten die Schule geleitet, seit ich sie verlassen hatte. Dem Himmel sei Dank, die Schule war noch da, stark verändert, klar. Ich hatte vergessen, nach ihr zu schauen.
Die Concierge erinnerte sich nicht an meinen Namen und auch nicht an die Seraskiers – ich fragte mit klopfendem Herzen. Wir hatten keine Spur hinterlassen. Wir hatten keine Spur hinterlassen. Nur zwölf Jahre hatten jede Erinnerung an uns ausgelöscht! Aber sie erzählte mir, dass ein Gentleman, decoré, mais tombé en enfance (ordensgeschmückt, aber kindisch geworden) in einer maison de santé (Heilanstalt) in der Chaussée de la Muette ganz in der Nähe lebe und dass er Major Duquesnois heiße; dorthin ging ich, nachdem ich ihr herzlich gedankt hatte.
Ich fragte nach Major Duquesnois und erhielt die Auskunft, er gehe gerade spazieren, und bald fand ich ihn, sehr gealtert und gebeugt am Arm einer barmherzigen Schwester. Ich war so bewegt, dass ich zwei- oder dreimal an ihm vorbeigehen musste, ehe ich sprechen konnte. Er war so klein – so erschütternd klein!
Es dauerte lange, bis ich ihm eine Vorstellung vermitteln konnte, wer ich war – Gogo Pasquier!
Nach einiger Zeit schien er sich ein wenig an die Vergangenheit zu erinnern.
„Ha, ha! Gogo – gentil petit Gogo! – oui – oui – l’exercice? Portez … arrrmes! arrrmes … bras! Et Mimsé! bonne petite Mimsé! toujours mal à la tête!“ (Haha, Gogo – kleiner lieber Gogo! Jaja, exerzieren? Gewehr – über! Gewehr – Gewehr – ab! Und Mimsey! gute kleine Mimsey! immer Kopfweh!)
An Madame Seraskier konnte er sich genau erinnern; er wiederholte ihren Namen viele Male und sagte: „Ah! Elle était bien belle, Madame Seraskier!“
In den alten Zeiten des Märchenerzählens wurde er manchmal müde; bat ich ihn dann, fortzufahren, hatte er angeordnet, dass, wenn er im Verlauf der Geschichte „Cric“ und ich nicht sofort darauf „Crac“ sagte, die Geschichte bzw. ihre Fortsetzung bis zu unserem nächsten Spaziergang aufgeschoben sein sollte, und er war so einfallsreich beim Einbringen des schrecklichen Worts, dass ich oft in die Falle tappte und auf mein Vergnügen an diesem Nachmittag verzichten musste.
Jetzt nun fiel es mir plötzlich ein, „Cric!“ zu sagen, und er erwiderte sofort „Crac!“ und lachte auf eine rührende, greisenhafte Art – „Cric! – Crac! C’est bien ça!“, aber dann wurde er völlig ernst und sagte:
„Et la suite au prochain numéro!“ (Und die Fortsetzung in der nächsten Nummer!)
Danach begann er zu husten, und die gute Schwester sagte:
„Je crains que monsieur ne le fatigue un peu!“ (Ich fürchte, der Herr ermüden ihn ein wenig.)
So musste ich mich verabschieden; und nachdem ich ihm die Hand gedrückt und geküsst hatte, verbeugte er sich sehr höflich vor mir wie vor einem völlig Fremden.
Ich rannte weg, warf meine Arme wie ein Verrückter empor vor Mitleid und Trauer um meinen lieben alten Freund, bedauerte ihn und war ernüchtert. Ich hielt auf den Bois de Boulogne zu, nur um dort an Stelle des alten, von Kaninchen und Rehböcken bevölkerten Dickichts, Farnkrauts und undurchdringlichen Gestrüpps einen riesigen künstlichen See mit Ruderbooten, Jollen und einem Steingarten vorzufinden, der neben den Rosherville Gardens bestehen könnte. Und wen treffe ich auf dem Weg dorthin, nah bei den Eisentoren in den Befestigungsanlagen – keinen anderen als einen meiner alten Kurier-Freunde auf seinem Weg von St. Cloud zu den Tuilerien. Da ritt er, wippte mit den Armen auf und ab, trug flachen Glacé-Hut, riesige Schaftstiefel, erhob sich nie in den Steigbügeln, alles wie immer, während sein Pferd trabte zum Geklingel des süßen Geläuts um seinen Hals.
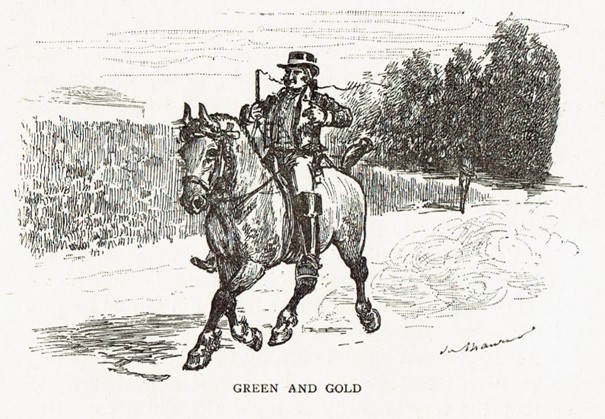
Aber ach! Sein Mantel war nicht mehr die anspruchslose blausilberne Livree des Bürgerkönigs, sondern das abscheuliche Grüngold seines Nachfolgers.
Auch das Mare d’Auteuil hatte sich geändert und war respektabel geworden – kaiserlich respektabel. Keine Frösche oder Kröten oder Wasserkäfer mehr, da war ich sicher; sondern goldene und silberne Fische in abgeschmackt napoleonischem Überfluss.
Ich kann keine Worte finden, um die Trauer und Sehnsucht zu beschreiben, die mich erfüllte, als ich den sonnenbeschienenen Grassaum betrat, das Ziel all meines zärtlichen Strebens in zwölf langen Jahren.
Es war Sonntag, und viele Leute waren unterwegs – viele Kinder, im feinsten Sonntagsstaat benahmen sich vorzüglich und fütterten artig die Fische mit Brotbröckchen. Eine neue Generation, viel ruhiger und besser angezogen als meine Cousins und ich, die wir die Einsamkeit einst mit dem Geklatsche unserer Netze und dem aufgeregten Gelärm unserer englischen Stimmen erfüllt hatten.
Als ich mich auf eine Bank bei der alten Weide setzte (wo die Wasserratte zu Hause war) und starrte und starrte, überraschte es mich beinahe, dass die bloße Intensität meiner Sehnsucht als solche nicht genügte, um die alten vertrauten Gesichter und Gestalten heraufzurufen und die modernen Eindringlinge zu verscheuchen. Die Macht, dies zu tun, schien mir fast in meiner Reichweite; ich wollte, wollte und wollte mit aller Kraft, aber vergebens; ich konnte Gesicht und Gehör nicht für einen Augenblick betrügen. Sie blieben da, bewusstlos und ungestört, diese fröhlichen, wohlerzogenen und gut ausgestatteten kleinen Franzosen, fütterten die goldenen und silbernen Fische; und schmerzenden Herzens verließ ich sie da.
O, gewiss, gewiss doch, weinte ich für mich, wir sollten Mittel und Wege finden, die Vergangenheit voller und vollständiger zu besitzen als bisher. Für viele von uns ist das Leben nicht lebenswert, wenn ein so verzweifelter und so natürlicher Wunsch nicht erfüllt werden kann. Die Erinnerung ist nur ein armseliges, bruchstückhaftes Hilfsmittel, ohne das es uns besser ginge, da sie uns nur an den Rand der Vollendung leitet und uns mit einer Sehnsucht, die sie nicht stillen kann, in den Wahnsinn treibt. Die Berührung einer entschwundenen Hand, der Klang einer verstummten Stimme, die zarte Anmut eines verstorbenen Tages sollten uns auf unseren leisesten Wink durch irgendeine außerordentliche und denkbare Illusion unserer Sinne für immer gehören.
Ach! ach! ich habe kaum eine Hoffnung, die von mir geliebten Menschen jemals in einem anderen Leben wieder zu sehen. O, ihre zu unscharf erinnerten Gestalten in diesem wiederzusehen, wie sie einst waren, durch einen Kniff meines eigenen Hirns! Sie mit den Augen zu sehen, mit den Ohren zu hören, mit ihnen die alten, ausradierten Wege betreten wie in einem Wachtraum! Man würde Wahnsinn in Kauf nehmen, um ein solcher Selbstbezauberer zu werden.
Unter solchen trübseligen Grübeleien erreichte ich St. Cloud, und wenigstens dieses und der Bois de Boulogne hatten sich nicht allzu merkbar verändert und sahen aus, als hätte ich sie vor nur einer Woche verlassen. Der süße Ausblick von der Brücke, nach der einen und der anderen Seite, bestrickte mich wie ehedem. Dort wenigstens hatte die Herrlichkeit sich nicht verabschiedet.
Ich lief durch die vergoldeten Tore und den breiten Weg hinauf zur grande cascade. Dort, unter den lieblich gewundenen Urnen und Töpfen voller Geranien, saßen, lagen oder gestikulierten die alten, unveränderlichen Götter; dort hockten die grimmigen, liebenswürdigen Monster aus Granit, Marmor und Bronze und spien immer noch Unmengen von Gallonen aus, um heiße Pariser Augen zu ergötzen. Unverändert und allem Anschein nach unveränderbar (außer dass sie nicht annähernd so groß waren, wie ich sie in Erinnerung hatte), beschämte mich ihre kalte, glatte, ironische Geduld und versetzte mich in bessere Stimmung. Schön, hässlich, was immer man will, schienen sie geradezu zu schwelgen in der Sinnesempfindung ihrer Unsinnlichkeit, ihrer ewigen Dauer, ihrer steinernen Verachtung von Zeit, Wind und Wetter und der mürrischen, kurzlebigen, hinfälligen Unzufriedenheit des Menschen. Es tat gut, ihnen erneut liebevoll auf die Schulter zu klopfen – wenn man die erreichen konnte – und sich ein Weilchen an sie zu klammern nach all dem Staub, Getriebe und Ruinösen, durch das ich den ganzen Tag gewandert war!
Tatsächlich weckten sie in mir ein gesundes Verlangen nach verdrängten irdischen Freuden – sogar nach kläglichem Speis und Trank – so ging ich und orderte ein üppiges Mahl in der Tête Noire – einer nagelneuen Tête Noire, leider! Ganz weiß, alles Stein und Stuck und völlig geschichtslos!
Es gab einen schönen Sonnentergang. In Erwartung meines Essens schaute ich aus dem Fenster im ersten Stock und fand Balsam für meine enttäuschte und trostlose Seele in der demokratischen Vergnügtheit französischen Sonntagslebens. Ich hatte es wieder und wieder in alten Zeiten gesehen; wenigstens dies war ein Nachhausekommen zu etwas, was ich gekannt und geliebt hatte.
Die Cafés an der kleinen Place zwischen Brücke und Park waren brechend voll. Leute schwatzten über ihren Verzehr hinweg, sie saßen geradeaus fast bis zur Mitte des Platzes, so dicht bei dicht, dass es kaum ein Durchkommen gab für die fleißigen, lebhaften Kellner mit ihren weißen Schürzen. Die Luft war erfüllt vom Duft nach zertretenem Gras, Makronen und französischem Tabak, der vom Park herüberwehte; von fröhlichem französischem Gelächter und der Musik von Mirlitons (Schalmeien); von einem leichten staubigen Dunst, durchschossen mit Purpur und Gold von der sinkenden Sonne. Der Fluss, belebt von Booten und Kanus, spiegelte die Pracht des Himmels, und der gut erinnerte dicht bewaldete Hügel erhob sich vor mir und kulminierte in der Lanterne de Diogène. (Laterne des Diogenes)
Ich hätte durch diesen Irrgarten von Bäumen mit verbundenen Augen hindurch gefunden.
Zwei römische pifferari (pifferaii – italienisch Sackpfeifenspieler) kamen auf den Platz und begannen, eine ungewöhnliche und sehr erregende Melodie zu spielen, die mich fast aus dem Fenster zog; sie schien keinerlei Form zu haben, keinen Anfang, keine Mitte, kein Ende; sie erhob sich höher und höher wie der Gesang einer Lerche, ohne Atempause, zum Rhythmus einer rasend machenden Gigue – vielleicht einer Tarantella – immer in äußerster Spannung, kam sie einer schrillen Klimax der Ekstase näher und näher in höchster Höhe und Ferne, jenseits des Bereichs irdischer Musik; während die Basspfeife fortfuhr, von Erde und der Unmöglichkeit einer Flucht zu brummen. Alles so fröhlich, so traurig, es gibt keine Benennung dafür!
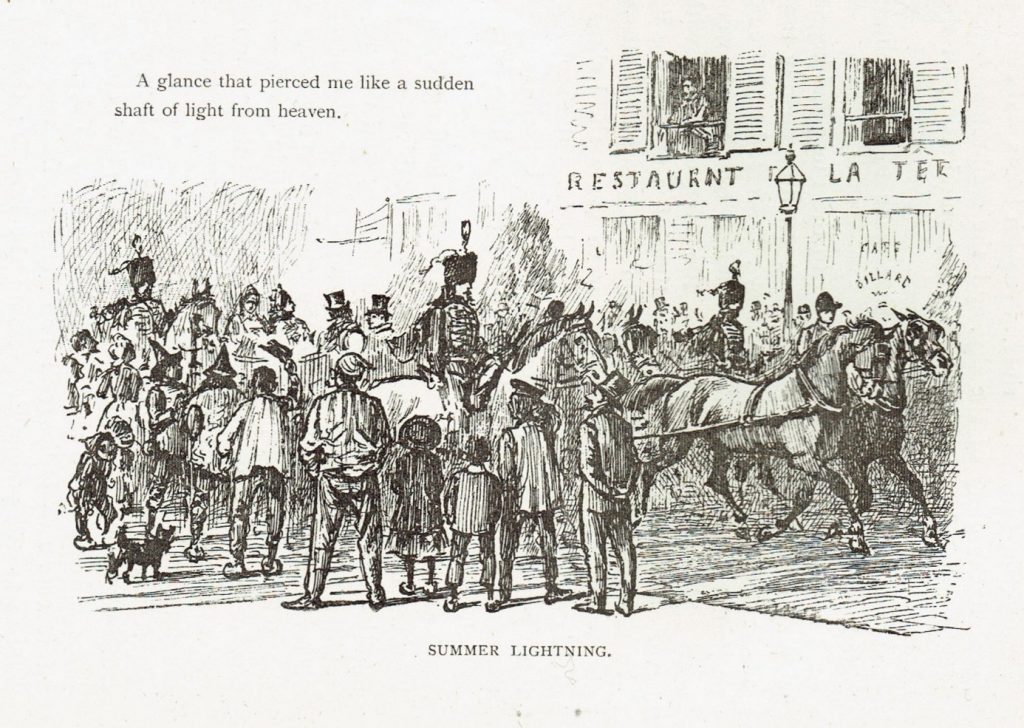
Zwei kleine verwachsene und abgeschoben aussehende Zwerge, Bettler, Bruder und Schwester mit großen zahnlosen Löchern als Mündern und fehlender Oberlippe, fingen an zu tanzen; und die Menge lachte und klatschte Beifall. Höher und höher, näher und näher ans Unmögliche erhoben sich die schnellen, durchdringenden Töne des piffero (pifferaio). Der Himmel schien fast in Reichweite – das Nirwana der Musik nach ihrem schnellen Wahnsinn – die Region des Ultraschalls, die jenseits der Hörfähigkeit normaler menschlicher Ohren liegt!
Eine vierspännige Kutsche mit Postillionen und Schaffnern kam königlich vom Palast her die Straße herabgerasselt und zerstreute die Menge, als sie auf die Brücke zurollte. In ihr saßen zwei Ladys und zwei Gentlemen. Eine der Damen war die junge Kaiserin von Frankreich; die andere schaute zu meinem Fenster herauf – für einen Moment wie durch einen weichen Sommergewitterblitz, schien ihr Gesicht von freundlichem Wiedererkennen erleuchtet – mit einem süßen, freundschaftlichen, interessierten und überraschten Blick – einem Blick, der mich wie ein plötzlicher Lichtpfeil des Himmels traf.
Es war die Herzogin von Towers.
Mir war, als hätten die Sackpfeifen dies herbeigeführt! Einen Moment später war die Kutsche außer Sicht, die Sonne war untergegangen, die pifferari hatten aufgehört zu spielen und gingen mit dem Hut herum, und alles war vorbei.
Ich aß und kehrte zu Fuß durch den Bois de Boulogne und am Mare d’Auteuil vorbei nach Paris zurück, wo ich meine alte Freundin, die Wasserratte, es überqueren sah, sie zog den Schimmer ihrer Blasenspur hinter sich her wie einen silbernen Kometenschwanz!
„Allons-nous-en, gens de la noce,
Allons nous-en chacun chez nous!“
(Lasst uns gehen, Hochzeitsgäste,
lasst uns gehen, alle zu uns!“
Louis Archambault)
Das sang eine festliche Hochzeitsgesellschaft, die kreuzfidel und Arm in Arm durch die lange Hauptstraße von Passy ging in einer frühen Zuversicht, die das Herz mit Neid erfüllt hätte trotz aller traurigen Erfahrung mit der Vergeblichkeit menschlichen Wollens.
Chacun chez nous! Wie bezaubernd das klingt!
Waren alle so sicher, dass sie, wenn sie ihr Zuhause erreichten, finden würden, was ihr Herz begehrt? War der Bräutigam sich dessen so sicher?
Das Begehren des Herzens – die Reue des Herzens! Ich schmeichelte mir, dass ich die tiefsten Tiefen von beidem an diesem ereignisreichen Sonntag recht gut ausgelotet hatte!
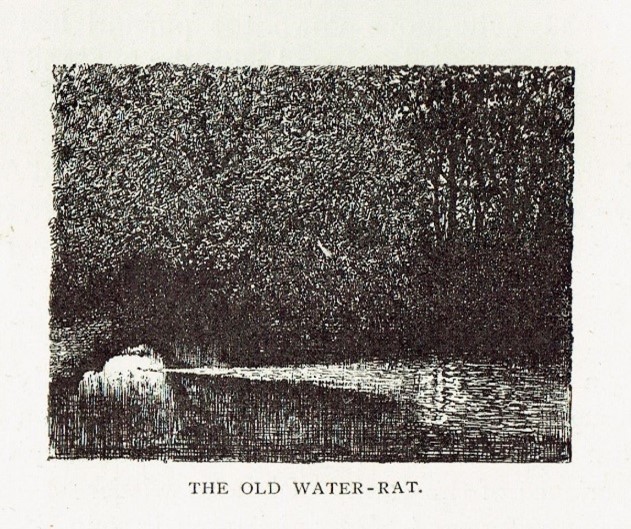
Teil vier
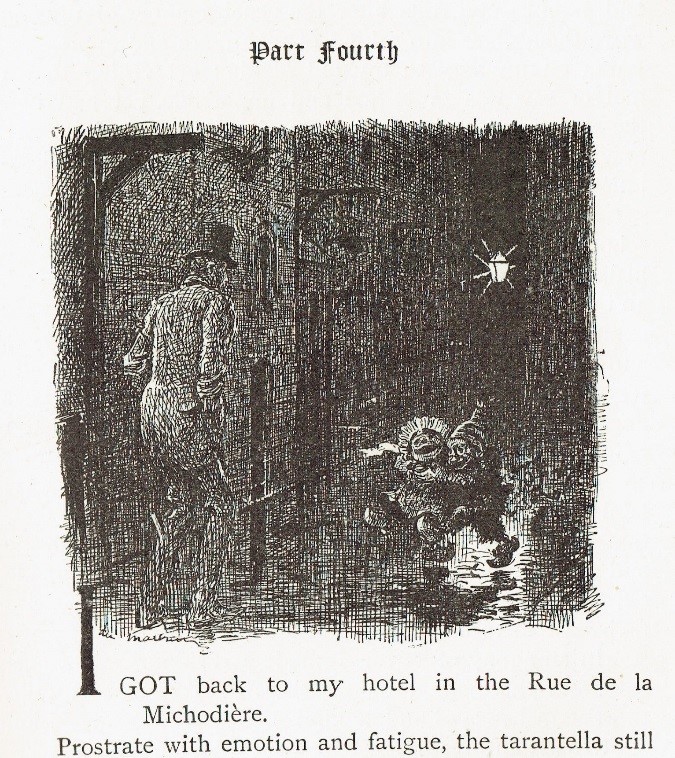
Ich kehrte in mein Hotel in der Rue de la Michodière zurück.
Hingestreckt von Aufregung und Müdigkeit, die Tarantella immer noch in den Ohren, und das unvergessliche, geliebte Gesicht mit seinem unbeschreiblichen Lächeln immer noch auf der Netzhaut meiner geschlossenen Augen, fiel ich in Schlaf.
Und dann träumte ich einen Traum, und die erste Phase meines wirklichen inneren Lebens begann!
All die Ereignisse des Tages, entstellt, übertrieben und durcheinander gewürfelt nach der üblichen Art von Träumen, verwoben sich zu einer Art von beklemmendem Nachtmahr. Ich war auf dem Weg zu meiner alten Behausung; alles, was ich traf oder sah, war grotesk und unmöglich und vermittelte bald den seltsam unbestimmten Zauber von Assoziation und Erinnerung, bald das erschreckende Gefühl von Wechsel, Verlust und Trostlosigkeit.
Als ich mich dem Straßentor näherte, war dort zu meiner Linken statt der Schule ein Gefängnis, und ein kleiner, untersetzter Schließer, drei Fuß groß und sehr verwachsen, und eine ebenso verwachsene Schließerin, auch nicht größer als er, standen in der Tür, beobachteten mich durchtrieben aus den Augenwinkeln und grinsten zahnlos. Sogleich fingen sie an, nach einer alten bekannten Weise Walzer zu tanzen, die riesigen Schlüssel baumelten an ihren Seiten; und sie sahen so lustig aus, dass ich lachte und applaudierte. Aber bald bemerkte ich, dass ihre schiefen Gesichter alles andere als lustig waren, ja, sie waren schlimm und über alle Maßen schrecklich, und mir wurde schnell klar, dass diese tödlichen Zwerge zwischen mich und das Straßentor walzen wollten – um mir den Weg abzuschneiden und mich ins Gefängnis zu bringen, wo es üblich war, Leute am Montagmorgen zu hängen.
In Todesangst raste ich zum Straßentor, und da stand die Herzogin von Towers, mit sanfter Überraschung in den Augen und einem freundlichen Lächeln – ein himmlisches Traumbild von Kraft und Wirklichkeit.
„Was Sie träumen, stimmt nicht!“, sagte sie. „Haben Sie keine Angst – die kleinen Leute existieren nicht. Geben Sie mir Ihre Hand und kommen Sie hierher!“
Als ich das tat, verscheuchte sie die Troglodyten mit einer Handbewegung und sie verschwanden; ich spürte, dass dies kein Traum mehr war, sondern etwas anderes – etwas Seltsames, das mir widerfuhr, ein neues Leben, zu dem ich erwacht war.
Denn bei der Berührung ihrer Hand flammte plötzlich mein Bewusstsein, mein Gefühl, ich, ich selbst zu sein, das bisher in meinem Traum (wie in alle Träumen bisher) nur partiell, lückenhaft und undeutlich gewesen war, auf zu voller, in sich stimmiger, praktischer Tätigkeit – gerade so wie im Leben, wenn man völlig wach ist und großen Anteil nimmt an allem, was passiert – nur mit weitaus schärferen und geistesgegenwärtigeren Wahrnehmungen.
Ich wusste genau, wer ich war und was ich war, und erinnerte mich an alle Ereignisse des letzten Tages. Ich wusste, dass mein wirklicher Körper, ausgezogen und im Bett, jetzt fest schlafend in einem kleinen Zimmer im vierten Stock eines hôtel garni in der Rue de la Michodière lag. Das wusste ich genau; und doch: Hier war mein Körper auch, ebenso substanziell, mit allen Kleidern an; meine Stiefel recht staubig, mein Hemdkragen feucht von der Hitze, denn es war heiß. Mit meiner freien Hand fasste ich in meine Hosentasche; da war mein Londoner Haustürschlüssel, meine Börse, mein Federmesser; mein Taschentuch in der Brusttasche meines Mantels, und in seinen Seitentaschen meine Handschuhe, meine Tabakdose und die kleine Schachtel mit Wasserfarben, die ich am Morgen gekauft hatte. Ich sah auf meine Uhr. Sie ging und zeigte elf Uhr. Ich kniff mich, ich hustete, ich tat alles, was man normalerweise unter dem Druck einer großen Überraschung tut, um mich zu vergewissern, dass man nicht träumt. Und ich war wach und stand doch hier, sogar Hand in Hand mit einer großen Lady, der ich nie vorgestellt worden war (und die sich über meine Verwirrung sehr zu amüsieren schien); und schaute bald auf sie, bald auf meine alte Schule.
Das Gefängnis war zusammengefallen wie ein Kartenhaus, und siehe! an seiner Stelle stand Monsieur Saindous maison d’éducation gerade so, wie sie früher gewesen war. Auf der gelben Wand erkannte ich sogar den Abdruck einer Hand aus trockenem Matsch von einem Tagesschüler namens Parisot, der vor fünfzehn Jahren in die nahe Gosse gefallen war und, als er wieder aufstand, dieses Zeichen hinterlassen hatte; es war dort für Monate verblieben, bis es während der Ferien übertüncht worden war. Hier war es wieder, nach fünfzehn Jahren.
Die Schwalben flogen und zwitscherten. Ein gelber Omnibus wurde zum Tor der Schule gezogen; die Pferde stampften, wieherten und zankten mit einander, wie es französische Pferde in jenen Tagen immer taten. Der Kutscher schimpfte ein bisschen obenhin mit ihnen.

Eine Menschenmenge schaute zu – Père und Mère François, Madame Liard, die Frau des Krämers, und andere Leute, an die ich mich sofort entzückt erinnerte. Direkt vor uns schauten ein kleiner Junge und ein Mädchen wie die anderen zu, und ich erkannte den Rücken, den kurz geschorenen Kopf und die dünnen Beine von Mimsey Seraskier.
Eine Drehorgel spielte eine hübsche Melodie, die ich gut kannte, aber vergessen hatte.
Das Schultor ging auf, und Monsieur Saindou, selbstherrlich (wie immer) und ein halbes Dutzend Jungen, deren Namen mir ganz vertraut waren, mit weißen Hosen, glänzenden Schuhen und weißen Seidenbändern um den linken Arm, stiegen in den Omnibus und wurden – wie es schien – auf glorioseste Art und Weise in einem goldenen Kampfwagen in den Himmel gefahren. Es war schön anzusehen und anzuhören.
Ich hielt noch immer die Hand der Herzogin und fühlte ihre Wärme durch den Handschuh; sie schlich meinen Arm herauf wie ein magnetischer Strom. Ich war im Elysium; ein himmlisches Gefühl war über mich gekommen, dass endlich meine Begrenztheit siegreich überschritten worden war von einem anderen als meinem eigenen Geist – und jener war stark und wohltuend. Es gab einen segensreichen Spalt im undurchdringlichen Panzer meines Selbst, und der Genius der Kraft, des Erbarmens und der zärtlichen Freundschaft hatte ihn entdeckt.
„Jetzt träumen Sie wahr,“ sagte sie. „Wo fahren diese Jungen hin?“
„Zur Kirche“, erwiderte ich, „zu ihrer première communion.“
„Das stimmt. Sie träumen wahr, weil ich Sie bei der Hand genommen habe. Kennen Sie die Melodie?“
Ich lauschte, und der Text, der zu ihr gehört, stieg aus der Vergangenheit auf, und ich sagte ihn ihr, sie lachte wieder und verdrehte dabei köstlich die Augen.
„Ganz richtig“, rief sie. „Wie eigenartig, dass Sie ihn kennen! Wie gut Sie für einen Engländer Französisch sprechen! Denn Sie sind doch Mr. Ibbetson, der Architekt von Mrs. Cray?“
Ich bejahte, und sie ließ meine Hand los.
Die Straße war voller Leute – vertraute Gestalten, Gesichter und Stimmen, die miteinander redeten und die Straße hinab dem gelben Omnibus nachschauten; alte Gewohnheiten, alte Geh- und Verhaltensweisen, alte vergessene französische Redewendungen – alles, wie es vor lange Zeit gewesen war. Niemand bemerkte uns, und wir gingen die jetzt verlassene Straße hinauf.
Das Glücksgefühl, das Entzücken an allem! Konnte es sein, dass ich tot, plötzlich im Schlaf gestorben war im Hotel in der Rue de la Michodière? Konnte es sein, dass auch die Herzogin von Towers tot war, umgekommen durch einen Unfall auf ihrem Weg von St. Cloud nach Paris? Und dass wir nach einem in Zeit und Raum so nah benachbarten Tod unser ewiges Nachleben in dieser himmlischen Weise begonnen hatten?
Das war zu schön, um wahr zu sein, überlegte ich; irgendein Instinkt sagte mir, dass dies nicht der Tod, sondern transzendentes irdisches Leben war und dass es, leider! nicht für immer dauern würde!
Ich war mir jedes Zuges in ihrem Gesicht tief bewusst, jeder Bewegung ihres Körpers, jeder Einzelheit ihres Kleids – deutlicher, als ich es im wirklichen Leben gewesen wäre – und sagte zu mir selbst: „Was immer dies ist, es ist kein Traum.“ Aber ich spürte ein unaussprechliches Hochgefühl in mir, das uns nur in jenen wachen Momenten ergreift, in denen es uns besonders gut geht, und dann nur schwach, verglichen mit dem jetzigen, und viele von uns empfinden es nie. Ich hatte es nie wieder empfunden seit dem Morgen, an dem ich die kleine Schubkarre gefunden hatte.
Mir war jedoch auch bewusst, dass die Straße selbst ein bisschen nach Traum aussah. Sie war nicht länger ganz richtig, geriet sozusagen aus Zeichnung und Perspektive. Ich hatte meinen Ankerplatz verloren – ihre Hand.
„Träumen Sie immer noch wahr, Mr. Ibbetson?“
„Ich fürchte, nicht ganz“, erwiderte ich.
„Sie müssen selbst ein bisschen üben – fleißig üben. Schauen Sie dieses Haus; was steht über dem Portikus?“
Ich sah in goldenen Buchstaben die Worte „Tête Noire“ geschrieben und sagte ihr das.
Lachen kräuselte sie, und sie sagte: „Nein; noch mal!“, und berührte mich für einen Moment mit der Spitze ihres Fingers.
Ich versuchte es erneut und sagte: „Parvis Notre Dame“.
„Das ist viel besser“, sagte sie und berührte mich erneut; und jetzt las ich: „Parva sed apta“, wie ich es in alten Zeiten so oft gelesen hatte.
„Und nun sehen Sie das alte Haus da drüben an“, sie zeigte auf mein altes Zuhause; „wie viele Fenster sind da im obersten Stock?“
Ich sagte sieben.
„Nein, es sind fünf. Schauen Sie erneut hin!“, und es waren fünf; und das ganze Haus war bis ins kleinste Detail genauso, wie es einmal gewesen war. Ich konnte durch eines der Fenster Thérèse sehen, wie sie mein Bett machte.
„Schon besser“, sagte die Herzogin; „Sie werden es bald schaffen – es ist sehr leicht – ce n’est que le premier pas! (Es ist nur der erste Schritt) Mein Vater lehrte es mich; Sie müssen immer auf dem Rücken schlafen, die Arme überm Kopf, die Hände unter ihm verschränkt und die Beine gekreuzt, das rechte über dem Linken – wenn Sie nicht Linkshänder sind; und Sie dürfen keine Sekunde aufhören, daran zu denken, wo Sie in Ihrem Traum sein wollen – bis Sie schlafen und dorthin kommen; und Sie dürfen in Ihrem Traum nie vergessen, wo und was Sie im Wachzustand waren. Sie müssen den Traum mit der Wirklichkeit verknüpfen. Vergessen Sie das nicht. Und nun will ich mich verabschieden; aber bevor ich gehe, geben Sie mir beide Hände und schauen Sie sich um, soweit Sie gucken können“.
Es war schwer, den Blick von ihr abzuwenden; ihr Gesicht saugte meine Augen an und durch sie hindurch mein Herz; aber ich tat, was sie verlangte, und nahm die ganze vertraute Szenerie in mich auf, bis zu den entfernten Wäldern der Ville d’Avray, von denen ein wenig durch eine Öffnung zwischen den Bäumen sichtbar war; sogar bis zum Rauch eines nach Versailles fahrenden Zuges, Meilen entfernt; und der alte Telegraph, der auf der Spitze des Mont Valérien seine Arme schwenkte.
„Alles klar?“, fragte sie. „Das ist gut. Hinfort, wenn Sie hierher kommen, werden Sie sicher sein, soweit Ihr Blick reicht – von dieser Stelle aus – alles durch meine Einführung. Sie sehen, wie nützlich es ist, eine Freundin bei Hofe zu haben! Keine kleinen tanzenden Schließer mehr! Ab dann können Sie allmählich aus eigener Kraft weiter kommen.
Da draußen durch den Park, wo es zum Bois de Boulogne geht – ist ein Loch in der Hecke, durch das Sie hindurchschlüpfen können; aber geben Sie Acht, machen Sie vor sich alles glatt – wirklich, bevor Sie einen Schritt weiter gehen, andernfalls wachen Sie auf und müssen wieder von vorn beginnen. Sie müssen es nur wollen und sich selbst für wach halten, und es wird gelingen – unter der Bedingung natürlich, dass Sie schon einmal da waren. Und geben Sie auch Acht, Sie müssen sehr vorsichtig sein, wie Sie Dinge oder Menschen berühren – Sie dürfen hören, sehen, riechen; aber Sie dürfen Blumen und Blätter nicht berühren oder gar pflücken und Dinge nicht verrücken. Es trübt den Traum wie Hauchen auf eine Fensterscheibe. Ich weiß nicht, warum, aber es ist so. Sie müssen daran denken, dass alles hier tot und vergangen ist. Mit Ihnen und mir ist es was anderes; wir leben und sind wirklich – d.h. ich bin wirklich. Und auch an Ihrer Wirklichkeit dürfte angesichts Ihres Händedrucks kaum ein Zweifel bestehen, Mr. Ibbetson. Aber Sie sind nicht wirklich; und warum Sie hier sind und welche Aufgabe Sie in diesem meinem speziellen Traum haben, kann ich nicht verstehen; keine lebende Person ist je hier herein gekommen. Ich kann es nicht verstehen. Ich vermute, es beruht darauf, dass ich heute Nachmittag Ihre Wirklichkeit sah, als Sie aus dem Fenster der Tête Noire blickten – und Sie sind bloß eine abseitige Einbildung meines übermüdeten Hirns – eine sehr liebenswerte Einbildung, gebe ich zu; aber Sie existieren hier und jetzt gerade nicht; Sie können es möglicherweise nicht; Sie sind irgendwo anders, Mr. Ibbetson; tanzen vielleicht bei Mabille, oder sind irgendwo fest am Schlafen und träumen von französischen Kirchen, Palästen und öffentlichen Brunnen, wie es sich für einen guten jungen britischen Architekten gehört, sonst würde ich mit Ihnen nicht so sprechen, da können Sie sicher sein!
Egal. Ich freue mich zu träumen, dass ich für Sie von Nutzen war, und Sie sind hier sehr willkommen, wenn es Ihnen Spaß macht, zu kommen, besonders wenn Sie nur eine Traumphantasie von mir sind, denn was sonst können Sie sein? Und jetzt muss ich Sie verlassen, also leben Sie wohl“.

Sie löste ihre Hände, lachte ihr engelhaftes Lachen und wandte sich zum Park. Ich sah ihre große, aufrechte Gestalt und die sich blähenden Röcke und sah, dass sie einigen Damen und Kindern in ein Dickicht folgte, an das ich mich gut erinnerte, und bald war sie außer Sicht.
Mir war, als sei alle Wärme aus meinem Leben verschwunden, als ob eine Freude sich verflüchtigt hätte; als ob ein wertvolles Irgendwas sich aus meinem Besitz zurückgezogen und die Lücke in meiner Begrenzung sich wieder geschlossen hätte.
Lange stand ich in Gedanken da, die Augen fixiert auf die Stelle, wo sie verschwunden war; und ich fühlte mich geneigt, ihr zu folgen, bedachte dann aber, dass dies nicht taktvoll gewesen wäre. Denn auch, wenn sie nur eine Traumphantasie von mir war, ein bloßer Reflex des aufregenden und ereignisreichen Tages, eine abseitige Einbildung meines übermüdeten und erregten Hirns, eine mehr als liebenswerte Einbildung (was sonst hätte sie sein können!), war sie doch auch eine große Dame und hatte mich, einen völlig Fremden und absoluten Nobody mit einzigartig freundlicher Höflichkeit behandelt; die ich wahr und wahrhaftig erwiderte mit einer so tiefen und starken Liebe, dass mein Leben ihr gehörte, mochte sie damit tun, was sie wollte, so war es immer gewesen, seit ich sie das erste Mal sah, und so würde es immer sein, solange ich atmete! Aber ohne ordentliche Vorstellung ergab sich daraus noch keine Bekanntschaft, auch in Frankreich nicht, nicht einmal im Traum. Auch in Träumen muss man höflich sein, selbst den abseitigen Einbildungen eines müden, eines schlafenden Hirns gegenüber.
Und dann: welche Aufgabe hatte sie in diesem meinem speziellen Traum – wie sie selbst es von mir wissen wollte?
Aber war es ein Traum? Ich erinnerte mich an meine Wohnung in Pentonville, die ich gestern Morgen verlassen hatte. Ich erinnerte mich, was ich war – warum ich nach Paris kam; ich erinnerte mich sogar an das Schlafzimmer in dem Pariser Hotel, in dem ich jetzt fest am Schlafen war, an die laut tickende Uhr und an das kärgliche Mobiliar. Und hier war ich, hellwach und bei vollem Bewusstsein, in der Mitte einer alten Straße, die es schon lange nicht mehr gab, die mit einem riesigen Ziegelbau überbaut worden war, ganz bedeckt mit frisch gestrichenem Gitterwerk. Ich hatte dieses Gebäude persönlich vor nur zwölf Stunden gesehen! Und doch war hier alles, wie es in meiner Kindheit gewesen war; und all das durch die Vermittlung dieses soliden Phantoms einer lieblichen jungen englischen Herzogin, deren warme behandschuhte Hände ich nur diese eine Minute in meinen gehalten hatte! Der Duft ihrer Handschuhe haftete noch an meinen Händen; ich sah auf meine Uhr; sie zeigte dreiundzwanzig Minuten vor zwölf. All dies hatte zugetragen in weniger als einer Dreiviertelstunde!
In hoffnungsloser Verwirrung grübelte ich über all dies nach; ich richtete meine Schritte auf mein früheres Zuhause und war zu meiner Überraschung gerade imstande, über die Gartenmauer zu schauen, die ich einmal für etwa zehn Fuß hoch gehalten hatte.
Der alte Apfelbaum stand in voller Blüte, und darunter saß meine Mutter und stopfte kleine Socken; die flachsblonden Ohrlocken (wie sie sie zu tragen pflegte) verdeckten ihr halbes Gesicht. Meine Ergriffenheit, mein Erstaunen war gewaltig. Mein Herz raste. Ich fühlte den Puls in meinen Schläfen und atmete flach.
An einem kleinen grünen Tisch, an den ich mich gut erinnerte, wunderlich angezogen nach einer vergangenen Mode, mit einer Rüsche an seinem offenen Hemdkragen, sein Blondhaar oben recht kurz gehalten, lang an den Seiten und im Nacken. Es war Gogo Pasquier. Er schien ein sehr hübscher kleiner Junge zu sein. Er hatte Feder, Tinte und Heft vor sich und einen goldgefassten Band, gebunden in roten Maroquin. Ich erkannte es auf einen Blick wieder; es war Elegant Extracts. Médor, der Hund, lag schlafend im Schatten. Die Bienen summten in der Kapuzinerkresse und in den Winden.
Ein kleines Mädchen kam von der Portiersloge her die Straße heraufgerannt, drückte gegen das Gartentor, die Glocke ertönte, als es aufging, sie ging in den Garten und ich folgte ihr; aber sie und die anderen nahmen keinerlei Notiz von mir. Es war Mimsey Seraskier.
Ich ging und setzte mich meiner Mutter zu Füßen und sah ihr lange ins Gesicht.
Ich durfte nicht mit ihr sprechen, sie nicht berühren, nicht einmal ihre fleißige Hand mit den Lippen berühren, wenn ich den „Traum nicht trüben“ wollte.
Ich stand auf und sah dem Jungen, sah Gogo über die Schulter. Er übersetzte Grays Elegy ins Französische, war noch nicht sehr weit gekommen und knabberte an der Zeile
„And leaves the world to darkness and to me“.
(Und überlässt die Welt der Dunkelheit und mir.”
Thomas Gray: An Elegy, Written in a Country Churchyard)
Mimsey sah schweigend über seine andere Schulter, den Daumen im Mund, einen Arm auf der Rückenlehne seines Stuhls. Sie schien ebenfalls zu knabbern – es war eine heikel zu übersetzende Zeile.
Ich bückte mich, legte meine Hand auf Medors Nase und fühlte seinen warmen Atem. Er wackelte mit seinem Schwanzstummel und fiepte im Schlaf. Mimsey sagte:
„Regarde Médor, comme il remue la queue! C’est le Prince Charmant qui lui chatouille le bout du nez.” (Sieh nur, wie Médor mit dem Schwanz wackelt! Das ist der Prince Charmant, der ihm die Nasenspitze kitzelt.)
Meine Mutter, die bisher nichts gesagt hatte, sagte: „Sprich Englisch, Mimsey, bitte!“
O mein Gott! Die Stimme meiner Mutter, so vergessen und doch so unsagbar vertraut! Ich lief zu ihr warf mich auf meine Knie vor ihren Füßen, ergriff ihre Hand, küsste sie und rief: „Mutter! Mutter!“

Alles trübte sich seltsam ein. Das Gefühl der Wirklichkeit war verloren. Alles wurde wie ein Traum – aber nur ein Traum; ich erwachte.
*****
Ich erwachte in meinem kleinen Hotelzimmer, sah die Möbel, meinen Hut und die Kleider im Licht einer von draußen herein scheinenden Lampe, hörte das Ticken der Uhr auf dem Kaminsims, das Rumpeln einer Kutsche auf der Straße und das Knallen einer Peitsche, und doch fühlte ich mich kein bisschen wacher, als ich es eine Minute zuvor in meiner seltsamen Vision gewesen war – ja, weniger wach!
Ich hörte das leise Ticken meiner Zwiebel auf dem Sims neben der Kaminuhr, wie ein Pony, das neben einem Großpferd trabt. Die Uhr schlug zwölf. Ich stand auf und sah im Licht der mit Gaslampen erleuchteten Straße auf meine Zwiebel; sie zeigte dieselbe Zeit. Mein Traum hatte eine Stunde gedauert. Ich war um halb elf zu Bett gegangen.
Ich versuchte, mir alles bis zum kleinsten Detail ins Gedächtnis zurück zu rufen – alles, außer der Melodie, die die Drehorgel gespielt hatte und den dazu gehörigen Text; er lag mir auf der Zunge, aber ich bekam ihn nicht heraus. Ich stand wieder auf, ging im Zimmer auf und ab, und spürte, dass es überhaupt kein Traum gewesen war; er war „erinnerlicher“ als all meine Erlebnisse am letzten Tag. Es war kein Traum mehr, war von dem Augenblick an, in dem ich zuerst die Hand der Herzogin berührte, Realität geworden bis zu dem Moment, in dem ich die Hand meiner Mutter küsste und alles sich eintrübte. Es war eine völlig neue und äußerst verwirrende Erfahrung, durch die ich hindurch gegangen war.
In einem Traum gibt es immer Brüche, Unstimmiges, Unzusammenhängendes, Fehler, Lücken in der Kontinuität; viele Glieder fehlen in der Kette, nur stellenweise ist der Eindruck lebhaft genug, um sich hinterher dem wachen Bewusstsein einzuprägen, und selbst dann ist es nie so wirklich lebhaft wie der Eindruck des wirklichen Lebens, obgleich es im Traum so erschienen sein mag. Man erinnert ihn beim Erwachen gut, aber bald verblasst er, und dann ist er nur noch die Erinnerung an das, was man erinnert.
Das gab es in meinem Traum alles nicht.
Es ähnelte der camera obscura auf der Ramsgate Marina Pier: Man geht hinein und befindet sich in völliger Dunkelheit; das Auge ist vorbereitet. Man ist sehr erwartungsvoll und hellwach. Plötzlich blitzt die Ansicht des Hafens auf und des ganzen Lebens darin, mit den Häusern und Kliffs dahinter, in einem bewegten Bild, und weiter entfernt sieht man grüne Hügel, weiße Wolken und blauen Himmel.
Kleine grüne Wellen jagen einander im Hafen und brechen in krossem weißem Schaum. Möwen kreisen, flitzen und tauchen hinter Masten, Tauen und Flaschenzügen; glänzende Messingbeschläge von Gangways und Kompassen blitzen in der Sonne, ohne das Auge zu blenden; fröhliche Liliputaner gehen umher und schwatzen, ihre weißen Zähne, nicht größer als Nadelköpfe, schimmern beim Lachen ohne einen Laut; ein Dampfboot, beladen mit Ausflüglern kommt herein, seine Schaufeln wühlen das Wasser auf, und du kannst sie nicht hören. Keine Kleinigkeit fehlt – kein Knopf auf der Seemannsjacke, kein Haar eines Gesichts. Alles Licht, alle Farben des Meeres, der Erde und des Himmels, sonst auf viele Meilen verteilt, sind hier konzentriert auf wenige Quadratfuß. Und was für Farben! Zum Verzweifeln für Maler! Es ist das Licht selbst, schöner als das, welches durch alte Kirchenfenster mit Glasmalerei strömt. Und alles ist in völlige Dunkelheit gerahmt, so dass die völlig geweiteten Pupillen von äußerster Aufnahmefähigkeit sind. Es sieht aus, als ob all das in Lebensgröße gemalt und dann auf ein Millionstel geschrumpft worden wäre wie ein japanisches Bild auf Krepp, um so die Wirkung zu intensivieren und zu mildern.
Es ist alles vorbei: man kehrt ins Freie, in den Sonnenschein zurück, und alles erscheint grell, nackt, kahl und alltäglich. Aller Zauber ist aus der Szenerie verschwunden; alles ist zu weit von allem entfernt; jeder, den man trifft, erscheint grobschlächtig wie ein Bewohner von Brobdingnag (Land der Riesen in Jonathan Swifts „Gullivers Reisen“) und zu nah. Und dabei hat man seinesgleichen das ganze Leben lang gesehen!
So stand es auch mit meinem Traum, verglichen mit normaler, alltäglicher Wacherfahrung; aber es waren nicht nur flache stumme kleine Bilder, die sich auf einem Dutzend Quadratfuß Bristol-Papier bewegten und ausschließlich die Augen ansprachen; in meinem Traum hatten die Dinge und die Personen dieselbe Körperlichkeit, das selbe Relief wie im Leben und waren lebensgroß; man konnte sich zwischen ihnen und hinter ihnen bewegen und hatte den Eindruck, man könnte sie berühren, umschlingen, umarmen, wenn man es wagte. Und das Ohr wurde nicht weniger als das Auge befreit aus dieser Dunkelkammer des Hirns: Man hörte sie sprechen und lachen wie im Leben. Und das war noch nicht alles, denn sanfte Brisen schmeichelten den Wangen, Spatzen tschilpten, die Sonne verströmte ihr Wärme, und der Duft vieler Blumen vervollständigte die Illusion.
Und dann die Herzogin von Towers! Sie war nicht nur zu sehen und zu hören gewesen wie alles andere, sondern auch berührbar bis zum vollsten Ausmaß der Empfindsamkeit der Nerven meines Tastsinns; als meine Hände die ihren hielten, hatte ich das Gefühl, ich zöge ihr ganzes Leben in meins hinüber.
Mit Ausnahme dieser einen Gestalt, war offensichtlich alles gewesen, wie es einige Jahre zuvor in Wirklichkeit gewesen war, bis zum Summen eines Insekts und dem Welken einer Blüte!
War ich durch irgendeinen Zufall verrückt geworden? Ich hatte die Vergangenheit besessen, wie ich es einige Stunden zuvor ersehnt hatte.
Was sind Gesicht, Gehör, Tastsinn und der Rest?
Im Ganzen fünf Sinne.
Die Sterne, Welten über Welten, so viele Milliarden von Meilen entfernt, was sind sie für uns anderes als bloße glänzende Flecken auf einem Netzwerk von Nerven hinter dem Auge? Wie fühlt man sie dort?
Der Ton der Stimme meines Freundes, was ist das? Der feste Druck seiner Hand, der erfreuliche Anblick seines Gesichts, der Duft seiner und meiner Pfeife, der Geschmack von Brot, Käse und Bier, die wir zusammen essen und trinken, was sind sie, wenn nicht Erfindungen (abseitige Erfindungen vielleicht) des Hirns – kleine Impulse, die zu irgendeinem Zweck durch die Nerven wandern und ohne die es keine Sterne, keine Pfeife, kein Brot, keinen Käse, kein Bier, keine Stimme, keinen Freund und mich nicht gäbe?
Und gibt es nicht vielleicht irgendeinen sechsten Sinn, eingebettet in die Fülle des Fleischs, irgendeinen Atavismus aus der Vergangenheit, der Rasse, unserer eigenen Kindheit sogar, geschwächt durch Nichtgebrauch? oder irgendein Rudiment, irgendeine unschätzbare verborgene Fähigkeit, die sich in Zukunft entwickeln und zur Quelle der Glückseligkeit und des Trosts unserer Nachkommen werden könnte? Einen Nerv, der jetzt nur im Traum erregt und in Schwingung versetzt werden kann, zu zart bis jetzt, um seine Funktion im normalen Alltag zu entfalten?
Und war unter allen Menschen in der Welt – ich, Peter Ibbetson, Architekt und Bauführer, Wharton Street, Pentonville, nutzloser, planloser und ungebildeter Träumer von Träumen – ausersehen, um eine große psychologische Entdeckung zu machen?
Grübelnd über diese ernsten Fragen versank ich wieder in Schlaf, was natürlich genug war, aber nicht mehr in Träume. Ich schlief erholsam bis spät am Morgen und frühstückte in den Bains Deligny, einem entzückenden Schwimmbad in der Nähe des Pont de la Concorde (andere Seite), und verbrachte dort einen Großteil des Tages abwechselnd mit Schwimmen, Dösen, dem Rauchen von Zigaretten, dem Überdenken der Wunder der vergangenen Nacht und der Hoffnung auf eine Wiederholung in der kommenden.
Ich blieb eine Woche in Paris, bummelte tagsüber zwischen den Lieblingsorten meiner Kindheit herum – ein melancholisches Vergnügen – und versuchte nachts „wahr zu träumen“, wie meine Traumherzogin es genannt hatte. Nur einmal hatte ich Erfolg.
Ich war zu Bett gegangen und hatte sehr andauernd vom Mare d’Auteuil geträumt, und mir war, als ob ich, kaum eingeschlafen, dort erwachte und auf Grund der Wirklichkeit und der Freude sofort wusste, dass ich wieder in einen Wahrtraum geraten war. Es war wieder transzendentales Leben – eine wahre Ekstase aktualisierter Erinnerung – und was für eine herrliche Überraschung!
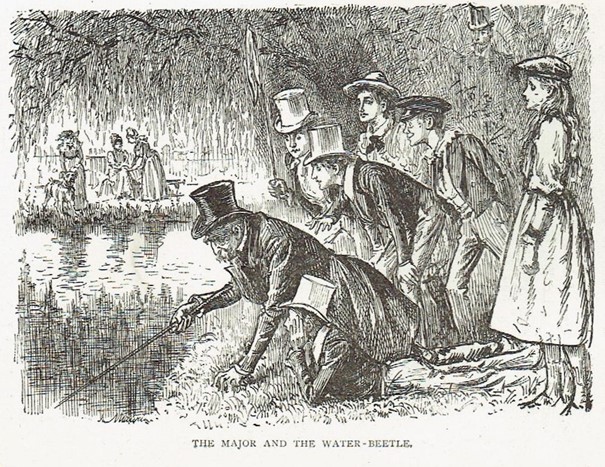
Da war Monsieur le Major in seinem grünen Gehrock, er kniete in der Nähe eines kleinen Rotdorns am Ufer, zwischen dessen ins Wasser reichenden Wurzeln ein durchtriebener alter Gelbrandkäfer hauste, groß wie die Schale eines Esslöffels – eine Beute, die einzufangen wir oft vergebens versucht hatten.
Monsieur le Major hatte ein Netz in der Hand und beobachtete intensiv das Wasser; der Schweiß tropfte ihm von der Nase, und um ihn waren in schweigender, gespannter Erwartung Gogo und Mimsey und meine drei Cousins gruppiert sowie ein witziger sommersprossiger irischer Junge, den ich ganz vergessen hatte, und plötzlich fiel mir ein, dass sein Name Johnstone war, dass er sehr streitlustig war und dass er in der Rue Basse (heute Rue Raynouard) lebte.
Auf der anderen Seite des Teichs hielt meine Mutter Médor vom Wasser zurück aus Angst, er könnte unser Spielverderber werden, und auf der Bank bei der Weide saß Madame Seraskier – die liebliche Madame Seraskier – zutiefst interessiert. Ich nahm an ihrer Seite Platz und starrte sie an mit einem Entzücken, für das es keinen Begriff gibt.
Eine alte Frau kam vorbei, die kegelförmige Waffeln verkaufte und sang: „V‘là l’plaisir, mesdames – V’là l’plaisir!“ Madame Seraskier kaufte für zehn Sous – einen Berg!
Monsieur le Major machte einen spritzenden Fangversuch mit seinem Netz – erfolglos wie üblich. Médor wurde losgelassen und sprang mit einem Satz ins Wasser, der große Wellen rundherum im Mare machte, und tauchte nach einem nicht vorhandenen Stein unter allgemeinem aufgeregtem Gebrüll und Gekreisch. O die vertrauten Stimmen! Ich weinte fast.
Médor kam ohne einen Stein aus dem Wasser, schüttelte sich, krümmte sich, bellte, grinste und rotierte, wie es seine Art war, ganz in meiner Nähe. In meiner Freude und Sympathie war ich schlecht beraten genug, ihn streicheln zu wollen – und sofort wurde der Traum „getrübt“ – verwandelte sich in einen normalen Traum, in dem alles verworren und unbegreiflich war; als Traum noch erfreulich genug, aber in Art und Intensität ein gewöhnlicher Traum; und in meiner Verzweiflung darüber wachte ich auf, und es gelang mir in dieser Nacht nicht, wieder (so, wie ich es mir wünschte) zu träumen.
Am nächsten Morgen (nach einem frühen Bad) ging ich in den Louvre, stand gebannt vor Leonardo da Vincis Mona Lisa und gab mir große Mühe herauszufinden, worin die wundersame Schönheit lag, die man so über den grünen Klee lobte; meine Mühe war nicht sehr erfolgreich, denn ich hatte Madame Seraskier wiedergesehen, und fand, dass die Mona Lisa ein Schwindel war.
Sogleich fiel mir eine Gruppe auf, die hinter mir stand, und ich hörte eine angenehme englische Männerstimme rufen:
„Und nun, Herzogin, möchte ich Ihnen meine erste, letzte und einzige Liebe präsentieren, die Mona Lisa.“ Ich drehte mich um, und da stand ein soldatischer alter Herr mit zwei Damen (und eine von ihnen war die Herzogin von Towers), die das Bild ansahen.
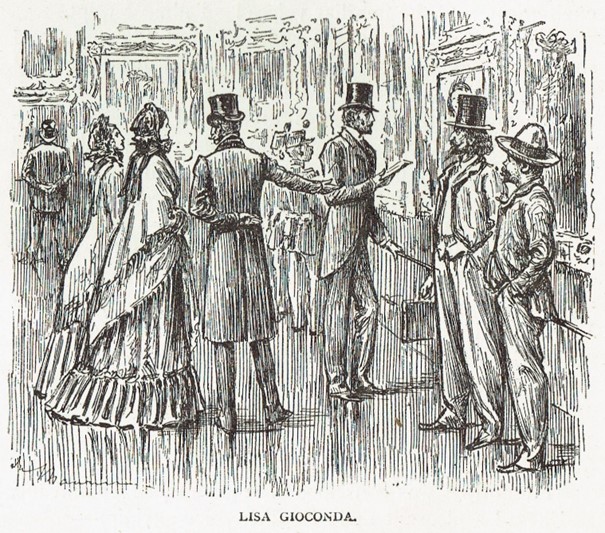
Als ich ihnen Platz machte, traf mich ihr Blick, und darin, wie ich sicher fühlte, einen freundlichen Ausdruck des Wiedererkennens – nur für eine halbe Sekunde. Sie erinnerte sich offenbar, mich bei Lady Cray gesehen zu haben, wo ich den ganzen Abend in einer ziemlich gut sichtbaren Ecke verbracht hatte. Ich war so ungewöhnlich groß (in jener Zeit von nicht so großen Menschen wie heutzutage), dass es leicht war, mich zu bemerken und zu erinnern, besonders weil ich Bart trug, was damals unter Engländern unüblich war.
Sie erriet kaum, wie ich mich an sie erinnerte; sie wusste kaum, was sie mir war und gewesen war – im Leben und im Traum!
Meine Aufregung war so groß, dass ich sie bis in die Knie spürte; ich konnte kaum noch gehen; sie waren weich wie Wasser. Meine Verehrung für die schöne Fremde artete in Wahnsinn aus. Sie war sogar noch schöner als Madame Seraskier. Es war ein Verbrechen, so auszusehen.
Es schien mein Schicksal zu sein, hinzuknien und mich hinzuwerfen vor einer sehr großen, schlanken Frau mit dunklem Haar, Lilienhaut und hellen, engelhaften Augen. Die blonde Jungfer, die in Clerkenwell Kutteln und Schweinefüße verkaufte, war auch von diesem Typ, wie ich mich erinnerte; und das galt auch für Mrs. Deane. Zu meinem Glück ist er nicht allgemein verbreitet!
Den ganzen Tag verbrachte ich auf Uferstraßen und Brücken übers Geländer gelehnt, schaute auf die Seine und hätschelte meine süße Verzweiflung, nannte mich selbst den größten Dummkopf von Paris und erinnerte mich wieder und wieder an den graublauen freundlichen Blick – mein einziges Licht, das Licht der Welt – für MICH!
*****
Meine kurzen Ferien waren vorüber, ich kehrte nach London zurück – nach Pentonville – und nahm meine alten Beschäftigungen wieder auf; aber die ganze Grundhaltung meiner Existenz war verändert.
Der Tag, der Arbeitstag (und ich arbeitete zu Lintots großer Zufriedenheit härter denn je) verging wie in einem unbedeutenden Traum milder Zufriedenheit und freudiger Ergebung in alles, Arbeit oder Spiel.
Ich rebellierte nicht mehr gegen mein Schicksal, noch wollte ich mir selbst auch nur für einen Moment entkommen. Mein ganzes Sein, gleich ob ich in Geschäften oder zu Erholungszwecken unterwegs war, durchflutete die Erinnerung an die Herzogin von Towers mit einer warmen inneren Glut, die mich mit der ganzen Menschheit und mit mir selbst versöhnte und mich in der Hoffnung erbeben ließ, der bezaubernden Hoffnung, ihrem Bild noch einmal bei Nacht in einem Traum zu begegnen, in meiner alten Wohnung in Passy oder irgendwo dort, und vielleicht noch einmal die unsägliche Wonne beim Berühren ihrer Hand zu verspüren. Jedoch warum sollte sie dort sein?
Wenn die gesegnete Stunde des Schlafs schlug, begann mein wirkliches Leben. Ich praktizierte „Wahrträumen“, wie man eine schöne Kunst praktiziert, und nach vielen Fehlversuchen wurde ich ein erklärter Experte – ein Meister.

Ich lag platt auf dem Rücken, die Füße gekreuzt und die Hände überm Kopf symmetrisch verschränkt; ich fixierte mein Wollen intensiv und ausdauernd auf einen bestimmten Punkt in Raum und Zeit meines Gedächtnisses – zum Beispiel auf einen bestimmten Weihnachtsnachmittag, an dem ich, wie ich mich erinnerte, am Straßentor darauf wartete, mit Monsieur le Major einen Spaziergang zu machen – zugleich aber blieb ich immer in Fühlung mit meiner gegenwärtigen Identität als Peter Ibbetson, Architekt, Wharton Street, Pentonville; was gar nicht so einfach zu bewerkstelligen ist, wie man denken sollte, obgleich die Traumherzogin gesagt hatte: „Ce n’est que le premier pas qui coûte“. (Es ist nur der erste Schritt, der schwer ist); und schließlich eines Nachts, statt die gewöhnlichen Träume zu träumen, die ich mein ganzes Leben lang geträumt hatte (aber doppelt), hatte ich die Freude eines Aufwachens am Straßentor, während ich fest schlief, und ich sah Gogo Pasquier auf einem der Steinpfosten sitzen und die verschneite Straße hinauf nach dem Major Ausschau halten. Kurz darauf sprang er auf und seinem alten Freund entgegen, dessen flaschengrün gekleidete Gestalt gerade in einiger Entfernung aufgetaucht war. Ich sah und hörte, wie sie einander warm und freundschaftlich begrüßten, wandelte unbemerkt an ihrer Seite durch Auteuil zum Mare, und zurück an den Festungswerken vorbei, und lauschte auf die spannenden Abenteuer eines Fier-à-bras (Maulheld; Rittersage aus dem 12. Jahrhundert), die ich, ich gestehe es, völlig vergessen hatte.
Als wir alle drei zusammen durch die Porte de la Muette gingen, begann die Kraft des Gedächtnisses (oder der Eingebung) von Monsieur le Major ein wenig zu erlahmen, denn er sagte plötzlich „Cric!“ Aber Gogo erwiderte gnadenlos „Crac!“, und die Geschichte musste fortgesetzt werden, bis wir in der Dämmerung den Eingang von Pasquiers Haus erreichten, wo die beiden sich sehr zärtlich von einander verabschiedeten, nachdem sie sich für den nächsten Tag verabredet hatten; ich ging mit Gogo hinein und saß im Schulzimmer, während Thérèse ihm seinen Tee hinstellte, und ich hörte, wie sie ihm alles erzählte, was sich in Passy an dem Nachmittag zugetragen hatte. Dann las er, rechnete und übersetzte mit seiner Mutter, bis es an der Zeit war, hinauf und ins Bett zu gehen, und ich saß auf seiner Bettkante, während er von der Harfe seiner Mutter in Schlaf gelullt wurde … Wie ich lauschte mit meinen Ohren und mit dem Herzen, bis die süße Spannung der Nacht Platz machte! Dann stahl ich mich aus dem Haus, dachte unsagbare Dinge – durch den schneebedeckten Garten, wo Médor den Mond anbellte – durch die stille Straße, den stillen Park, durch die verlassenen Straßen von Passy – und weiter über trostlose Uferstraßen und Brücken in dunkle Viertel von Paris; bis ich auf meinem Kurs aufwachte und merkte, dass ein neuer trübseliger, gewöhnlicher Tag über London heraufdämmerte – aber für mich war er nicht mehr trübselig und nicht mehr gewöhnlich, mit solchen Erfahrungen, auf die ich zurückblicken und auf die ich mich freuen konnte – einem so seltsamen Vermächtnis von Wunder und Entzücken!
Ich hatte noch einige gelegentliche Fehlschläge mehr, zum Beispiel wenn der Faden zwischen meinem Wach- und meinem Schlafleben durch eine kleine Unaufmerksamkeit oder vielleicht durch eine unabsichtliche Bewegung im Bett zerrissen wurde, wodurch sich die Vision plötzlich eintrübte, ihre Wirklichkeit wurde zerstört, und ein gewöhnlicher Traum trat an die Stelle. Ich wurde mir dessen sofort bewusst, und das genügte, um mich auf der Stelle wach zu machen, und ich würde erneut beginnen, da capo, bis alles wunschgemäß verlief.
Offensichtlich enthält unser Gehirn etwas, was sowohl einer photographischen Platte wie einem phonographischen Zylinder ähnelt – und vielen anderen Dingen derselben Art, die noch nicht entdeckt sind; kein Anblick, kein Ton, kein Geruch geht verloren, kein Aroma, kein Gefühl, keine Gemütsbewegung. Das unbewusste Gedächtnis zeichnet sie alle auf, ohne dass wir beachten, was jenseits der Dinge, die unser direktes Interesse, unsere Aufmerksamkeit erwecken, um uns her vor sich geht.
So sah ich Nacht um Nacht nicht nur gut erinnerte, sondern auch völlig vergessene Szenen wieder aufleben, und diese waren ebenso unverkennbar wahr wie jene, alle getaucht in das unbeschreibliche Licht vergangener Tage, das Licht, das es weder an Land noch auf See gab, und dennoch das Licht der absoluten Wahrheit.
Wie sehr es an Wert und Schönheit das grelle Licht des Alltags übertrifft, in dem zu leben und zu sterben die arme Menschheit sich bisher begnügt hat, weil sie aus Mangel an Wissen den Schatten für die Substanz, den Geist für die Materie hielt! Ich verifizierte die Wahrheit dieser Schlaferfahrungen in jedem Detail: alte Familienbriefe, die ich aufbewahrt hatte und die ich, wieder erwacht, durchsah, bestätigten, was ich in meinem Traum gesehen und gehört hatte; alte Erzählungen erklärten sich selbst. Es war alles vergangene Wahrheit, gesammelt in einer entlegenen Ecke des Hirns und aus der schummerigen Vergangenheit heraufgebracht und aktualisiert, wie ich wollte.
Und seltsam und völlig unerklärlich: Ich sah das alles als ein unabhängiger Zuschauer, als ein Outsider, nicht wie ein Akteur, der Szenen durchlebt, in denen er früher einmal eine Rolle gespielt hat!
Doch viele Dinge verwunderten und verblüfften mich.
Zum Beispiel waren Gogos Rücken und die Rückseite seines Kopfs, wenn ich hinter ihm stand, nicht weniger sichtbar und anscheinend ebenso lebenswahr wie sein Gesicht, und dabei hatte ich seinen Rücken und die Rückseite seines Kopfs nie gesehen; erst viel später lernte ich das Geheimnis der zwei Spiegel kennen. Und dann, wenn Gogo den Raum verließ und dabei manchmal durch mich hindurch zu gehen schien und aus meiner anderen Seite wieder herauskam (was zu einer kurzen Eintrübung des Traums führte), fuhren die anderen fort, genauso vernünftig und natürlich zu reden wie vorher. Haben die Bäume, Mauern und Möbel vielleicht Augen und Ohren gehabt, diese längst vergangenen Bäume, Mauern und Möbel, die nur noch in meinem schlafenden Hirn existierten, und könnten sie den Ton, das Aussehen und die Bedeutung von allem, was passierte, aufbewahrt haben, als Gogo, mein einziger vorstellbarer Erinnerer, weg war?
Françoise, die Köchin, kam in den Salon, um mit meiner Mutter das Essen zu besprechen, wenn Gogo in der Schule war; ich hörte die Anordnungen, die gegeben wurden, und später war ich beim Essen dabei (dem Gogo unveränderlich große Gerechtigkeit widerfahren ließ), und es war genauso, wie meine Mutter es angeordnet hatte. Geheimnis der Geheimnisse!
Was für ein schönes Leben hatten sie mit einander, diese Geister einer vergangenen Zeit! So ein freundlicher, ruhiger, unbeschwerter Stand der Dinge – halb bürgerlich, halb Bohème, und in der ausgeprägten Einfachheit, Verfeinerung und Vornehmheit von Verhalten und Sprache ziemlich aristokratisch.
Die Diener (nur drei – Thérèse, das Hausmädchen, Françoise, die Köchin, und die Engländerin Sarah, die meine Amme gewesen war und jetzt die Zofe meiner Mutter war) standen in freundschaftlichster Beziehung zu uns, sprachen mit uns wie mit Freunden, interessierten sich für unsere Angelegenheiten, und wir interessierten uns für ihre. Ich bemerkte, dass sie uns immer guten Morgen und gute Nacht sagten – eine hübsche französische Sitte der Bürger von Passy in der Zeit von Louis Philippe (er war ein Bürgerkönig).
Auch unsere Küche war bürgerlich. Peter Ibbetson lief das Wasser im Munde zusammen, wenn er (nach seinem Londoner Tenpence-Essen) den Dampf von „soupe à la bonne femme“ sah und roch, von „soupe aux choux“, „pot au feu“, „blanquette de veau“, „bœuf à la mode“, „cotelettes de porc à la sauce piquante“, „vinaigrette de bœuf bouilli“, die endlose Vielfalt guter Dinge, von denen Franzosen schon in so jungem Alter dick werden – und dann der hervorragende Rotwein (für einen Franc die Flasche in jenen glücklichen Tagen): Sein Bukett füllte den Raum, kaum dass der Korken gezogen war!
Wenn so ein Mahl zuende war, kam es manchmal vor, dass „le beau Pasquier“ plötzlich unglaubliche Feuerwerke von Stimmübungen aus der Fülle seines Herzens versprühte, aufsteigende Raketen chromatischer Noten, die in großer Höhe sanft explodiertne und in vollen Kadenzen, Trillern und Koloraturen wie schönfarbige Sterne herunterkamen; und Thérèse schrie: „Ah, q’c’est beau!“ als wäre sie Zuschauerin bei einer wirklichen pyrotechnischen Vorführung; Und sie hatte völlig Recht. Ich habe nie etwas Gleichartiges aus einer menschlichen Kehle gehört und würde es auch nicht für möglich halten. Nur Joachims Geige kann Schönes so schön wiedergeben (Joseph Joachim, jüdischer Violinist).

Vielleicht aber erzählte er uns auch von Wölfen, die er in der Bretagne geschossen hatte, von wilden Keilern im Burgund – denn er war ein großer Sportsmann – oder von seinen Abenteuern als garde du corps von Karl X., oder von den wundervollen Erfindungen, die uns schon in Kürze berühmt und reich machen sollten; und er trank loyal auf Henri V.; und er war so drollig, lebhaft und geistreich, dass man ihm beim Sprechen nicht weniger gern zuhörte als beim Singen.
Aber es gab eine andere, eine Schattenseite dieser ganzen Komödie vergangener Leben.
Sie bauten Luftschlösser und machten Pläne, sprachen von all dem Reichtum und Glück, das sie haben würden, wenn das Schiff meines Vaters heimkam, von all dem Guten, das sie tun wollten, in trauriger Unkenntnis ihrer nächsten Zukunft; die natürlich Vergangenheit und Geschichte war für ihren einen liebevollen Zuhörer.
Dann flossen meine Tränen im unerträglichen Schmerz von Liebe und Mitleid zugleich; sie fielen auf die gebohnerten Böden meines alten Zuhauses in Passy und trockneten dort, und ich fand sie, erwachend, noch nass auf meinem Kissen in Pentonville …
*****
Bald entdeckte ich durch die Praxis, dass ich für ein oder zwei Sekunden mehr als ein bloßer Zuschauer, dass ich wieder ein Akteur sein konnte, um mich (Ibbetson) in mein altes Selbst (Gogo) zu verwandeln und dann berührt und liebkost werden zu können von denen, die ich so sehr liebte. Meine Mutter küsste mich, und ich fühlte es; gerade so lange, wie ich die Luft anhalten konnte, konnte ich mit Madame Seraskier Hand in Hand gehen oder für vier oder fünf Yards Wegstrecke Mimseys Leichtgewicht auf meinem Rücken, ihre Arme um meinen Hals spüren, bevor der Traum eintrübte; und wenn die Trübung mich nicht weckte, verschwand sie bald, und ich war wieder Peter Ibbetson, der unter ihnen herumging oder bei ihnen saß, ihrem Gespräch, ihrem Lachen lauschte, sie bei ihre Mahlzeiten und Spaziergängen beobachtete; zuhörte, wenn mein Vater Lieder sang, meine Mutter süße Musik machte, und immer ungesehen und unbeachtet von ihnen. Darüber hinaus lernte ich bald, auch Dinge zu berühren, ohne den Traum spürbar zu trüben. Ich pflückte eine Rose, steckte sie in mein Knopfloch, und dort blieb sie – aber ach! dieselbe Rose, die ich eben gepflückt hatte, hing auch noch am Rosenbusch! Hob ich einen Stein auf und warf ihn gegen die Wand, wo er, ohne ein Geräusch zu machen, verschwand – lag derselbe Stein noch zu meinen Füßen, wie oft ich ihn auch aufhob und warf!
Aber, so wunderbar es klingt, wenn ich etwas, das mir selbst gehörte, mein Federmesser oder meine Tabaksdose oder irgendein anderes persönliches Traumeigentum warf, so prallte es wie im wirklichen Leben von der Wand zurück, fiel auf den Boden – und blieb dort liegen, bis ich es aufhob – selbst für Tage oder Wochen! War das nicht verrückt?
Keine wache Freude kann die vielschichtigen Freuden auch nur annäherungsweise vermitteln, die ich im Schlaf hatte; wache Freuden scheinen im Vergleich so unbedeutend, so vage zu sein – so viel entgeht den Sinnen durch den Mangel an Konzentration und ungeteilter Aufmerksamkeit, die wachen Wahrnehmungen sind so plump.
Es war ein Leben in einem Leben – ein intensiveres Leben, in welchem die frischen Wahrnehmungen der Kindheit sich verbanden mit der Magie des Traumlands, und in der es nur eine einzige, wie ein Löwe brüllende Sehnsucht gab, nämlich die, die Herzogin von Towers erneut in jenem Land der Träume zu treffen.
*****
So machte ich eine Zeitlang weiter, einsamer denn je, aber meine Einsamkeit wurde gut aufgewogen durch dies seltsame neue Leben, das sich mir eröffnet hatte und nicht aufhörte, mich zu verwundern und zu erfreuen – als ich eines Morgens eine Karte von Lady Cray bekam, die in Cray, ihrem Landsitz in Hertfordshire, einige Ställe gebaut haben wollte und mich bat, für einen Tag und eine Nacht dorthin zu kommen.
Ich musste diese Einladung natürlich schon aus geschäftlichen Gründen annehmen; als Freund schien Lady Cray mich schon vor langer Zeit „wie eine heiße Kartoffel“ fallen gelassen zu haben, wobei sie glücklicherweise nicht bemerkt hatte, dass ich es war, der sie fallen ließ.
Aber sie empfing mich wie einen Freund – wie einen alten Freund. All meine Scheu und Versnobtheit fielen bei der bloßen Berührung ihrer Hand von mir ab.
Ich war in Cray früh am Nachmittag angekommen und hatte mich sofort an meine Arbeit gemacht, für die ich einige Stunden brauchte, so dass ich gerade noch rechtzeitig zum Haus kam, um mich zum Abendessen anzuziehen.
Als ich in den Salon kam, waren dort einige Leute, und Lady Cray stellte mich einer jungen Dame vor, der Tochter des Vikars, die ich zum Abendessen begleiten sollte.
Ich war sehr beeindruckt, als ich von ihr hörte, dass zu der im Salon versammelten Gesellschaft kein Geringerer als Sir Edwin Landseer (engl. Tier- und Landschaftsmaler) gehörte. Vor vielen Jahren hatte ich den Stich eines seiner Bilder für Mimsey Seraskier kopiert. Es hieß „Die Herausforderung“ oder „Kommende Ereignisse werfen ihren Schatten voraus“. Ich richtete meinen Blick auf den wunderlichen kleinen Mann, der äußerst redselig und freundlich zu sein schien, völlig unbeeindruckt von seinem Ruhm.
Ein Gast hatte sich verspätet, und Lord Cray, der mit gereizter Ungeduld auf sein Essen wartete, rief:
„Mary wäre nicht Mary, wenn sie pünktlich wäre!“
In diesem Augenblick trat Mary ein – und Mary war niemand Geringeres als die Herzogin von Towers!
Meine Knie zitterten; aber es war nicht die Zeit, um einer solchen zärtlichen Schwäche nachzugeben. Lord Cray ging mit ihr weg; hintereinander trat man in Prozession ins Esszimmer ein, irgendwo an ihrem Ende meine junge Vikarin und ich.
Die Herzogin saß weit von mir entfernt, aber unsere Blicke trafen sich für einen Moment, und ich bildete mir ein, wieder den Schimmer freundlichen Wiedererkennens darin gesehen zu haben.
Meine Tischnachbarin war bezaubernd und fragte mich, ob ich die Herzogin von Towers nicht für die schönste Frau hielte, die ich je gesehen hätte.

Ich pflichtete ihr sehr wohlwollend bei und erfuhr, dass sie nicht weniger gut als schön und nicht weniger klug als gut sei (als ob ich das nicht gewusst hätte); dass sie ihr letztes Hemd weggeben würde; dass sie für andere alles auf sich nähme; dass sie mit ihrem Ehemann nicht gut zurechtkam, er trinke und sei insgesamt ein schlechter und abscheulicher Mensch; dass sie einen großen Kummer habe – ihr einziges Kind, um das sie sich hingebungsvoll kümmere, sei ein Idiot und werde eines Tages der Herzog von Towers sei; sie sei hochgebildet, eine bedeutende Sprachwissenschaftlerin, eine große Musikerin und überhaupt die beliebteste Frau in der gesamten englischen Gesellschaft.
Ach! wer liebte die Herzogin von Towers mehr als dieser armselige Schreiberling, in dessen Seele sie lebte und strahlte wie ein besonderer, heller Stern – wie die Sonne; und der, ohne es zu merken, schnell in die Sphäre ihrer Anziehungskraft gezogen wurde, wie Lintot es ausgedrückt hätte; und eines Tages völlig und, da bin ich sicher, für immer aufgesaugt sein würde!
„Und wer war diese wundervolle Herzogin von Towers, bevor sie heiratete?“, fragte ich.
„Sie war ein Fräulein Seraskier. Ihr Vater war ein ungarischer Arzt und Sozialreformer – eine bezaubernde Persönlichkeit; daher hat sie ihre Umgangsformen. Ihre Mutter, die sie bereits im Kindesalter verlor, war ein sehr schönes irisches Mädchen von guter Familie, Cousine ersten Grades von Lord Cray, eine Miss Desmond, die mit jenem interessanten Patrioten durchbrannte. Sie lebten irgendwo bei Paris. Dort starb Madame Seraskier auch an der Cholera … Was ist los? Fühlen Sie sich nicht wohl?“
Ich stellte klar, dass die Hitze mir zusetzte, und verbarg, so gut ich konnte, die Flut von Gefühl und Fassungslosigkeit, die mich überwältigte.
„O, liebste kleine Mimsey, mit deinen armen dünnen Ärmchen um meinen Hals und deiner kalten blassen Wange an meiner. Dort fühlte ich sie noch letzte Nacht! Aufgewachsen zu sein zu einer glanzvollen Vision weiblicher Gesundheit, Kraft und Schönheit wie dieser – mit dem bezaubernden, immer bereiten Lächeln und Lachen! Warum, natürlich, jene damals so nackten Lider, heute so dick bewimpert! – wie konnte ich sie verkenne? Ach, Mimsey, du lächeltest oder lachtest nie in jenen Tagen, andernfalls hätte ich deine Augen wiedererkannt! Ist es möglichß Ist es denn möglich?“
So redete ich mit mir selbst, bis die Damen aufstanden, meine blonde junge Begleiterin drückte ihre freundliche Sorge und höfliche Hoffnung aus, dass ich bald wieder ich selber wäre.
Ich saß still da, bis es an der Zeit war, sich den Damen anzuschließen (ich konnte nicht einmal den geistreichen und funkelnden Anekdoten des Malers folgen, der den Tisch unterhielt); ich ging dann hinauf in mein Zimmer. Ich konnte ihr nicht so bald gegenübertreten nach dem, was ich jetzt gehört hatte.
Der gute Lord Cray kam, um sich freundlich nach mir zu erkundigen, aber ich überzeugte ihn schnell, dass mein Unwohlsein ohne Bedeutung sei. Er blieb jedoch und redete; das Essen schien ihm geschmeckt zu haben, und er wollte rauchen (und suchte jemanden, der mit ihm rauchte), was er im Esssaal nicht hatte tun können, weil dort ein ehrwürdiger alter Bischof zugegen war. So drehte er sich wie ein Franzose eine kleine Zigarette und qualmte nach Herzenslust.
Er erriet kaum, wie sehr sein bescheidener Architekt ihn sich wegwünschte, bis er von der Herzogin von Towers zu sprechen begann – „Mary Towers“ nannte er sie – und mir sagte, wie sehr „Towers“ es verdiene, verjagt und am Wagenheck ausgepeitscht zu werden. „Warum? Weil sie die beste und schönste Frau Englands ist – und dabei von äußerster Klugheit! Ohne sie wäre er schon vor langer Zeit bankrott gewesen“, etc. „Es gibt keine Herzogin in England, die ihr das Wasser reichen könnte, weder im Aussehen, noch in der Klugheit, noch in der Erziehung. Ihre Mutter (die hübscheste Frau, die je gelebt hat – außer Mary) war mit mir verwandt; daher hat sie ihre Umgangsformen!“ etc.
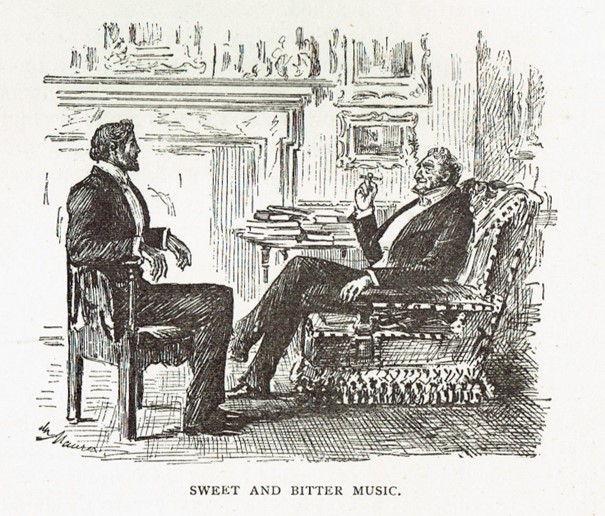
Die Worte des edlen Earls waren Musik in meinen Ohren – süße und bittere Musik.
Mary! Was für ein himmlischer Name, besonders auf englischen Lippen und ausgesprochen auf englische Art mit dem anbetungswürdigen y! Große Männer liebten es leidenschaftlich – Byron, Shelley, Burns. Aber keiner, dünkt mich, leidenschaftlicher und mit besserem Grund als ich.
Und doch muss es auch dann und wann, hier oder dort eine böse oder sogar eine hässliche Mary geben. Und wirklich, es gab einst eine Bloody Mary, die beides war! Es scheint unglaublich.
Mary, wahrhaftig! Warum nicht Hekuba? Denn was war ich der Herzogin von Towers? (Anspielung auf Hamlet)
Als ich wieder allein war, ging ich zu Bett, und versuchte auf dem Rücken zu schlafen, die Arme überm Kopf, in der Hoffnung auf einen Wahrtraum; aber der Schlaf stellte sich nicht ein und ich verbrachte eine weiße Nacht, wie der Franzose sagt. Ich stand früh auf, ging in den Park und versuchte, mich bis zur Frühstückszeit für die Ställe zu interessieren. Niemand war auf, und ich frühstückte allein mit Lady Cray, die so freundlich war, wie sie sein konnte. Ich glaube nicht, dass sie meine Gesellschaft besonders witzig gefunden hat. Dann ging ich, um nachzudenken, zurück zu den Ställen und schlief ein.

Gegen zwölf hörte ich das Geräusch von Holzkugeln und entdeckte einen Rasen, auf dem ein paar Leute „Krocket“ spielten. Es war damals noch ein ziemlich neues Spiel und kam erst wenige Jahre später in Mode.
Ich setzte mich unter eine große Traueresche neben dem Rasen; es war wie in einem Zelt, mit Stühlen und Tischen darunter.
Kurz darauf kam Lady Cray dorthin mit der Herzogin von Towers. Ich wollte fliehen, aber ich blieb wie angewurzelt dort.
Lady Cray stellte mich vor, und fast im gleichen Augenblick kam ein Dienermit einer Botschaft für sie, und ich war allein mit der einzigartigsten Frau der Welt! Ich hatte das Herz auf den Lippen, meine Kehle war trocken, der Puls pochte in meinen Schläfen.
Sie fragte mich auf die natürlichste Art und Weise, ob ich Krocket spiele.
„Ja – nein – doch, manchmal – das heißt, ich habe davon noch nicht gehört – o – ich vergesse!“ Ich stöhnte ob meines Schwachsinns und verbarg mein Gesicht in den Händen. Sie fragte, ob mir noch unwohl sei, ich verneinte. Und dann begann sie leichthin über nichts oder irgendwas zu reden, bis ich mich wieder besser fühlte.
Ihre Stimme! Ich hatte sie bisher nur im Traum gut gehört – und es war die selbe – eine sehr reiche und modulierte tiefe Altstimme – mit vielen unterschiedlichen und entzückenden Tonfällen; und sie war lebhafter beim Sprechen als die meisten Engländerinnen und erinnerte mich dadurch an Madame Seraskier. Ich bemerkte, dass ihre Hände lang und sehr schmal waren, auch ihre Füße, und erinnerte mich, dass das bei Mimsey genauso war – dass sie für das einzig Schöne an Mimsey gehalten wurden. Ich bemerkte auch eine fast unsichtbare Narbe an ihrer linken Schläfe und erinnerte mich aufgeregt, dass ich sie im Traum gesehen hatte, als wir die Straße zusammen hinaufgingen. Im Wachzustand war ich ihr nie nah genug gewesen, um eine kleine Narbe zu bemerken, und Mimsey hatte in alter Zeit eine solche Narbe nicht gehabt, dessen war ich mir sicher, denn ich hatte Mimsey noch kürzlich viel gesehen.
Ich gewöhnte mich an die Situation und wagte zu sagen, dass ich sie einmal bei Lady Cray in London gesehen hätte.
„O ja, ich erinnere mich. Giulia Grisi sang die Weidenarie!“ Dann kräuselte sie ihre Augen schmal, sie lachte, errötete und fuhr fort: „Ich sah Sie in einer Ecke unter dem berühmten Gainsborough stehen. Sie erinnerte mich an einen lieben kleinen französischen Jungen, den ich einmal kannte, er war sehr nett zu mir, als ich ein kleines Mädchen in Frankreich war, und Sie sehen zufällig seinem Vater ähnlich. Aber ich fand heraus, dass Sie Sie Mr. Ibbetson, ein englischer Architekt sind, ein, wie Lady Cray mir sagte, kommender Mann.“
„Ich war einmal ein kleiner Franzose. Aus Gefälligkeit einem Verwandten gegenüber musste ich meinen Namen ändern – d.h. ich war in Wirklichkeit immer ein Engländer, wissen Sie.“
„Du lieber Himmel, wie ungewöhnlich! Wie war denn Ihr Name damals?“
„Pasquier, Gogo Pasquier!“, stöhnte ich, Tränen stiegen mir in die Augen, und ich sah beiseite. Die Herzogin antwortete nicht, und als mich ihr wieder zuwandte, sah sie mich an, sehr bleich, die Lippen ganz weiß, ihre Hände fest verschränkt in ihrem Schoß, und sie zitterte am ganzen Körper.
Ich sagte: „Sie waren damals Mimsey Seraskier, und ich trug Sie oft Huckepack.“
„Hören Sie auf! Hören Sie auf!“, sagte sie und begann zu weinen.
Ich stand auf und ging unter der Esche herum, bis sie ihre Tränen getrocknet hatte. Die Krocket-Spieler konzentrierten sich auf ihr Spiel.
Ich setzte mich wieder neben sie. Sie hatte ihre Augen abgetupft und sagte nach einiger Zeit:
„Wie furchtbar es Ihrem armen Vater, Ihrer Mutter und meiner Mutter ergangen ist! Erinnern Sie sich an sie? Sie starb eine Woche nach Ihrer Abreise. Ich ging mit Papa – Dr. Seraskier – nach Russland. Was war das für ein schrecklicher Aufbruch!“
Und so begannen wir ganz natürlich von alten Zeiten und lieben Toten zu reden. Sie schaute mir immer in die Augen. Nach einer Weile sagte ich:
„Ich bin nach Passy gereist und fand alles verändert und überbaut. Ich bin fast verrückt geworden, als ich das sah. Ich ging nach St. Cloud und sah Sie im Wagen mit der französischen Kaiserin. In der Nacht hatte ich einen ausgefallenen Traum! Ich träumte, ich würde durch die Rue de la Pompe stolpern, wäre gerade zum Straßentor gekommen, und da waren Sie“.
„Gnädiger Himmel!“, flüsterte sie, wurde wieder weiß und zitterte am ganzen Körper; „was meinen Sie?“
„Ja“, sagte ich. „Ihr Kommen war meine Rettung. Ich wurde von schrecklichen Gnomen verfolgt.“
Sie: „Gnädiger Himmel! Von – von zwei kleinen Schließern, einem Mann und seiner Frau, die tanzten und versuchten, dich einzusperren?“
Jetzt war ich an der Reihe, „gnädiger Himmel!“ auszurufen. Wir schlotterten und zitterten gemeinsam.
Ich sagte: „Du gabst mir deine Hand, und alles kam sofort wieder ins Lot. Meine alte Schule erhob sich an Stelle des Gefängnisses.“
Sie. „Mit einem gelben Omnibus? Und Jungen, die zu ihrer première communion fuhren?“
Ich: „Ja. Und es gab eine Menschenmenge – Père und Mère François, Madame Liard, die Frau des Krämers, und – und Mimsey Seraskier mit ihrem kurz geschorenen Kopf. Und eine Drehorgel spielte eine Melodie, die ich gut kannte, jetzt aber nicht zusammenbekomme …“
Sie: „War es nicht ‚Maman, les p’tits bateaux‘?“
Ich: „O, natürlich!“
‚Maman, les p’tits bateaux
Qui vont sur l’eau,
Ont-ils des jambes?‘“
Sie: „Das ist es!
‚Eh oui, petit bêta!
S’ils n’avaient pas
Ils n’marcheraient pas!’”
(Mama, die kleinen Schiffe,
die auf dem Wasser gehen/fahren/schwimmen,
haben sie Beine?
Na klar, kleiner Dummkopf!
Wenn sie keine hätten,
würden sie nicht gehen/fahren/schwimmen.)
Sie sank zurück in ihren Stuhl, blass und hingestreckt. Nach einer Weile –
Sie: „Und dann gab ich dir gute Ratschläge, wie man wahr träumt, und wir gingen zu meinem alten Haus, und ich wollte, dass du die Buchstaben über dem Portikus liest, du last sie falsch, und ich lachte.“
Ich: „Ja, ich las ‚Tête Noire‘. War das nicht verrückt?“
Sie: „Und dann berührte ich dich wieder, und du last ‚Parvis Notre Dame‘.“
Ich: „Ja, und du berührtest mich wieder und ich las ‚Parva sed apta‘ – klein, aber tauglich.“
Sie: „Das bedeutet es? Nein, als du ein Junge warst, erzähltest du mir, sed apta sei ein Wort und sei Lateinisch für Pavillon. Das habe ich bisher geglaubt und gedacht, ‚Parva sed apta‘ hieße petit pavillon!“
Ich: „Ich erröte für mein schlechtes Latein! Anschließend gabst du mir wieder einen guten Rat, nämlich nichts zu berühren und keine Blumen zu pflücken. Das habe ich auch nie getan. Und dann gingst du fort in den Park – das Licht verließ mein Leben, mein schlafendes und mein wachendes. Seither habe ich nie wieder von dir träumen können. Ich fürchte, ich werde dich nie wieder sehen nach dem heutigen Tag!“
Hiernach schwiegen wir lange Zeit, obgleich ich hin und wieder herumstotterte und zu sprechen versuchte. Ich war krank vom Widerstreit meiner Gefühle. Schließlich sagte sie:
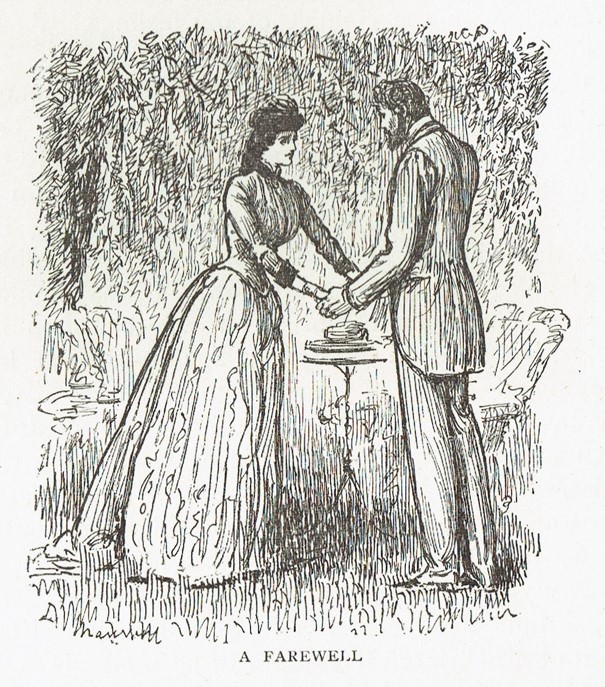
„Lieber Mr. Ibbetson, das ist alles so außergewöhnlich, dass ich gehen und über alles nachdenken muss. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel es mir bedeutet, Sie wiedergesehen zu haben. Und dieser doppelte, uns beiden gemeinsame Traum! Ich bin betäubter, als ich ausdrücken kann, und habe das Gefühl, ich träumte jetzt – aber dies alles kommt mir so unwirklich und unmöglich vor – so unwahr! Wir sollten jetzt besser auseinander gehen. Ich weiß nicht, ob ich Sie jemals wiedersehen werde! Sie werden oft in meinen Gedanken, aber nie wieder in meinen Träumen sein – das zumindest kann ich bestimmen – noch werde ich in Ihren sein; es darf nicht sein. Mein armer Vater lehrte mich zu träumen, bevor er starb, damit ich in Träumen unschuldigen Trost fände für die Kümmernisse meines Wachlebens, die zahlreich und groß sind, wie seine waren. Wenn ich sehe, dass es zu irgendwas gut ist, will ich schreiben – aber nein – Sie dürfen keinen Brief erwarten. Ich sage Ihnen jetzt Lebewohl und verlasse Sie. Sie reisen noch heute ab, nicht wahr? Das ist das Beste. Ich denke, dies sollte ein letztes Adieu sein. Ich kann Ihnen nicht sagen, von welcher Bedeutung Sie für mich sind und immer waren. Ich dachte, Sie wären längst tot. Wir werden oft aneinander denken – das ist unvermeidlich – aber niemals, niemals träumen. Das geht nicht.
Lieber Mr. Ibbetson, ich wünsche Ihnen alles Gute, das ein menschliches Wesen einem anderen wünschen kann. Und nun leben Sie wohl, und möge Gott im Himmel Sie segnen.“
Sie erhob sich, zitternd und weiß, die Augen tränennass, drückte fest meine Hände und verließ mich, wie sie mich im Traum verlassen hatte.
Das Licht verließ mein Leben, und ich war wieder allein – elender und erbärmlicher allein, als wenn ich sie nie getroffen hätte.
Ich ging zurück nach Pentonville und nahm äußerlich den Faden meines monotonen Lebens wieder auf, aß, trank, arbeitete und ging herum wie gewöhnlich, aber als jemand in einem gewöhnlichen Traum. Ab jetzt waren Träume – Wahrträume – die einzige Realität für mich geworden.
Ein so großes, unfassbares und beispielloses Wunder hatte sich in einem Traum verwirklicht, dass alle Lebensbedingungen sich geändert und gedreht hatten.
Ich und ein anderes Menschenwesen hatten sich getroffen – tatsächlich und wirklich getroffen – in einem doppelten Traum, einem uns beiden gemeinsamen Traum, und unsere Hände hatten einander umfasst! Und wir hatten beide Worte zu einander gesagt, die keiner je vergessen würde oder könnte.
Und dieses andere Menschenwesen und ich hatten einander für Jahre im Schrein des Gedächtnisses bewahrt – seit der Kindheit – und waren jetzt durch ein so wunderbares Band, eine so unerhörte Erfahrung miteinander verbunden, dass, solange Leben, Wahrnehmung und Erinnerung andauerten, keiner je außerhalb der Gedanken des anderen sein konnte.
Als wir miteinander unter der Esche in Cray sprachen, war mir ihr Selbst weniger lebhaft gegenwärtig, als es ihr anderes, mir lieberes Selbst gewesen war, mit dem ich die Straße in der balsamischen Traumatmosphäre hinaufwandelte; für einige kurze Augenblicke lebten wir und bewegten uns gemeinsam und teilten unser Sein, auch wenn wir glaubten, der andere sei eine bloße Erfindung seiner (und ihrer) schlafenden Vorstellungskraft, eben der Stoff, aus dem Träume sind.
Und siehe! es war alles wahr – so wahr wie die gewöhnliche Alltagserfahrung – ja, mehr (zehnmal mehr), weil wir uns des wirklichen inneren Seins des anderen durch unsere schärferen und erregteren Sinneswahrnehmungen und die weniger zersplitterte Aufmerksamkeit viel bewusster und weil wir wahrscheinlich enger miteinander verknüpft waren an einem Ort als je zwei Sterbliche seit Anfang der Welt.
Das Umfassen der Hände im Traum – wie unendlich viel mehr hatte es dem einen vom andern verraten als das traurige Lebewohlumfassen in Cray!
In meinem armen äußeren Leben wartete ich vergebens auf einen Brief; vergebens suchte ich die Parks und Straßen heim – die Straße, in der sie wohnte – in der Hoffnung, sie noch einmal zu sehen. Das Haus war geschlossen. Sie war weg – in Amerika, wie ich später erfuhr – mit ihrem Mann und dem Kind.
Bei Nacht, in den Familienszenen, die ich so gut herauf zu beschwören gelernt hatte, erforschte ich jede Nische und Ecke in dem immer gleichen schmachtenden Verlangen, eine Spur von ihr zu finden. Ich war nie weit von „Parva sed apta“ entfernt. Dort waren Madame Seraskier und Mimsey und der Major und meine Mutter und Gogo, zu allen Zeiten, drinnen und draußen, und sie ahnten von meiner körperlichen Anwesenheit so wenig, als ob ich nie existiert hätte. Wenn ich Mimsey und ihre Mutter ansah, wunderte ich mich, wie ich so beschränkt hatte sein können, nicht auf den allerersten Blick zu erkennen, wer und wessen Tochter die Herzogin von Towers einmal gewesen war. Die Größe, die Stimme, die Augen, bestimmte Eigenheiten des Gangs und der Gestik – wie konnte es sein, dass ich sie nach solchen frischen Traumbegegnungen nicht wieder erkannte?
Und Seraskier, der sie alle überragte, wie seine Tochter nun die Frauen überragte. Ich sah, dass er in seiner Tochter wieder auferstand; ihr Lächeln, das die Augen nach oben schloss, hatte sie von ihm; hätte Mimsey damals je gelächelt, an diesem sehr charakteristischen Zug hätte ich sie wieder erkannt.
Von seiner Tochter (der Mimsey vergangener Jahre, nicht der Herzogin von heute) konnte ich jetzt nie genug bekommen und ließ sie alle Szenen mit Gogo, meiner und ihrer Erinnerung so teuer, noch einmal erleben. Ich war wirklich der Prince Charmant, von dessen unsichtbarer Gegenwart sie auf unbegreifliche Weise überzeugt war. Welch eine merkwürdige Vorahnung! Aber wo war die Fee Tarapatapoum? Sie war nie da während dieses Jahres unsäglichen Verlangens; sie hatte es gesagt; nie, nie wieder sollte ich in ihrem Traum sein oder sie in meinem, so ausdauernd wir auch anwesend waren in den Gedanken des jeweils anderen.
So vergingen zwölf Monate nach dem letzten Treffen im Fleisch in Cray.
*****
Und jetzt, mit widerstrebendem Herzen und sich sträubender Feder, muss ich zur großen Katastrophe meines Lebens kommen, über die in so wenigen Worten wie möglich zu berichten ich mich bemühen will.
Wenn der Leser ausdauernd genug war, um nichts zu überspringen, wird er sich an die hübsche Mrs. Deane in Hopshire erinnern, an die ich vor einigen Jahren mein Herz verloren zu haben glaubte.
Ich hatte sie seither nicht gesehen, hatte sie sogar fast vergessen, hatte aber vage gehört, dass sie Hopshire verlassen und in London einen reichen Mann geheiratet hätte, der sehr viel älter sei als sie.
Eines Tages war ich im Hyde Park, schaute mir die Leute auf dem Rundfahrweg an, als eine brandneue offene Kutsche vorbeikam, und darin saß ganz allein in aller Pracht die gewesene Mrs. Deane und sah sehr mürrisch aus. Sie erkannte mich und nickte, und ich nickte zurück, das Herz flatterte für einen Moment ein wenig – unfreiwilliger Tribut an Auld-lang-syne – und ich setzte meinen Weg fort und fragte mich, warum ich sie je bewundert hatte.
Kurz darauf wurde mir zu meiner Überraschung an den Ellenbogen getippt. Es war Mrs. Deane – ich will sie weiter so nennen. Sie war ausgestiegen und war mir zu Fuß gefolgt. Es war ihr Wunsch, dass ich mit ihr um den Park fuhr und über alte Zeiten redete. Ich gehorchte, und wurde so zum ersten und letzten Mal Teil jener stolzen und fröhlichen Prozession, die ich so oft mit neugierigen Blicken verfolgt hatte.
Sie schien sehr erpicht zu erfahren, ob ich mich je mit Colonel Ibbetson ausgesöhnt hätte, und freute sich zu hören, dass das nicht der Fall war und wahrscheinlich auch nie der Fall sein würde, weil meine Gefühle ihm gegenüber hart, bitter und dauerhaft waren.
Sie schien ihn sehr zu hassen. Sie erkundigte sich freundlich nach mir und meinen Lebensaussichten, schien aber nicht sonderlich interessiert an meinen Antworten – bis ich später von meinem französischen Leben, meinem lieben Vater, meiner lieben Mutter erzählte, das hörte sie sich mit eifrigem Mitgefühl an, und ich war sehr gerührt. Sie fragte, ob ich Bilder von ihnen hätte; ich hatte welche – ganz ausgezeichnete Miniaturen; und als wir uns trennten, hatte ich ihr versprochen, sie am nächsten Nachmittag zu besuchen und diese Miniaturen mitzubringen.
Sie schien eine träge Frau zu sein, sehr gelangweilt und offenbar ohne einen größeren Bekanntenkreis. Sie sagte mir, dass ich die einzige Person im Park gewesen sei, der sie an diesem Tag zugenickt hätte. Ihr Ehemann war in Hamburg, und sie wollte ihn in ein oder zwei Tagen in Paris treffen.
Ich hatte nicht so viele Freunde und war deshalb glücklicher als sonst, sie getroffen zu haben und besuchte sie bereitwillig mit den Porträts, wie ich es versprochen hatte.

Sie wohnte in einem großen, neuen, schön eingerichteten Haus nicht weit vom Marble Arch. Sie war ganz allein, als ich kam, und fragte mich sofort, ob ich die Miniaturen dabei hätte; sie schaute sie mit großem Interesse an, dann schaute sie mich an und rief:
„Gott im Himmel, Sie sind das Ebenbild Ihres Vaters!“
Als das war ich in der Tat immer angesehen worden.
Insbesondere trafen sich sowohl seine als auch meine Augenbrauen auf einzigartige und charakteristische Weise über der Nasenwurzel, und sie schien davon sehr betroffen zu sein. Er war dargestellt in der Uniform von Karls X. Leibgarde, in der er zwei Jahre gedient und sich den Spitznamen le beau Pasquier erworben hatte. Mrs. Deane schien nicht müde zu werden, es anzuschauen und bemerkte, dass mein Vater „das absolute Ideal eines Jungmädchentraums“ gewesen sein müsse (ein indirektes Kompliment, das mich erröten ließ nach dem, was sie gerade über unsere Ähnlichkeit gesagt hatte. Ich begann mich fast zu fragen, ob sie versuchen wollte, mich wieder zum Narren zu machen, wie sie es so erfolgreich vor einigen Jahren getan hatte).
Dann interessierte sie sich wieder für mein früheres Leben und für Erinnerungen daran und wollte wissen, ob meine Eltern einander geliebt hätten. Sie waren einander sehr ergeben, ähnelten einem Liebespaar, hatten sich auf den ersten Blick in einander verliebt, waren einander bis zum Tod treu, und das erzählte ich ihr; und so fort, bis ich anfing, ziemlich aufgeregt zu werden, weil ich mir vorstellte, sie müsse von irgendeinem Vermögen gehört haben, auf das ich ein Recht hatte und das mir durch die Intrigen eines bösartigen Onkels vorenthalten wurde.
Denn ich hatte in meinen Träumen schon längst herausgefunden, dass er der ärgste Feind meines Vaters und die Hauptursache von dessen finanziellem Ruin gewesen war – durch selbstsüchtige, herz- und ehrlose Handlungen, die hier zu erklären zu kompliziert wäre – ein richtiger Shylock.
Ich hatte das herausgefunden, als ich (in meinen Träumen) langen Gesprächen meines Vaters mit meiner Mutter im alten Salon in Passy lauschte, während Gogo in sein Buch vertieft war; jedes Wort, das durch Gogos unaufmerksame Ohren in sein anderweitig beschäftigtes kleines Hirn drang, war dort wie von einem Phonographen aufgezeichnet worden und wurde nun wieder und wieder für Peter Ibbetson, während er unbemerkt unter ihnen saß, wiederholt.
Ich fragte sie scherzend, ob sie schon bemerkt habe, dass ich von Rechts wegen zufällig der Erbe von Ibbetson Hall sei.
Sie antwortete, nichts würde sie mehr erfreuen, aber ein so großes Vermögen sei weder für sie noch für mich auf Lager; dass sie schon vor langer Zeit erkannt habe, dass Colonel Ibbetson der größte ungehängte Schuft sei, und nichts, was sie noch entdecke, könne ihn schlimmer machen.
Ich erinnerte mich dann, wie er oft von ihr gesprochen hatte, sogar zu mir, und dabei auf Dinge anspielte oder sie unterstellte, die zweifellos unwahr waren und denen ich nicht glaubte. Nicht dass die Frage ihrer Wahrheit oder Unwahrheit ihn weniger verächtlich und abscheulich machte, weil er sie erzählte.
Sie fragte mich, ob er je zu mir von ihr gesprochen hätte, und nach viel Überredung und geschicktem Kreuzverhör gab ich ihr so viel von der Wahrheit preis, wie ich mich traute, und sie wurde zur Tigerin. Sie versicherte mir, dass er es fertig gebracht habe, sie in Hopshire so zu beleidigen und zu kompromittieren, dass sie und ihre Mutter wegziehen mussten, und sie schwor mir feierlich (und sie sprach die Wahrheit, das glaube ich fest), dass es nie eine Beziehung zwischen ihnen gegeben habe, zu der sie sich nicht vor der ganzen Welt hätte bekennen können.
Sie hatte ihn wegen seines Reichtums und seiner Position wirklich heiraten wollen; denn sowohl sie als auch ihre Mutter waren sehr arm, und oft sei es sehr schwer gewesen, sich nach der Decke zu strecken und den Schein des Anstands für die Welt aufrecht zu erhalten; er hatte sie ausgewählt, ihr von Anfang an betonte Aufmerksamkeit erwiesen, und ihr jeden Grund gegeben zu glauben, dass seine Aufmerksamkeiten seriös und ehrenhaft waren.
In diesem kritischen Augenblick kam Mrs. Glyn, ihre Mutter, herein, und wir erneuerten unsere alte Bekanntschaft. Sie hatte mir die schülerhafte Bewunderung ihrer Tochter längst vergeben; die ganze Kraft ihres Hasses hatte sich wie die ihrer Tochter auf Ibbetson fokussiert; und als ich die lange Geschichte ihres Unrechts und seiner Ehrlosigkeit hörte, fing ich an, ihn mehr denn je zu hassen, als ihr Kämpfer zur Stelle zu sein und ihren Streit zu meinem eigenen zu machen.
Aber das würde nicht genügen, schien es, denn ihr Name durfte in keiner Weise mehr mit seinem in Verbindung gebracht werden.
Dann fragte mich Mrs. Glyn plötzlich, ob ich wüsste, wann er nach Indien gegangen sei.
Ich konnte sie zufriedenstellen, denn ich wusste, dass es kurz nach der Heirat meiner Eltern war, fast ein Jahr vor meiner Geburt; worauf sie das genaue Datum seiner Abreise mit seinem Regiment angab, den Namen des Transports, und alles; zu meiner Überraschung auch das Datum der Heirat meiner Eltern in der Marylebone Church, und von meiner Taufe dort fünfzehn Monate später – genau vierzehn Wochen nach meiner Geburt in Passy. Ich wurde zunehmend verwirrt ob dieser Kenntnis meiner Angelegenheiten, und ich wunderte mich immer mehr.
Wir saßen eine Weile schweigend da, die beiden Frauen sahen einander an, sahen mich und sahen die Miniaturen an. Es wurde unheimlich. Was hatte das alles zu bedeuten?
Auf ein Nicken ihrer Tochter richtete sich Mrs. Glyn folgendermaßen an mich:
„Mr. Ibbetson, Ihr Onkel, wie Sie ihn nennen, obgleich er nicht Ihr Onkel ist, ist ein schrecklicher Schurke und hat Ihnen und Ihren Eltern sehr übles Unrecht angetan. Bevor ich Ihnen sage, was es ist (und ich finde, Sie sollten es wissen), müssen Sie mir Ihr Ehrenwort geben, dass Sie nichts tun oder sagen werden, was unseren Namen in irgendeiner Weise mit dem von Colonel Ibbetson in Verbindung bringt. Der Schaden für meine Tochter, die jetzt glücklich mit einem hervorragenden Mann verheiratet ist, wäre irreparabel.“
Mit klopfendem Herzen gab ich feierlich die erbetene Zusicherung.
„Dann, Mr. Ibbetson, ist es richtig, Sie wissen zu lassen, dass Colonel Ibbetson, als er meiner Tochter seine infamen Aufmerksamkeiten erwies, dieser unmissverständlich zu verstehen gab, dass Sie sein leiblicher Sohn seien – von seiner Cousine, Mrs. Catharine Biddulph, später Madame Pasquier de la Marière.!“
„O, o, o!“ schrie ich, „Sie müssen sich irren, er wusste dass es unmöglich war – er war von meiner Mutter dreimal abgewiesen worden – er ging beinahe ein Jahr vor meiner Geburt nach Indien – er …“
Mrs. Deane entnahm ihrer Tasche einen Brief und sagte:
„Kennen Sie seine Handschrift und sein Wappen? Erinnern Sie sich zufällig, dass Sie mir einmal einen Brief von ihm aus Ibbetson Hall mitbrachten? Hier ist er“, und sie gab ihn mir. Er war unverkennbar von ihm, ich erinnerte mich sofort, und folgendes stand darin:
„Um Himmels Willen, liebe Freundin, keinen Hauch von einem Wort zu irgend einer lebenden Seele über das, was Sie gestern Abend klug genug waren zu erraten! Natürlich gibt es da eine Ähnlichkeit.
Armer Antinoüs! Er hat keine Ahnung von seiner wirklichen Herkunft, was mich so manches Mal mit brennender Scham und Gewissensbissen erfüllte …
‚Que voulez-vous? Elle était ravissante!‘ (Was wollen Sie? Sie war hinreißend!) Wir waren Cousins, sahen einander oft; ‚both were so young, and one so beautiful! (Beide waren so jung, und eine so schön; Lord Byron: The Dream) … Ich war damals ein mittelloser Fähnrich, kaum mehr als ein Junge. Glücklicherweise war da ein ahnungsloser Franzose von guter Familie, der sie seit langem liebte, und den heiratete sie. „Il était temps!‘ (Es wurde Zeit!)
Können Sie mir dieses „entraînement de jeunesse“ (Jugendsünde) verzeihen? Ich habe in Sack und Asche bereut und nach besten Kräften Wiedergutmachung geleistet, indem ich jemanden, der mich ewig an einen Moment jugendlicher Betörung erinnert, adoptierte und ihm meinen Namen gab. Er weiß es nicht, der arme Junge, und wird es nie wissen, hoffe ich. ‚Il n’a plus que moi au monde!‘ (Er hat nur mich auf der Welt.)
Verbrennen Sie dies, sobald Sie es gelesen haben, und lassen Sie uns darüber nie wieder sprechen.
R. (‚Qui sait aimer‘) (Der zu lieben versteht).“
Das war ein Blitz aus heiterem Himmel!
Gelähmt saß ich da, sah rot und hatte das Gefühl, ich würde ewig rot sehen.
Nach langem Schweigen – das Herz schlug mir bis in die Schläfen, als ob sie platzen wollten – sagte Mrs. Glyn:
„Nun, Mr. Ibbetson, ich hoffe, Sie werden nichts Unbedachtes tun, nichts was den Namen meiner Tochter in den Konflikt zwischen Ihnen und Ihrem Onkel hineinziehen könnte. Dem guten Namen Ihrer Frau Mutter zuliebe werden Sie besonnen sein, das weiß ich. Wenn er so von seiner Cousine sprechen konnte, in die er als junger Mann verliebt war, welche Lügen würde er nicht über meine arme Tochter auftischen? Er hat es bereits getan – schreckliche Lügen! O, wie haben wir gelitten! Als er den Brief schrieb, glaubte er wirklich, er würde sie heiraten. Er hatte absolutes Vertrauen zu ihr, andernfalls hätte er sich nicht so törich anvertraut.“
„Weiß er, dass es diesen Brief gibt?“
„Nein. Als er und meine Tochter Krach hatten, sandte sie ihm seine Briefe zurück – alle bis auf diesen einen; sie sagte ihm, sie hätte ihn, wie er es verlangt hatte, unmittelbar nach dem Lesen verbrannt.“
„Darf ich ihn haben?“
„Ja. Ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann, und der Name meiner Tochter auf dem Umschlag wurde entfernt, wie Sie sehen können. Niemand außer uns selbst hat ihn je gesehen, noch haben wir je einer Menschenseele mitgeteilt, was er enthält, wie wir es auch nie für eine Sekunde geglaubt haben. Vor zwei oder drei Jahren wurden wir neugierig, wann und wo Ihre Eltern geheiratet hatten, wann Sie geboren wurden und wann er nach Indien ging. Es hat uns kein bisschen überrascht. Dann versuchten wir Sie zu finden, gaben das aber bald auf und hielten es für besser, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Dann hörten wir, er habe wieder was angestellt, etwas von genau derselben Sorte; dann sah meine Tochter Sie im Park, und wir beschlossen, Sie sollten es wissen.“
Das war der Hauptinhalt dieses erinnerungswürdigen Gesprächs, das ich nach besten Kräften eingedampft habe.
Ich verließ die beiden Damen und ging zweimal schnell um den Park herum. Während des Gehens sah ich oft rot. Vielleicht sah ich scharlachrot aus? Ich erinnere mich, dass Leute mich anstarrten.
Dann ging ich direkt zu Lintot, um ihm meinen Ärger mitzuteilen und seinen Rat zu erbitten.
Er war nicht zu Hause, und ich wartete eine Weile in seinem Rauchzimmer, wobei ich den Brief wieder und wieder las.
Dann entschied ich mich, Lintot nichts zu sagen, und verließ das Haus, nahm aber (ohne einen besonden Zweck) einen schweren gefüllten Stock mit, eine recht beachtliche Waffe sogar in den Händen eines Knaben, die ich Lintot zu seinem letzten Geburtstag geschenkt hatte. Άνάνκη!
Dann ging ich zu meinem normalen Mittagstisch in der Nähe des Piccadilly Circus und aß. Zur Überraschung der Kellnerin trank ich ein Viertel halbdunkles Ale und zwei Gläser Sherry. Üblicherweise trank ich Wasser. Sie setzte mir mit Fragen zu, ob ich krank sei oder Probleme hätte. Ich verneinte und bat sie schließlich, mich in Ruhe zu lassen.
Ibbetson wohnte in der St. James’s Street. Ich ging hin. Er war ausgegangen. Es war neun Uhr, und sein Diener wusste nicht, wann er heimkommen würde. Ich kam um zehn zurück. Er war noch nicht zu Hause. Der Diener dachte eine Zeitlang nach, sah die Straße hinauf und hinab, fand, dass ich annehmbar und in keiner Weise gefährlich aussah, und bat mich hinaufzugehen und zu warten, weil ich ihm sagte, es handle sich um etwas von größter Wichtigkeit.
So ging ich hinauf und saß im Salon meines Onkels und wartete.
Der Diener kam mit mir, zündete die Kerzen an, machte Bemerkungen zum Wetter und gab mir die Saturday Review und den Punch. Ich muss ganz normal ausgesehen haben – wie ich auch auszusehen versuchte – und er verließ mich.
Ich sah einen malaiischen Kris auf dem Kaminsims und versteckte ihn hinter einem Bilderrahmen. Ich schloss die Tür ab, die in einen anderen Salon mit einem großen Klavier führte, über dem Schwerter, Dolche, Streitäxte und andere Trophäen hingen, und steckte den Schlüssel in meine Tasche.
Der Schlüssel des Raums, in dem ich wartete, steckte auf der Innenseite der Tür.
Die ganze Zeit hatte ich eine undeutliche Vorstellung von möglicher Gewaltanwendung ihm gegenüber, aber nicht die Absicht, ihn zu töten. Ich fühlte mich viel zu stark dafür. In der Tat hatte ich ein Gefühl ruhiger, unwiderstehlicher Kraft – das Ergebnis unterdrückter Erregung.
Ich setzte mich hin und überlegte, was ich ihm alles sagen wollte. Ich hatte es immer wieder durchdacht, hatte den fatalen Brief wieder und wieder gelesen.
Der Diener kam herauf mit Gläsern und Sodawasser. Ich zitterte aus Angst, er könnte bemerken, dass die Tür zum Nebenraum abgeschlossen war, aber er bemerkte es nicht. Er öffnete das Fenster und sah die Straße hinauf und hinab. Plötzlich sagte er: „Hier ist der Colonel endlich, Sir“, und ging hinunter, um die Tür zu öffnen.
Ich hörte ihn hereinkommen und mit seinem Diener reden. Dann kam er schnurstracks heraus und summte dabei La donna e mobile (O wie so trügerisch) und kam herein in ebender unbeschwert lässigen Manier, die ich so gut kannte. Er trug Abendanzug und war sehr wenig verändert. Er schien recht überrascht mich zu sehen und wurde sehr blass.
„Hallo, mein Apollo vom T Square, pourquoi cet honneur? (Warum diese Ehre?) Bist du als pflichtbewusster Neffe gekommen, um dich selbst zu erniedrigen und um Vergebung zu bitten?“
Ich vergaß alles, was ich sagen wollte (wirklich, es verlief alles anders, als ich gedacht hatte), aber ich stand auf und sagte so ruhig, wie ich konnte, aber mit belegter Stimme: „Ich bin gekommen, um mit dir zu sprechen.“
Er schien sich nicht wohl zu fühlen und ging zur Tür.
Ich überholte ihn, schloss und verschloss die Tür und steckte den Schlüssel in meine Tasche.
Er stürzte zu der anderen Tür und fand sie verschlossen. Dann ging er zum Kaminsims und sah nach dem Kris. Als er ihn nicht fand, wandte er dem Feuer den Rücken zu, stemmte die Hände in die Seiten und versuchte, sehr geringschätzig und entschlossen zu gucken. Seine Haut war ganz weiß unter seinem gefärbten Schnurrbart – wie Wachs – und seine Augen blinzelten nervös.
Ich ging zu ihm und sagte:
„Du hast Mrs. Deane erzählt, ich sei dein leiblicher Sohn.“
„Das ist eine Lüge. Wer hat dir das gesagt?“
„Sie selbst – heute Nachmittag.“
„Es ist eine Lüge – die gehässige Erfindung einer verstoßenen Geliebten.“
„Sie war nie deine Geliebte.“
„Du Dummkopf. Ich nehme an, das hat sie dir auch erzählt. Raus mit dir, du erbärmlicher grüner Esel, oder ich las dich rausschmeißen,“ und er zog die Klingel.
„Kennst du deine eigene Handschrift?“, fragte ich und gab ihm den Brief.
Er las ein oder zwei Zeilen und keuchte dann, es sei eine Fälschung, zog erneut die Klingel und sah hinter der Uhr nach dem Kris. Dann hielt er den Brief an eine Kerze und warf ihn ins Feuer, wo er verbrannte.
Ich machte nicht den Versuch, ihn daran zu hindern.
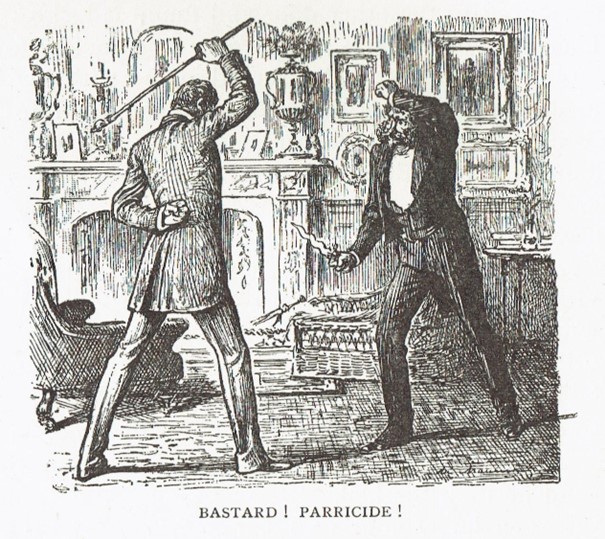
Der Diener versuchte die Tür zu öffnen, und Ibbetson ging zum Fenster und rief nach der Polizei. Ich stürzte zu dem Bild, hinter dem ich den Kris versteckt hatte, und warf ihn auf den Tisch. Dann zog ich ihn an seinen Frackschößen vom Fenster weg, sagte ihm, er solle sich selbst verteidigen, und zeigte auf den Kris.
Er ergriff ihn und nahm Verteidigungshaltung ein; der Diener war offenbar hinuntergelaufen, um Hilfe zu holen.
„Nun denn“, sagte ich, „runter auf die Knie, du schamloser Hundesohn, und gestehe; das ist deine einzige Chance.“
„Was soll ich gestehen, du Narr?“
„Dass du ein Feigling und ein Lügner bist; dass du diesen Brief geschrieben hast; dass Mrs. Deane ebenso wenig deine Geliebte war wie meine Mutter!“
Man hörte Leute die Treppe heraufkommen. Er lauschte einen Moment und zischte:
„Sie waren es beide, du Idiot! Wie kann ich genau wissen, ob du mein Sohn bist oder nicht? Es läuft alles auf dasselbe hinaus. Natürlich schrieb ich den Brief. Auf geht‘s, du erbärmlicher Attentäter, du Bastard von einem Vatermörder!“ … Und er kam auf mich zu, den Kris in der gesenkten rechten Hand, die Spitze nach oben, machte einen Stoß und schrie: „Brecht die Tür auf, schnell!“ Das machten sie; aber zu spät.
Ich sah purpurrot!
Er verfehlte mich, und ich schlug ihm mit dem Stock auf den linken Arm, den er über seinen Kopf hielt, und dann auf den Kopf, und er fiel um und schrie:
„O mein Gott! O Jesus!“
Ich schlug dem Fallenden erneut auf den Kopf, und noch einmal, als er am Boden lag. Es schien voll hereinzukrachen.
Soviel darüber, warum und wie ich Onkel Ibbetson getötet habe.
Teil Fünf
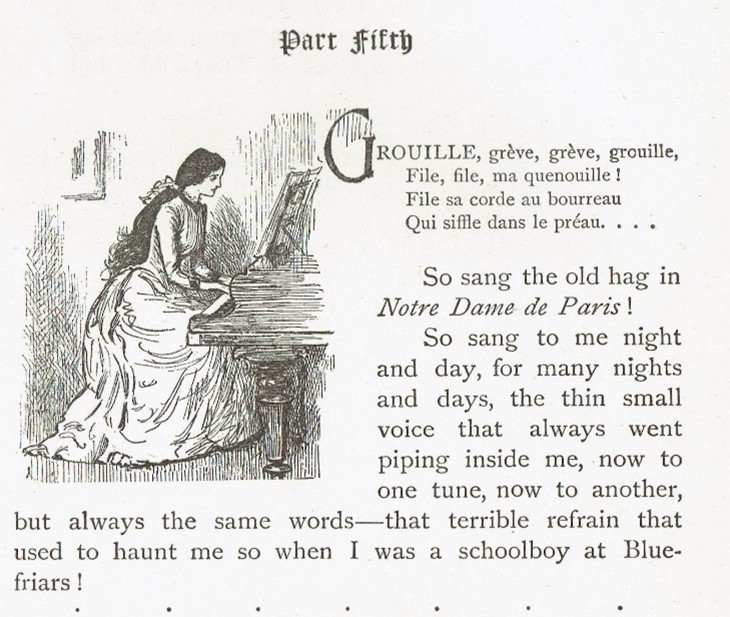
„Grouille, grève, grève, grouille,
File, file, ma quenouille!
File sa corde au bourreau
Qui siffle dans le préau …
(Woge, Menge, Menge, woge,
spinne, mein Spinnrocken, spinne!
Spinne sein Seil dem Henker,
der auf dem Schulhof pfeift …)
So sang die alte Hexe in Notre Dame de Paris!
Und so sang für mich Tag und Nacht, für viele Tage und Nächte, das dünne Stimmchen, das nie aufhörte in mir zu erklingen, mal mit einer, dann mit einer anderen Melodie, aber immer zum selben Text, dem schrecklichen Kehrreim, der mich so sehr heimsuchte, als ich ein Schuljunge in Bluefriars war!
*****
O, wieder ein Schuljunge sein im langen grauen Mantel und lächerlichen rosa Socken – unschuldig und frei – mit Esmeralda als meiner einzigen Liebe, und Athos, Porthos und d’Artagnan als meinen Busenfreunden und keiner größeren Drangsal als der, an einem Sonnabendnachmittag zu erfahren, dass der dritte Band ausgeliehen war – volume trois est en lecture!
*****
Ich erinnere mich, dass ich manchmal an einem Sonntagabend kaum schlafen konnte aus Mitleid mit dem armen Wesen, das am Montagmorgen ganz in der Nähe gehängt werden sollte – und dahin ist es nun mit mir gekommen!
*****
O Mary, Mary, Herzogin von Towers, süße Freundin meiner Kindheit und Liebe meines Lebens, was musst du jetzt von mir denken?
*****
Wie gesegnet sind die Gläubigen! Wie schön muss es sein, an Gott und den Himmel zu glauben, an die Vergebung der Sünden, und wie ein Kind in reiner Unschuld zu leben! Eine ganze Verbrecherlaufbahn wird in einem Moment ausgewischt allein durch den billigen kleinen Akt des Glaubens in letzter Minute aus entsetzlicher Angst vor dem wohlverdienten Tod; und all das Böse, das man sein Leben lang verübt hat (das weiter Böses für künftige Zeiten ausbrütet), wird dir wie ein schmutziges Kleidungsstück von den Schultern genommen und beiseite geworfen – irgendwohin, irgendwie, um andere zu infizieren – die nicht weiter zählen.
*****
Was tut’s, wenn es das Paradies eines Narren ist? Paradies ist Paradies, egal wer’s hat.
*****
Während der französischen Besetzung von Palermo soll ein sizilianischer Tambourmajor zum Tod durch Erschießen verurteilt worden sein. Jeder wusste, dass er ein Feigling war, man fürchtete, er würde in seinem letzten Moment das Land entehren, und das in Gegenwart der französischen Soldaten, die sich in großer Anmut und leichten Herzens erschießen ließen: sie hatten sich daran gewöhnt.
Um die Ehre Siziliens zu retten, erzählte ihm sein Beichtvater unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit, dass er nur zum Schein hingerichtet werden würde, es werde nur mit Platzpatronen auf ihn geschossen werden.
Das war eine fromme Lüge. Bis auf zwei enthielten die zwölf Patronen Kugeln, und er brach völlig durchsiebt zusammen. Kein Franzose starb je leichteren Herzens und mit größerer Anmut. Er war großartig, und die nationale Ehre war gerettet.
Dreifach glücklicher sizilianischer Tambourmajor, sollte die Geschichte wahr sein! Das Vertrauen auf Platzpatronen war sein Paradies.
*****
O, es ist harte Arbeit, stoisch zu bleiben, wenn der Moment herannaht und der Ruck! Aber wenn erst der Ruck nicht nur einen Moment, sondern Tage und Nächte, Tage und Nächte andauert! O glücklicher sizilianischer Tambourmajor!
*****
Beten? Ja, ich will abends und morgens beten und den ganzen Tag über, zu allem was an ererbter Kraft und Stärke in dem glücklosen, ekelhaften, verwahrlosten Kind Peter Ibbetson übrig ist; dass es ihn noch für eine kleine Weile aufrecht erhalte; dass er sich nicht blamiere auf der Anklagebank oder unterm Galgen.
*****
Bereue ich? Ja, so manches. Aber das, wofür ich hier bin? Nie!
*****
Es ist eine unheimliche Sache, zugleich den Richter, die Geschworenen und den Henker in einer Person zu verkörpern und für ein privates und persönliches Unrecht – zu verurteilen, zuzuschlagen und zu töten.
Mitleid kommt später – glücklicherweise, wenn es zu spät ist – die elende Schwäche des Mitleids! Pu! Kein Calcraft (William Calcraft, berühmter englischer Henker) wird mich je bemitleiden, und das ist gut so.
*****
Er hatte sein langes, gewelltes Messer gegen meinen Stock; auch er war ein großer, starker Mann, erfahren in Selbstverteidigung! Er ging zu Boden, und ich schlug ihn wieder und wieder. „o mein Gott! O Jesus!“, schrie er …
Das hallt in meinem Herzen und meinen Ohren wieder bis ich sterbe – bis ich sterbe!
*****
Es war keine Zeit zu verlieren – keine Zeit, über Besseres nachzudenke. Es ist das Beste so, wie es ist. Was hätte er noch alles gesagt, wenn er überlebt hätte!
*****
Dem Himmel sei Dank, dass Mitleid weder Reue noch Scham ist; und welches Verbrechen konnte schlimmer sein als seins? Meinen zärtlich geliebten Toten ihren guten Ruf rauben!
*****
Er könnte vielleicht verrückt gewesen sein, könnte angefangen haben, seinen eigenen Lügen zu glauben. Derartiges hat es gegeben. Aber ein solcher Verrückter sollte ebenso wenig am Leben gelassen werden wie ein verrückter Hund. Der einzige Weg, die Lüge zu töten, war, den Lügner zu töten – vorausgesetzt, man kann eine Lüge töten!
*****
Armer Wurm! Letztlich konnte er nichts dafür, nehme ich an. Er war nun einmal so gemacht! Und ich war gemacht, ihn dafür zu töten – und gehängt zu werden! Άνάνκη!
Was für ein Ende für „Gogo – gentil petit Gogo“!
*****
Gegenüber der Mauer, auf der anderen Seite, gab es einst einen kleinen Laden für Kutteln und Schweinefüße, den eine sehr liebreizende Tochter des Volkes innehatte, so hübsch und gut in meinen Augen, dass ich sie fragen wollte, ob sie meine Frau werden will. Was sie wohl jetzt von mir denken würde? Dass ich es gewagt haben sollte, mir Hoffnungen zu machen! Was für ein König Cophetua! (Legendärer reicher afrikanischer König, der ein Bettlermädchen heiratet.)
*****
Was denken alle? Keiner Menschenseele kann ich die wirkliche Ursache verraten. Nur zwei Frauen kennen die Wahrheit, und die werden sie sorgsam für sich behalten. Dem Himmel sei Dank dafür!
*****
Was geht es mich an, was alle denken? „In hundert Jahren ist ohnehin alles gleich.“ Es wurde nie ein vernünftigeres Sprichwort erfunden.
*****
Aber derweil!
*****
Der Richter setzt die schwarze Kappe auf, und all das nur für dich! Alle starren dich an, so groß, so jung, so stark und voller Leben! Bä!
*****
Sie fesseln dich, und du musst gehen und ein Mann sein, und der Kaplan mahnt und betet und versucht zu beruhigen. Dann ein Meer von Gesichtern; du stehst Menschen gegenüber, die gegessen und getrunken und einen drauf gemacht haben, während sie auf dich warteten! Eine Mütze wird dir über die Augen gezogen – o Grauen! Grauen! Grauen!
*****
„Heureux tambour-major de Sicile!“ (Glücklicher sizilianischer Tambourmajor!)
*****
„Il faut laver son linge sale en famille, et c’est ce que j’ai fait. Mais ça va me coûter cher!“ (Man soll seine schmutzige Wäsche in der Familie waschen, und das habe ich getan. Aber das kommt mich teuer zu stehen!)
*****
Würde ich es schließlich noch einmal tun? O ja, das will ich doch hoffen!
*****
Ach, er starb so schnell; ich versetzte ihm die vier Schläge in weniger als ebenso vielen Sekunden. Es war fünf Minuten oder höchstens zehn, nachdem er den Raum betreten hatte, da wurde ich schon auf frischer Tat ertappt. Und ich – was für ein langer Todeskampf!
*****
Ach, könnte ich doch noch einmal „wahr träumen“ und meine lieben Leute noch einmal sehen! Aber es sieht so aus, als ob ich die Fähigkeit wahr zu träumen seit jener fatalen Nacht verloren hätte. Ich versuche es immer wieder – aber es kommt nicht. Meine Träume sind furchtbar; und erst das Erwachen!
*****
Alles in allem war mein bisheriges Leben bis auf ein paar glückliche Kinderjahre nicht wert gelebt zu werden; es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich daran etwas geändert hätte, selbst wenn ich hundert Jahre alt geworden wäre! O Mary! Mary!
*****
Und Zuchthausstrafe! Jeder Tod ist besser. Es ist gut, dass mein Geheimnis mit mir sterben muss, dass es keine mildernden Umstände gibt, kein Gnadengesuch, keine Umwandlung der schnellen Todesstrafe.
„File, file …
File sa corde au bourreau!“
*****
Mit solchen eintönigen Gedanken und anderen, nicht weniger traurigen und hoffnungslosen, die in trüber Runde wieder und wieder kehrten, täuschte ich mich über die schreckliche Zeit zwischen Ibbetsons Tod und meinem Prozess im Old Bailey hinweg.
Das alles erscheint mir jetzt sehr trivial und unwichtig, nicht wert erwähnt zu werden und sogar kaum erinnerlich.
Aber mein Unglück in dieser Zeit war so groß, meine Angst vorm Galgen so schneidend, dass ich die nächsten vierundzwanzig Stunden nicht glaubte überleben zu können aus bloßem Schmerz und Kummer.
Die unerträgliche Belastung wuchs und wurde ernster und ernster, bis ein Gipfel der Spannung erreicht war und ein hysterischer Tränenstrom mich für eine Weile erleichterte und mit meinem Schicksal versöhnte und mich dem Tod wie ein Mann ins Auge schauen ließ … Dann aber bemächtigte sich die Angst schrittweise wieder meiner, die unkontrollierbare Schwäche des Fleisches …
Jede dieser beiden entgegengesetzten Stimmungen schien, solange sie anhielt, die andere unmöglich zu machen, so als ob sie nie wiederkehren könne; doch zurück kam sie mit der Gesetzmäßigkeit der Gezeiten – die schrecklichste Schaukel, die es je gab.
Ich war auf diese Art immer labil gewesen; aber während ich bisher zwischen Himmelhochjauchzend und Zutodebetrübt geschwankt hatte, schwankte ich jetzt zwischen dumpf resignierter Verzweiflung und wilder, schrecklicher Todesangst und Panik.
Vergeblich suchte ich nach dem einzigen Trost, den ich in mir suchen konnte; aber wenn ich, erschöpft vom Leiden, schließlich einschlief, konnte ich nicht mehr wahr träumen. Ich konnte nur träumen, wie es auch andere Unglückswürmer tun.
Ich träumte immer, die beiden kleinen, missgestalteten tanzenden Schließer, Mann und Frau, hätten mich schließlich doch erwischt; und dass ich laut nach meiner geliebten Herzogin um Hilfe schrie, während sie mich seitwärts stießen und hereinholten, ihre zahnlosen Gaumen in einem schwarzen Lächeln entblößten und mich mit ihrem heißen sauren Atem vergifteten! Das Tor und die Straße waren da, aber alles verzerrt und unähnlich; und gegenüber ein Gefängnis; aber keine mächtige Herzogin von Towers verscheuchte das Grauen.
*****
Einige werden sich vielleicht daran erinnern, wie kurz mein Verfahren war.
Die Verteidigung plädierte auf „nicht schuldig“ wegen Wahnsinns, und berief sich auf das komplette Fehlen eines ausreichenden Motivs. Diese Verteidigung wurde durch den Staatsanwalt schnell widerlegt; es fehlte nicht an Zeugen für meine vollständige geistige Gesundheit, und Motive fanden sich genug in meiner früheren Beziehung zu Colonel Ibbetson, um aus mir „einen gewalttätigen, missmutigen und rachsüchtigen Mann zu machen, der seine Hände im Blut eines Verwandten und Wohltäters badete, eines Mannes, der alt genug war, um mein Vater zu sein und der, gemessen an der Liebe, die er auf mich verwandte, mein Vater hätte sein können, der mir seinen ehrenvollen Namen gab, als ich eine mittellose, ausländische Waise war und ihm übergeben wurde.“
An dieser Stelle brach ich in lautes und lang anhaltendes Gelächter aus und hinterließ einen sehr unangenehmen Eindruck, wie in den Prozessberichten ordnungsgemäß festgehalten wurde.
Bereits am Nachmittag des zweiten Prozesstages befand mich die Jury, ohne sich zur Beratung zurückzuziehen, für schuldig; ich „bewahrte bis zum letzten Moment das gefühllose und unbewegte Verhalten, das ich während des gesamten Verfahrens gezeigt hatte“, wurde ordnungsgemäß zum Tode verurteilt ohne die geringste Aussicht auf Gnade, aber der Richter – bekannt für seine Neigung zum Hängen – drückte sein Bedauern aus, dass ein Mann von meiner Bildung und Zukunft durch seine eigene üble Veranlagung und unbeherrschte Leidenschaftlichkeit zu einem so bedauerlichen Ende gelangte.
*****
Ob nun die schlimmste Gewissheit besser ist als Ungewissheit, ob meine Schmerznerven in der Zeit vor dem Prozess so malträtiert worden sind, dass ich wirklich gefühllos geworden bin, wie es angeblich ja auch der Rücken eines Mannes nach einer bestimmten Anzahl von Streichen mit der „Katze“ wird – gewiss war, dass ich das Schlimmste nun wusste und mich mit einem überraschenden Gefühl von Erleichterung damit beruhigte und in mir entdeckte, dass ich es nicht unerträglich fand.
So wenigstens war meine Stimmung in jener Nacht. Ich machte das Beste draus. Es war beinahe Glück im Vergleich zu dem, was ich vorher durchgemacht hatte. Ich erinnere mich, mit einem Appetit gegessen zu haben, der mich überraschte. Ich hätte direkt von meinem Mittagessen zum Galgen gehen und leichten Herzens in aller Anmut sterben können – wie ein sizilianischer Tambourmajor.
Ich beschloss, der Herzogin von Towers die ganze wahre Geschichte zu schreiben, ihr meine lange andauernde und hoffnungslose Anbetung zu gestehen und der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass sie meiner nur als ihres alten Spielkameraden gedenken möge, als desjenigen, den sie vor dieser schrecklichen Katastrophe gekannt hatte. Ich dachte über den Brief nach, den ich sehr spät noch schreiben wollte, und schlief in meiner Zelle ein, in der zwei Schließer über mich wachten; und dann – begann eine neue Phase meines inneren Lebens.

*****
Ohne Anstrengung, ohne Aufenthalt oder Behinderung irgendeiner Art war ich am Straßentor.
Der Rot- und der Weißdorn, der Flieder und der Goldregen standen in voller Blüte, die Sonne sandte überall goldene Bahnen aus, die warme Luft war voller Aromen und erfüllt von all dem Gesumm und Gezirp des frühen Sommers.
Ich weinte beinahe vor Freude, wieder im Land meiner Wahrträume zu sein, mich wieder zu Hause zu fühlen – chez moi! chez moi!
Mutter François saß Kartoffeln schälend in der Tür ihrer Loge; sie sang ein kleines Lied über cinq sous, cinq sous, pour monter notre ménage. Ich hatte es ganz vergessen, aber nun erinnerte ich mich daran.
Yverdon, der witzige Postbote, betrat meinen alten Garten durch das Tor; die Klingel ertönte, als er es öffnete, und ich folgte ihm. Unter dem Apfelbaum, der Blütenknospen im Überfluss hervorbrachte, saßen meine Mutter und mein Vater und Monsieur le Major. Meine Mutter nahm den Brief aus der Hand des Postboten, und er sagte: „Pour vous? Oh yes, Madame Pasquier, God sev ze Kveen!“ und sie entrichtete das Porto. Der Brief war von Colonel Ibbetson, damals in Irland, und noch kein Colonel.
Médor lag schnorchelnd im Gras, und Gogo und Mimsey betrachteten die Bilder im musée de familles.
In einem Gartenstuhl lag Dr. Seraskier bequem hingestreckt, er schlief offenbar, und die lange Porzellanpfeife lag auf seinen Knien.
Madame Seraskier trug ein gelbes Nanking-Kleid mit Puffärmeln und sdchnitt Lockenwickler aus dem Constitutionnel.
Ich schaute sie alle mit unsäglicher Zärtlichkeit an. Vielleicht war es das letzte Mal, dass ich sie sah.
Ich rief sie bei Namen.

„O sprecht mit mir, geliebte Schatten! O mein Vater! Meine Mutter! Ich sehne mich so schrecklich nach euch! Kommt nur für ein paar Sekunden aus der Vergangenheit und schenkt mir ein paar tröstliche Worte! Ich bin in so furchtbarer Not! Wenn ihr es doch nur wüsstet …“
Aber sie konnten mich weder hören noch sehen.
Dann kam plötzlich eine andere Gestalt hinter dem Apfelbaum hervor – kein altmodischer, substanzloser Schatten vergangener Tage, den man sehen und hören, der mich aber nicht sehen und hören konnte; sondern einer in der ganzen glanzvollen Lebensfülle, ein Pfeiler der Hilfe und Kraft – Mary, Herzogin von Towers!
Ich sank auf die Knie, als sie mit ausgestreckten Händen auf mich zukam.
„O, Mr. Ibbetson, ich habe Sie Nacht um Nacht gesucht und hier auf Sie gewartet. Ich war außer mir! Wenn Sie nicht doch noch gekommen wären, ich hätte alle Bedenken in den Wind geschlagen und wäre nach Newgate gekommen, um Sie zu sehen – wachend und vor aller Welt, um eine Unterredung, ein abboccamento, mit Ihnen haben zu können. Ich vermute, Sie konnten nicht schlafen oder waren unfähig zu träumen.“
Ich konnte zuerst nicht antworten. Ich konnte nur ihre Hände mit Küssen bedecken und fühlte in einem wahren Freudentaumel, wie ihr warmer Lebensstrom sich mit dem meinen mischte.
Dann sagte ich:
„Ich schwöre Ihnen bei allem, was mir heilig ist – beim Andenken meiner und Ihrer Mutter – bei Ihnen selbst – dass ich nie vorhatte, Ibbetson das Leben zu nehmen oder ihn auch nur zu schlagen; der elende Hieb wurde versetzt …“
„Als ob Sie mir das sagen müssten! Als ob ich das nicht von früher wüsste, mein armer Freund, gütigster und sanftester aller Männer! Ich halte Ihre Hände und blicke in die tiefsten Tiefen Ihres Herzens!“
(Ich verzeichne alles so, wie sie es sagte. Natürlich bin ich nicht der, den ihr zärtlicher Blick von einst aus mir machte, und der war ich auch nie – ebenso wenig wie das blutdurstige Monster, für das ich anderen galt. Wie alle Frauen war sie die Sklavin ihrer Vorlieben.)
„Und nun, Mr. Ibbetson,“ fuhr sie fort, „möchte ich Ihnen als erstes die Gewissheit geben, dass Ihre Strafe gemildert wird. Ich sah den Innenminister vor drei oder vier Stunden. Der wahre Grund des bedauerlichen Streits mit ihrem Onkel ist ein offenes Geheimnis. Sein Charakter ist nur zu gut bekannt. Eine Mrs. Gregory (die Sie in Hopshire als Mrs. Deane kannten) war am Nachmittag beim Innenminister. Ihre ritterliche Verschwiegenheit während des Prozesses …“
„O“, unterbrach ich sie, „ich lege keinerlei Wert darauf, länger zu leben! Seit ich Sie nun wiedergesehen habe, seit Sie mir vergeben haben und trotz allem gut von mir denken, bin ich bereit zu sterben. Es hat außer Ihnen nie jemanden für mich in der Welt gegeben – nicht den Schatten einer Frau, nicht einmal eine Freundin, seit Ihre und meine Mutter starben. Von diesem Tag an bis zu dem Abend, an dem ich Sie erstmals in Lady Crays Konzert sah, kann man kaum davon reden, dass ich gelebt habe. Ich nährte mich mit Erinnerungsresten. Wie Sie sehen, fehlt mir die Begabung, neue Freunde zu gewinnen, aber ich bin ein Genie der Treue zu den alten. Ich wartete auf die Wiederkehr Mimseys, der, wie ich vermute, einzigen Überlebenden jener holden Zeit, aber als sie schließlich kam, war ich zu dumm, um sie wiederzuerkennen. Blendend wie ein Meteor schlug sie in mein armes Leben ein und füllte es mit zum Wahnsinn treibender Liebe, zum Wahnsinn treibendem Schmerz. Ich weiß nicht, was von beidem süßer war; beide waren mein Leben. Sie können nicht begreifen, was war. Glauben Sie mir, ich habe mein Teil gelebt. Ich bin bereit und willens zu sterben. Es ist der einzige wirklich perfekte Abschluss, den ich mir vorstellen kann. Nichts kann diesem jetzigen Moment je gleichkommen – weder auf Erden noch im Himmel. Und wenn ich morgen frei wäre – das Leben wäre mir nichts wert ohne Sie. Ich würde es nicht als Geschenk annehmen.“
Sie setzte sich neben mir ins Gras, umschlang ihre Knie, nah bei den bewusstlosen Schatten unserer Familie, in Hörweite ihres fröhlichen Gesprächs und Gelächters.
Plötzlich hörten wir Mimsey zu Gogo sagen:
„O, ils sont joliment bien ensemble, le Prince Charmant et la fée Tarapatapoum!” (O, sie sind hübsch beisammen, der Prince Charmant und die Fee Tarapatapoum.)
Wir sahen einander an und lachten laut los. Die Herzogin sagte:
„Gab es seit Weltanfang je eine solche mise en scène für ein solches Treffen, Mr. Ibbetson? Denken Sie drüber nach! Erfassen Sie es! Ich habe alles arrangiert. Ich wählte einen Tag, an dem sie alle beisammen waren. In Amerika würde man sagen, ich bin der Boss dieses speziellen Traums.“
Und sie lachte wieder Tränen, und lachend kräuselten sich ihre Augen zu, was sie so unwiderstehlich machte.
„Gab es seit Weltanfang je“, sagte ich, „eine solche Ekstase, wie ich sie jetzt fühle? Was außer dem wohlverdienten und wohlbezahlten Tod kann es für mich jetzt noch geben? Willkommen, süßer Tod!“
„Sie haben noch nicht bedacht, Mr. Ibbetson, Sie haben noch nicht realisiert, was das Leben für Sie noch bereithalten könnte, wenn, ja wenn all das, was Sie von Ihrer Neigung zu mir gesagt haben, wahr ist. O, ich weiß, es ist allzu schrecklich für mich, mir vorzustellen, dass Sie, kaum mehr als ein Junge, den Rest Ihres Lebens in elender Einsperrung und sinnloser, monotoner Mühsal verbringen sollen. Aber das Bild hat auch eine andere Seite.
Hören Sie jetzt die Geschichte Ihrer alten Freundin, das Bekenntnis der armen kleinen Mimsey. Ich will mich so kurz fassen, wie ich kann.
Erinnern Sie sich, wie Sie mich am Straßentor vor zwanzig Jahren zum ersten Mal sahen, ein kränkliches, schlichtes kleines Mädchen?
Père François schlachtete ein Huhn, schnitt ihm die Kehle mit dem Klappmesser durch, und das arme Tier kämpfte verzweifelt in seinem Griff, während das Blut in die Gosse floss. Eine Gruppe Jungen schaute mit großem Vergnügen zu, während Père François mit dem Herrn Pfarrer tratschte, dem das alles offenbar überhaupt nichts ausmachte. Ich wurde vor Mitleid und Schrecken ohnmächtig. Plötzlich kamst du mit Alfred und Charlie Plunket aus der gegenüber liegenden Schule, sahst das alles, und in einem Anfall edlen Zorns nanntest du Père François „ein verdammtes Mörderschwein“, was, wie du weißt, im Französischen sehr grob ist, und schlugst ihm, soweit dein Arm reichte, ins Gesicht.
Hast du das vergessen? Ich nicht. Es war vielleicht keine wirksame Tat, und sicherlich kam sie zu spät, um das Huhn zu retten. Außerdem schlug Père François dich zurück und hinterließ etwas von dem Hühnerblut auf deiner Wange. Das war eine Taufe! Du wurdest auf der Stelle mein Held, meine Lichtgestalt. Schau dir Gogo da drüben an. Ist er schön genug? Das waren Sie, Mr. Ibbetson!
Der Herr Pfarrer sagte was über „ces Anglais“, die ausrasten, wenn ein Mann seinem Pferd die Peitsche gibt, aber Leute dafür bezahlen, dass sie einander zu Tode boxen. Erinnern Sie sich wirklich nicht? O, die Erinnerung an mich!
Und die kleine Sprache, die wir erfanden und so flüssig sprachen! Erinnern Sie sich nicht daran? ‚Ne le récollectes-tu pas?‘, wie wir in jenen Tagen gesagt hätten, denn wir benutzten thee und thou damals zwischen uns.
Nun ja, auf alle Fälle musst du dich erinnern, wie oft wir fünf Jahre lang beisammen waren; wie du für mich zeichnetest, mir vorlast, mit mir spieltest; immer, ob zu Recht oder zu Unrecht, meine Partei ergriffst; mich huckepack trugst, wenn ich müde war. Deine Zeichnungen – ich habe sie alle aufgehoben. Und o, du warst manchmal so lustig! Wie Du Mama zum Lachen brachtest und Monsieur le Major! Schau dir nur Gogo wieder an! Hast du vergessen, was er gerade macht? Ich hab’s nicht. Er hat gerade das musée des familles durch das Penny Magazine ersetzt, und erklärt Mimsey die Bilderserie von Hogarth über den ‚faulen und den fleißigen Lehrjungen‘, und sie sind sich gerade einig geworden, dass der Faule der weniger Üble von den beiden ist.
Mimsey sieht sehr passiv aus, den Daumen im Mund, nicht wahr? Ihr kleines Herz ist so voller Dankbarkeit und Liebe für Gogo, dass sie nicht sprechen kann. Sie kann nur an ihrem Daumen nuckeln. Armes, krankes, unbeholfenes Kind! Sie wäre gern Gogos Sklavin – sie würde für Gogo sterben. Und ihre Mutter betet Gogo ebenfalls an. Sie ist auf die liebe Madame Pasquier fast etwas eifersüchtig, dass sie einen so süßen Sohn hat. In genau einer Minute wird sie den letzten Lockenwickler ausgeschnitten haben, die arme, längst tote Mama, und dann wird sie Gogo zu sich rufen und ihm eine gute ‚irische Umarmung‘ verabreichen, die ihn für eine Woche glücklich macht. Warte eine Minute und guck. Da! Was habe ich gesagt?
Gut, das alles ging zu Ende. Madame Pasquier ging fort und kam nie zurück, und Gogo ebenso. Monsieur und MadamePasquier waren tot, und eine Woche später starb Mama an der Cholera. Die arme Mimsey wurde mit gebrochenem Herzen von ihrem Vater, dessen Herz nicht weniger gebrochen war, nach St. Petersburg, nach Warschau, Leipzig, Venedig, durch ganz Europa entführt.
Es war ihr und der Wunsch ihres Vaters, dass sie eine professionelle Pianistin werden sollte, und sie studierte viele Jahre hart in fast jeder Hauptstadt und unter jedem Meister in Europa, und gab Anlass zu Erfolgshoffnungen.
Und so, von einem Ort zum anderen wandernd, wurde eine junge Frau aus ihr – eine sehr verhätschelte, verzogene und überschätzte junge Frau, Mr. Ibbetson, auch wenn ich das nicht sagen sollte; und sie hatte viele Verehrer aus allen Schichten und Ländern.
Aber der helden- und engelhafte Gogo mit seiner hübschen geraden Nase, seinem aux enfants d’Édouard geschnittenen Haar, seinem hübschen weißseidenen Zylinder und der Eton-Jacke war in ihrem Gedächtnis, ihrem innersten Herzen heilig aufgehoben als die Verkörperung alles Schönen, Mutigen und Guten. Aber ach! Was war aus Gogo mittlerweile geworden? Man hörte nichts von ihm – er war tot!
Gut, diese langbeinige, weichherzige herangewachsene junge Mimsey von 19 Jahren fühlte sich in Wien von einem sehr geistreichen und kultivierten englischen Attaché angezogen – einem Mr. Harcourt, der heftig in sie verliebt erschien und sie zur Frau begehrte.
Er war nicht reich, aber Dr. Seraskier möchte ihn und vertraute ihm so sehr, dass er fast seinen gesamten Besitz drangab, nur um dem jungen Paar die Heirat zu ermöglichen – und so heirateten sie. Und um der Wahrheit die Ehre zu geben, gestehe ich, dass sie für ein Jahr sehr glücklich und mit ihrem Schicksal und mit einander zufrieden waren.
Dann brach großes Unglück über sie herein. Auf höchst unvorhergesehene Weise wurde aus Mr. Harcourt durch fünf aufeinanderfolgende Todesfälle in seiner Familie zunächst Lord Harcourt und dann der Herzog von Towers. Und seither, Mr. Ibbetson, habe ich keine einzige friedliche oder glückliche Stunde erlebt.
Zuerst bekam ich einen Sohn, aber der liebe Arme war ein Krüppel, missbildet von Geburt an. Und als er älter wurde, stellte sich heraus, dass er geistesschwach geboren war.
Dann kam es zu einer tiefgreifenden Wesensveränderung meines unglücklichen Gatten; er trank, er spielte – und machte Schlimmeres, bis wir einander völlig fremd waren und nur noch in der Öffentlichkeit und vor anderen miteinander sprachen …“
„Ach“, sagte ich, „Sie waren aber doch eine große Dame – eine englische Herzogin!“
Der Gedanke an die glücklichen zwölf Monate mit dem viehischen Herzog war mir unerträglich! Ich nüchtern, keusch und sauber – mit Ausnahme des Blutes an meinen Händen, und ach! ein verurteilter Sträfling!
„O, Mr. Ibbetson, bitte irren Sie sich nicht in mir! Ich bin von der Natur nicht für eine Herzogin vorgesehen – am wenigsten für eine englische. Nichtsdestotrotz, wenn es Herzöge und Herzoginnen nun einmal geben muss, sind die englischen noch die besten – und natürlich meine ich mit Herzögen und Herzoginnen die ganzen oberen Zehntausend, die sich selbst ‚Gesellschaft‘ nennen – als ob der Rest es nicht wert wäre, überhaupt erwähnt zu werden. Manche von ihnen sind nahezu engelgleich, aber sie sind nichts für Außenseiter wie mich. Sie befassen sich ständig mit Jagd, mit Schießen, Fischen und Pferderennen – mit Essen, Trinken, Töten und Liebemachen – mit ewigem Hofklatsch und Geschwätz – der Fürst – die Königin – wen und was die Königin mag und wen und was sie nicht mag – harmlose englische Parteipolitik – die Kirche – eine Kirche, die ihre Seele verloren hat trotz ihrer Dekane, Bischöfe und Erzbischöfe und deren Frauen und Töchtern – und den ganzen albernen feierlichen Rang- und Würdestufen! Nicht enden wollender Smalltalk, Diners, Trommeln, und immer dieselbe Gesellschaft von einem Jahresende zum anderen! Ach, da muss man jung hineinwachsen und sich frühzeitig einen Harnisch anlegen, wenn man so ein Leben führen und damit zufrieden sein will. Solche Männer und Frauen habe ich durch meinen Vater kennengelernt, und sie waren es wert!
Es gibt eine andere Gesellschaft in London und überall – eine Freimaurerei von Intelligenz, Kultur und harter Arbeit – la haute bohème du talent – Männer und Frauen, deren Namen in der ganzen Welt zum Allgemeinwissen gehören oder gehören sollten; viele von ihnen sind gut mit mir befreundet, sowohl hier als auch im Ausland; und diese Gesellschaft, die für meine Eltern gut genug war, ist auch gut genug für mich.
Ich bin eine Anhängerin der Republik, Mr. Ibbetson – eine Kosmopolitin – eine geborene Angehörige der Bohème!
Mon grand-père était rossignol;
Ma grand-mère était hirondelle!’
(Mein Großvater war ein Nachtigallhahn,
meine Großmutter eine Schwalbe!)
Schau dir meine liebe Familie dort an – schau dir deine an! Was für verlorene Kinder, bis ihr Schiff eines Tages kommt – und wissen: Es wird nie kommen! Unsere Väter, die sich und ihre fünf Sinne in der Verfolgung einer Idee abrackern! Unsere Mütter, die sich abrackern, um Geld zu sparen und sich und die ihren durchzubringen … Klar, Mr. Ibbetson, Sie sind dem rossignol näher als ich. Erinnern Sie sich an die Stimme Ihres Vaters? Ich werde sie nie vergessen! Noch in der letzten Nacht sang er für mich, und mitten in meiner quälenden Angst um Sie wurde ich verlockt, aus dem Fenster zu lauschen. Er sang Rossinis Cuius Animam. Er war der Nachtigallhahn; das war seine Berufung, hätte er es doch nur gewusst! Und Sie sind mein Bohème-Bruder; das ist Ihre … Ach, und meine Berufung? Ich hätte die Frau eines fleißigen Arbeiters der Stirn werden sollen – eines Mannes der Wissenschaft, eines Verschwörers – Autors – Künstlers – Architekten, wenn Sie wollen, um ihn zu schützen und zu beschirmen vor all den Sorgen und Nöten und kleinen Ärgernissen des Lebens. Ich bin eine Geschäftsfrau par excellence – eine Managerin und all das. Er hätte ein warmes, aufgeräumtes kleines Nest gehabt, in das er hätte heimkommen können nach seiner Ideenjagd!
Nun, ich hielt mich also für die Unglücklichste aller Lebenden und hüllte mich in die Liebe zu meinem schwer behinderten kleinen Sohn; und wenn ich ihn an meine Brust drückte und vergebens versuchte, ihm mit Wärme und Suggestion eigenes Fühlen und Denken einzuflößen, dann kehrte Gogo zurück in mein Herz, und ich dachte immer wieder: ‚Ach, hätte ich doch einen Sohn wie Gogo, was für für eine glückliche Frau wäre ich!‘ Und ich bedauerte Madame Pasquier, dass sie so früh sterben und ihn verlassen musste, denn ich hatte gerade angefangen, wahr zu träumen und hatte Gogo und seine liebe Mutter wiedergesehen.

Und dann ging ich an einem Abend, einem unvergesslichen Abend, in Lady Crays Konzert und sah Sie in einer Ecke ganz für sich stehen; und ich dachte mit einem Sprung meines Herzens, ‚Nein, das muss Gogo sein, er ist dunkler geworden und trägt Bart und Schnurrbart wie ein Franzose!‘ Aber ach, ich fand heraus, dass Sie nur ein Mr. Ibbetson waren, der Architekt von Lady Cray, den sie eingeladen hatte, ‚weil er so ziemlich der hübscheste junge Mann war, den sie je gesehen hatte!‘
Bitte lachen Sie nicht! Sie sahen hinreißend aus, ich versichere es Ihnen!
Gut, Mr. Ibbetson, auch wenn Sie nicht Gogo waren, wurden Sie plötzlich so interessant für mich, dass ich Sie nicht mehr vergaß – Sie waren nie ganz aus meinem Sinn. Ich hätte Sie gern untermeine Fittiche genommen und beraten, Sie bei der Hand genommen und wäre Ihre ältere Schwester geworden, denn ich fühlte mich schon erfahrener und herumgekommener in der Welt. Gern wäre ich noch zwanzig Jahre älter gewesen und hätte Sie als meinen Sohn gehabt. Ich weiß nicht, was ich wollte! Sie kamen mir so einsam vor, so frisch und unbefleckt von der Welt unter all den smarten Weltlingen, und zugleich so groß und stark, vierschrötig und unbesieglich – o, so stark! Und dann sahen Sie mich an mit einer so ehrlichen, süßen und ritterlichen Bewunderung und Sympathie – mir fehlen die Worte – und dann waren Sie demjenigen, zu dem Gogo geworden sein könnte, so ähnlich! O, Sie machten aus mir auf den ersten Blick eine so warme, ergebene Freundin, wie man sie sich nur wünschen konnte.
Zugleich aber bewirkten Sie, dass ich mir meiner selbst bewusst und schüchtern wurde, weshalb ich nicht zu bitten wagte, Ihnen vorgestellt zu werden – ich, die ich doch sonst Schüchternheit kaum kenne.
Die nette Giulia Grisi sang ‚Assisa al piè d’un‘ salice‘ (Arie der Desdemona aus Rossinis Othello), und diese Melodie war seither in meinem Herzen immer verknüpft mit Ihrem Bild – und wird es immer bleiben. Ihre liebe Mutter pflegte sie auf der Harfe zu spielen. Erinnern Sie sich?
Dann kam es zu diesem ungewöhnlichen Traum, an den Sie sich ebenso gut erinnern wie ich: War das nicht ein Wunder? Mein Vater war, wie Sie sehen, in den Besitz eines merkwürdigen Hirngeheimnisses gelangt – wie man im Schlaf vergangene Dinge und Menschen und Orte heraufruft, wie er sie einst gesehen oder gekannt hat, selbst wenn sie ihm nicht mehr erinnerlich waren. Er nannte es wahr träumen, und durch lang andauernde Praxis hatte er es, wie er mir sagte, in dieser Kunst zur Vollkommenheit gebracht. Es war der einzige Trost seines mit Problemen belasteten Lebens, seine glückliche Kindheit und Jugend und die wenigen kurzen Jahre, die er mit seiner geliebten jungen Frau verbracht hatte, wieder und wieder im Schlaf zu durchleben. Als er sah, wie unglücklich ich geworden war und dass das Leben keinerlei Hoffnung oder Freude mehr für mich bereithielt, hat er mir vor seinem Tod dieses sehr einfache Geheimnis eröffnet.
So habe ich im Schlaf jeden Ort, an dem ich je gelebt habe, erneut besucht, und besonders diese geliebte Stelle, an der ich als kleines Mädchen dich zum ersten Mal sah!
In der Nacht, in der wir uns in unserem gemeinsamen Traum wiedersahen, schaute ich zu den Jungen von Monsieur Saindous Schule hinüber, die zu ihrer première communion gingen, und dabei dachte ich stark an dich, weil ich dich, als ich einige Stunden zuvor wach war, am Fenster der Tête Noire gesehen hatte; dann tauchtest du plötzlich auf, warst offenbar in großer Not und wanktest wie ein Betrunkener; und meine Vision wurde gestört durch den Schatten eines Gefängnisses – o weh, o weh! und durch zwei kleine Schließer, die mit den Schlüsseln klirrten und dich einzuschließen versuchten.
Meine Aufregung, dich so bald wiederzusehen, war so groß, dass ich fast aufwachte. Aber ich rettete dich vor deinen eingebildeten Ängsten und hielt dich bei der Hand. Der Rest ist dir bekannt.
Ich konnte nicht verstehen, warum du in meinem Traum warst, da ich immer wahr geträumt hatte – also von Dingen, die in meinem Leben gewesen waren – nicht von Dingen, die sein könnten; ich verstand weder die Festigkeit deiner Hand noch, warum du nicht verschwandest und warum der Traum sich nicht eintrübte, als ich sie nahm. Es war ein sehr verwunderliches Geheimnis, das viele Stunden sowohl meines wachenden wie meines schlafenden Lebens beunruhigte. Dann kam das Zusammentreffen mit dir bei den Crays, und ein Teil des Geheimnisses klärte sich auf, denn du warst also doch mein alter Freund Gogo. Aber es bleibt ein Geheimnis, ein schreckliches Geheimnis, dass zwei Menschen wie wir sich in ein und demselben Traum treffen, dass ihre Gehirne sich so exakt miteinander verzahnen. Was für eine Bindung zwischen uns beiden, Mr. Ibbetson, die wir schon durch so viele Erinnerungen verbunden sind!
Nachdem ich Sie bei den Crays getroffen hatte, spürte ich, dass ich Sie weder wachend noch schlafend je wiedersehen durfte. Die Entdeckung, dass Sie nun doch Gogo waren, verbunden mit meiner Voreingenommenheit für Sie, als Sie mir noch ein völlig Fremder waren – diese Voreingenommenheit hatte meinen Geist schon so lange und so heftig beunruhigt, dass – dass – bitte versuchen Sie es sich selber vorzustellen.
Schon vor der Enthüllung bei den Crays hatte ich Sie oft in meinen Träumen gespürt, aber ich hatte Sie sorgsam gemieden … Obgleich Sie wenig träumten, waren Sie in Ihrem eigenen Traum auch hier! Von der kleinen Dachluke da oben habe ich Sie oft durch den Park und die Straße hinauflaufen sehen, offensichtlich auf der Suche nach mir, und hatte mich gefragt, warum und wie Sie kamen. Sie trieben mich in die Dachkammern und Schlafräume der Diener, wo ich mich vor Ihnen verbarg. Es war ein richtiges Versteckspiel – cache-cache, wie es bei uns hieß!
Aber nach unserem Treffen bei den Crays durfte es für mein Gefühl kein cache-cache mehr geben; ich vermied es ganz und gar hierher zu kommen; Sie vertrieben mich gänzlich.
Nun versuchen Sie sich vorzustellen, was ich fühlte, als die Nachricht von Ihrer schrecklichen Auseinandersetzung mit Mr. Ibbetson über die Welt hereinbrach. Ich war außer mir! Ich kam Nacht um Nacht hierher; ich suchte Sie überall – im Park, im Bois de Boulogne, am Mare d’Auteuil, in St. Cloud – an jedem Ort, den ich mir vorstellen konnte! Und jetzt sind Sie endlich hier! Endlich!
Pst! Noch nicht sprechen! Ich bin gleich fertig!
Vor sechs Monaten verlor ich meinen armen kleinen Sohn, und so sehr ich ihn geliebt habe, ich kann ihn mir nicht zurückwünschen. In vierzehn Tagen werde ich gesetzlich von meinem bedauernswerten Gatten geschieden sein – ich werde in der Welt ganz allein stehen! Und dann, Mr. Ibbetson, o ja, dann, teuerster Freund, den ein Kind, eine Frau je hatte, soll hinfort jede Stunde, die ich meinem Wachzustand abluchsen kann, Ihnen gewidmet sein, solange wir beide leben und wir dieselben Stunden des Tages schlafend verbringen. Der einzige Gegenstand meines Bemühens soll es sein, Sie für das Scheitern ihres süßen und wertvollen jungen Lebens zu entschädigen.
Stone walls shall not a prison make,
nor iron bars a cage!
(Steinmauern sollen kein Gefängnis bilden,
Eisenstangen keinen Käfig. Richard Lovelace)
[Und hier lachte und weinte sie gleichzeitig, so dass ihre nach oben sich schließenden Augen die Tränen herausdrückten, und ich dachte: „Ach, könnte ich sie trinken!“]
Jetzt will ich Sie verlassen. Ich bin eine schwache, liebende Frau, und ich darf nicht an Ihrer Seite bleiben, bis ich das ohne allzu große Selbstvorwürfe tun kann.
Ich spüre auch, dass ich aus bloßer freudiger Erschöpfung bald erwachen werde. O selbstsüchtiges, eifersüchtiges armes Wesen, das ich bin – von Freude zu reden!
Leider freue ich mich, dass keine andere Frau Ihnen je sein kann, was ich Ihnen zu sein hoffe. Keine andere Frau kann sich Ihnen je nähern! Ich bin Ihre Herrscherin und Ihre Sklavin – Ihr Unglück hat sie für immer an mich gekettet; aber mein ganzes, ganzes Leben soll nur ein einziges Ziel haben: Sie das Ihre vergessen zu machen, und ich glaube, das wird mir gelingen.“
„O, bitte nicht diese Hast!“, rief ich aus. „Träume ich wahr? Was beweist mir all dies, wenn ich wach bin? Entweder bin ich der elendeste und ärmste aller Menschen, oder es wird keinen unglücklichen Augenblick in meinem Leben mehr geben. Wie kann ich es wissen?“
„Hör zu. Erinnerst du dich an ‚Parva sed apta, le petit pavillon‘, wie du ihn nanntest? Das ist immer noch mein Zuhause, wenn ich hier bin. Es soll auch deines sein – wenn du magst und wenn die Zeit dafür kommt. Du wirst dort vieles finden, was dich interessiert. . Gut, morgen früh wirst du in deiner Zelle von mir einen Umschlag mit einem Stück Papier erhalten, er enthält einige Veilchen und, geschrieben mit lila Tinte, die Worte ‚Parva sed apta – à bientôt‘. Wird dich das überzeugen?“
„Ja, ja!“
„Gut, dann gib mir deine Hände, Liebster und Bester – beide Hände! Ich werde schon bald wieder hier sein – bei diesem Apfelbaum; ich zähle die Stunden. Lebewohl!“ Sie war fort und ich wach.
Ich erwachte in der mit Gaslicht erhellten Dunkelheit meiner Zelle. Es war kurz vor der Morgendämmerung. Einer der Schließer fragte mich höflich, ob ich etwas wünschte, und gab mir einen Trunk Wasser.
Ich dankte ihm ruhig und rief mir ins Gedächtnis zurück, was mir gerade widerfahren war, mit einer Verwunderung, einer Ekstase, für die ich keine Worte finde.
Nein, es war kein Traum gewesen, in keinerlei Hinsicht – dessen war ich mir ganz sicher; es war nichts Traumtypisches darin gewesen außer dem überirdischen, unaussprechlichen Entzücken.

Jede Wendung dieser geliebten Stimme mit ihrem leichten ausländischen Akzent, der mir vorher nie aufgefallen war; jede lebhafte Geste mit ihrem Anklang sowohl an ihren Vater wie an ihre Mutter; ihr schwarzes, grau gebördeltes Kleid; ihr schwarzer und grauer Hut; der Duft von Sandelholz um sie her – alles hatte sich mir deutlicher und lebhafter eingeprägt, als wenn sie gerade eben an meinem Bett gesessen hätte. Ihr Tonfall echote noch in meinen Ohren. Meine Augen waren voll von ihr: bald ihr Profil, so rein und ziseliert, bald ihr ganzes Gesicht mit den grauen Augen (manchmal zärtlich, ernst und tränennass, dann halb geschlossen im Lachen), immer auf meine gerichtet; ihr geschmeidiger süßer Leib, nach vorn gebeugt, als sie da saß und die Knie umschlang; ihre gewölbten, feingliedrigen, glatten, geraden und so edel beschuhten Füße, die damals wie heute den Takt ihrer Geschichte zu schlagen schienen …
Und dann das merkwürdige Gefühl der Übertragung von Leben bei der Berührung der Hände! O, es war kein Traum! Aber was es war, kann ich nicht sagen …
Ich drehte mich auf die Seite, glücklicher, als ich ausdrücken kann, und schlief wieder ein – ein traumloser Schlaf, der dauerte, bis ich geweckt und mir befohlen wurde, mich anzuziehen.
Mir wurde ein Frühstück gebracht, und mit ihm ein offener Briefumschlag, der einige Veilchen und ein Stück Papier enthielt, das nach Sandelholz roch, auf das in lila Tinte die Worte geschrieben waren:
„Parva sed apta – à bientôt!
Tarapatapoum”
Ich will die Zeit überspringen, die verging zwischen meinem Urteil und seiner Umwandlung; die fürsorglichen Ermahnungen des guten Kaplans; die freundliche und rührende Abschiednahme von Mr. und Mrs. Lintot, die auch geglaubt hatten, dass ich Ibbetsons Sohn sei (ich klärte sie auf); den Besuch meiner alten Freundin Mrs. Deane – und ihre merkwürdig leidenschaftliche Dankbarkeit und Bewunderung.
Zweifellos wäre das alles interessant genug, wenn es genau erinnert und gekonnt erzählt würde. Aber es ähnelte alles zu sehr einem Traum – dem Traum von irgendwem – nicht einem Traum von mir – alles zu leicht und dürftig, um eine bleibende Erinnerung zu hinterlassen oder viel zu bedeuten.
Zu gegebener Zeit wurde ich in das Gefängnis von – überstellt, ich nahm Abschied von der Welt und passte mich den Bedingungen meines neuen äußeren Lebens bereitwillig und leichten Herzens an.
Der Tagesablauf im Gefängnis ließ mir den Kopf so frei und unbeschäftigt; die gesunde Arbeit, die reine Luft, die gute und gesunde Ernährung taten mir gut und waren eine hochwillkommene Tagesruhe nach den stürmischen Gefühlen der Nacht.
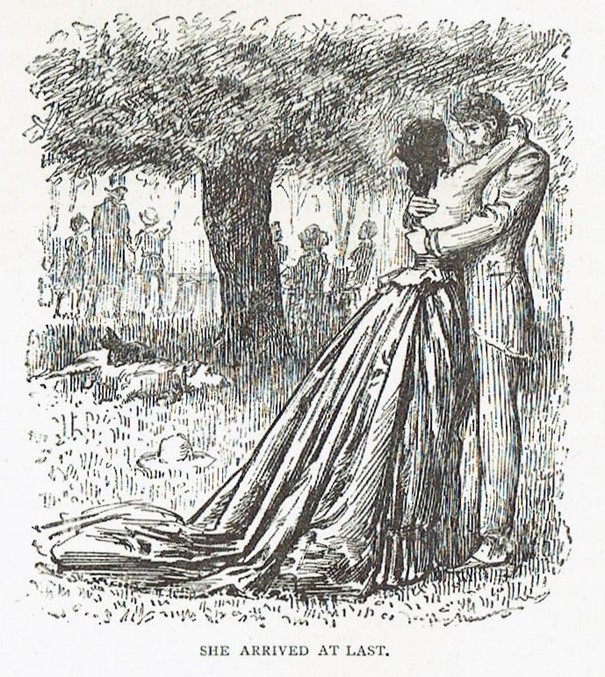
Denn ich war schon sehr bald wieder in Passy, wo ich jede Stunde meines Schlafs verbrachte, sicherlich nie allzu weit vom alten Apfelbaum entfernt, der durch alle seine Metamorphosen ging, von kahlen Zweigen zu zarten Trieben und Blüten, von der Blüte zur reifen Frucht, von der Frucht zum gelben fallenden Laub, bis die Zweige wieder kahl waren, und das alles in wenigen friedvollen Nächten, die meine Tage waren. Ich schmeichle mir seither, dass ich die Verwandlungen eines französischen Apfelbaums und seiner Raupen recht gut kenne!
Und all die Menschen, die ich liebte und deren ich nie müde werde, waren da – bis auf die Eine!
Schließlich kam sie. Das Gartentor wurde aufgestoßen, die Glocke ertönte, und sie kam über den Rasen, strahlend, groß und rasch, und öffnete weit ihre Arme. Und dort, umgeben von unserer kleinen Welt und allem, was wir je geliebt und gemocht hatten, aber unsichtbar und unhörbar für sie – hielt ich zum ersten Mal seit dem Tod meiner Mutter und von Madame Seraskier eine Frau in meinen Armen, und sie presste ihre Lippen auf meine.
Immer wieder umrundeten wir den Rasen und redeten, wie wir es fünfzehn, sechzehn, zwanzig Jahre zuvor getan hatten. Es gab so Vieles zu sagen. Der „Prinz Charming“ und die „Fee Tarapatapoum“ waren „recht gut beisammen“ – endlich!
Die Zeit verrann schnell – viel zu schnell. Ich sagte:
„Du wolltest mir dein Haus zeigen – ‚Parva sed apta‘ – ich würde dort Vieles finden, was mich interessiert …“
Sie errötete ein wenig, lächelte und sagte:
„Du darfst nicht zu viel erwarten“, und bald schon gingen wir die Straße dorthin hinauf. So waren wir als Kinder oft gegangen, und dann, unvergesslich, noch einmal.
Da stand das kleine weiße Haus mit seiner goldenen Inschrift, wie ich es als Junge tausendmal gesehen hatte – und hundertmal seither.
Wie niedlich und klein es aussah im heiteren Sonnenschein! Wir betraten die steinerne Vortreppe, öffneten die Tür und traten ein. Mein Herz schlug heftig.
Alles war, soweit ich sehen konnte, wie es immer gewesen war. Dr. Seraskier saß in einem Sessel beim Fenster, las Schiller und nahm keine Notiz von uns. Sein Haar bewegte ich im leichten Luftzug. Über uns hörten wir, dass die Räume gefegt und die Betten gemacht wurden.
Ich folgte ihr in eine kleine Abstellkammer, in der ich nach meiner Erinnerung noch nie gewesen war; sie war voller Krimskrams.
„Warum hast du mich hierher gebracht?“, fragte ich.
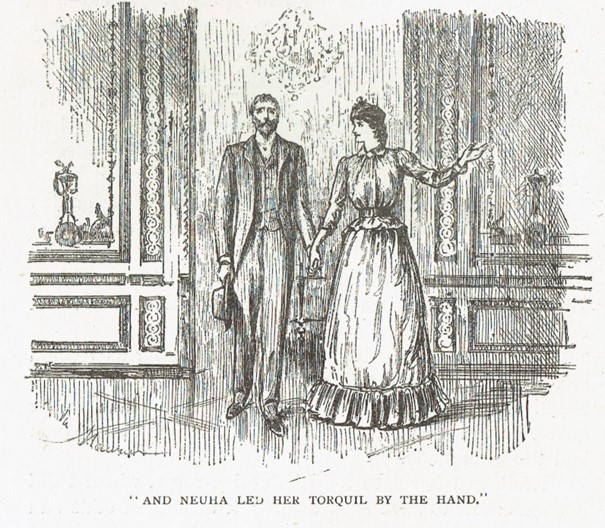
Sie lachte und sagte:
„Öffne die Tür in der Wand gegenüber!“
Da gab es keine Tür, und das sagte ich ihr.
Da nahm sie meine Hand, und siehe da! Es gab eine Tür!
Sie drückte sie auf, und wir betraten eine andere Folge von Räumen, die es dort früher nie gegeben hatte; für die hätte es gar keinen Platz gegeben, hätte es nie welchen geben können – nirgends in Passy!
„Komm!“, sagte sie und lachte und errötete zugleich; sie kam mir nervös, aufgeregt und befangen vor – „Erinnerst du dich:
And Neuha led her Torquil by the hand,
And waved along the vaults her flaming brand!
(Und Neuha hielt ihren Torquil bei der Hand
und schwenkte durch die Höhlen ihren Flammenbrand.)
Erinnerst du dich an deine kleine Zeichnung nach The Island in der in grünes Maroquin gebundenen Byronausgabe? Hier ist er, im obersten Regal dieses hübschen Kabinetts. Hier sind all die Zeichnungen, die du für mich gemacht hast – einfarbige und bunte – mit Daten, Erklärungen usw., alle geschrieben von mir selbst – l’album de la fée Tatapatapoum. Es sind alles Duplikate. Die Originale habe ich in meinem Haus in Hampshire.
Auch das Kabinett ist ein Duplikat; ist es nicht schön? Es ist vom Winterpalast des Zaren. Alles hier ist ein Duplikat, mehr oder weniger. Schau hier dies kleine Esszimmer; hast du je etwas so Vollkommenes gesehen? Es ist die berühmte salle à manger der Prinzessin Chevagne. Ich benutze sie nie, nur dann und wann esse ich hier eine Scheibe englischen Hausbrots mit französischer Butter und cassonade. Kleinmimsey da hinten macht das auch manchmal so, wenn Gogo ihr eine Scheibe bringt, und Großmimsey läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn sie das sieht, und deshalb muss sie es genauso machen. Magst du eine Scheibe?
Du siehst, das Tischtuch ist ausgebreitet, deux couverts. Da ist eine Flasche des berühmten Champagners von Herrn de Rothschild; und davon gibt’s noch viel mehr. Die Blumen sind von Chatsworth, (Chatsworth House, Schloss mit berühmtem Garten) und dies ist ein Hummersalat für dich. Papa war gut in Hummersalaten und brachte es mir bei. Ich habe ihn vor vierzehn Tagen zubereitet, und er ist, wie du siehst, so frisch und wohlschmeckend, als hätte ich ihn eben gerade gemacht, und die Blumen sind noch kein bisschen welk.
Hier sind Zigaretten, Pfeifen und Zigarren. Ich hoffe, sie sind gut. Ich rauche nicht.
Ist das Mobiliar nicht ausgesucht und schön? Ich habe jeden Palast Europas seiner besten Stücke beraubt, und trotzdem habe ich die Besitzer um keinen Penny geschädigt. Du solltest sehen, was es oben noch gibt!
Schau dir diese Bilder an – das Beste von Raffael, Tizian und Velasquez. Und da das Klavier – ich habe in Leipzig Liszt wieder und wieder darauf spielen gehört.
Dies ist meine Bibliothek. Jedes Buch, das ich je las, ist hier, und jeder Einband, den ich je bewunderte. Ich lese sie nicht oft, staube sie aber regelmäßig ab. Ich habe arrangiert, dass auf ganz normale Art und Weise Staub auf sie fällt, um es realistisch zu machen und an das äußere Leben zu erinnern, das zu verlassen man so froh ist. Alles muss hier sehr ernst genommen werden, und man sollte sich ein wenig Mühe geben. Schau hier das Mikroskop meines Vaters, darunter eine kleine Spinne, die ich auf dem Grundstück selbst gefangen habe. Sie lebt noch. Grausam, oder? Aber sie existiert nur in unseren Köpfen.
Schau hier das Kleid, das ich anhabe – fühle, wie fein gearbeitet alles ist. Und unabsichtlich hast du dasselbe getan: Du trägst den Anzug, den du bei Crays unter der Esche trugst – der adretteste Anzug, den ich je sah. Hier ist ein Tintenfleck auf deinem Ärmel, wirklicher geht’s nicht (bravo!). Und dieser Knopf ist locker, richtig; ich werde ihn annähen mit einer Traumnadel, einem Traumfaden und einem Traumfingerhut!
Diese kleine Tür führt in jede Bildergalerie Europas. Ich brauchte lange, um sie alle selbst aufzubauen und anzuordnen – bestimmt die Nächte einer Woche. Es macht Spaß, sie mit einem guten Katalog zu durchwandern, mag es draußen junge Hunde regnen.
Durch diesen Vorhang gelangt man in eine Opernloge, die bequemste, in der ich je saß; von ihr aus kann man auch an Theateraufführungen, Oratorien, Konzerten und wissenschaftlichen Vorträgen teilnehmen. Von hier aus kannst du allen Aufführungen beiwohnen, in denen ich je war, in einem halben Dutzend Sprachen; du hältst meine Hand und verstehst sie alle. Du wirst jeden Sänger hören, den ich je hörte. Die reizende Giulia Grisi soll wieder und wieder den ‚Willow-Song‘ singen, und du sollst den Beifall hören. O, was für einen Beifall!
Komm in diesen kleinen Raum – es ist mein liebster; aus diesem Fenster und diese Stufen hinunter können wir jeden Ort aufsuchen, an dem du je gewesen bist, an dem ich je gewesen bin – und andere Orte außerdem. Nichts ist zu fern, und wir müssen nur Hand in Hand gehen. Ich weiß noch nicht, wo meine Ställe und Wagenremisen sind; du musst mir helfen, es herauszufinden. Aber bisher hat mir am Fuß dieser Stufen nie eine Kutsche gefehlt, wenn ich fahren wollte, noch eine Dampfbarkasse, noch eine Gondel; noch ein schönes Ziel.
Auf diesem Diwan können wir sitzen und durch dieses Fenster sehen, was immer wir wollen. Was soll es sein? Im Moment schaust du auf ein sehr unruhiges Meer, nirgends ein Schiff in Sicht. Hörst du die Wellen brechen und donnern, siehst du den Albatros? Ich las gerade die ‚Ode an die Nachtigall‘ von Keats und war so begeistert von der Idee eines Gitterfensters, das sich auf den Schaum
‚of perilous seas by faery lands forlorn‘
(riskanter Meere um verlassene Feenlande)
öffnet, dass sich der Wunsch in mir regte, selbst ein solches Gitterfenster zu haben. Ich habe dieses Meer aus meiner inneren Vorstellung zu entwickeln versucht, weißt du, oder auch aus Meeren, die ich durchsegelt habe. Gefällt es dir? Ich habe es vor vierzehn Tagen angelegt, und die Wellen rollen die ganze Zeit seither. Wie sie brüllen! Und lausche auf den Wind! Die ‚Feenlande‘ habe ich nicht hinbekommen. Ich fürchte, ich brauche ein Gitterfenster fürs Meer und ein anderes fürs Land. Du musst mir helfen! Was willst du derweil heute Abend sehen – das Yosemite-Tal? Den Newski-Prospekt im Winter mit den Schlitten? Den Rialto? Die Bucht von Neapel nach Sonnenuntergang mit dem ausbrechenden Vesuv?“
„O Mary – Mimsey – was soll ich mit dem Vesuv – und Sonnenuntergängen und dem Golf von Neapel – gerade jetzt? Der Vesuv ist in meinem Herzen!“
So begann für uns beide eine Zeit von fünfundzwanzig Jahren, in denen wir acht oder neun der jeweils vierundzwanzig Stunden zusammen verbrachten – außer in einigen seltenen Fällen, in denen Krankheit oder andere Gründe uns daran hinderten, zur gleichen Zeit zu schlafen.
Mary! Mary!
Sie war mein Idol, als sie lebte; sie ist es in meiner Erinnerung.
Um ihretwillen sind mir alle Frauen heilig, selbst die niedrigsten, verderbtesten und gottverlassensten. In ihr fanden sie immer eine helfende Freundin.
Wie kann ich einer Frau, die mir näher war, als je eine Frau einem Mann war, gebührende Anerkennung zollen?
Ich kenne ihren Geist wie meinen eigenen! Keine zwei menschlichen Seelen können einander je so durchdrungen haben wie unsere – oder wir sollten davon gehört haben. Jeder Gedanke, den sie von ihrer Kindheit bis zu ihrem Tod je hatte, wurde mir, jeder meiner Gedanken ihr enthüllt! So wie wir lebten, war das unvermeidlich. Die Berührung eines Fingers genügte, um den seltsamen Kreislauf in Gang zu setzen und ein gemeinsames Bewusstsein ihrer oder meiner Vergangenheit oder Gegenwart zu etablieren.
Und o, wie dankbar bin ich, dass ein glückliches Geschick mich, den Mörder und Strafgefangenen, der ich bin, vor allem bewahrt hat, das zu verzeihen ihr unmöglich gewesen wäre!
Ich glaube, dass es nicht so sehr Schüchternheit und Armut, verbunden mit Unbeholfenheit und sozialer Blödheit, sondern Selbstbeschränkung und Selbstachtung waren, die mich vor mancher Fallgrube bewahrten, die vielen besseren und begabteren Männern als mir zum Verhängnis wurden.
Ich glaube, dass ihre außerordentliche Zuneigung, Zufallsprodukt eines fortdauernden, in der Kindheit empfangenen Eindrucks, mich durch mein Leben, ohne dass es mir bewusst wurde, verfolgt und auf irgendeine verborgene, geheimnisvolle Art vor Gedanken und Taten bewahrt hat, die mich unwürdig gemacht hätten – selbst in ihren allzu nachsichtigen Augen.
Wer weiß, vielleicht lag im Abschiedskuss und –segen ihrer süßen Mutter, in den Tränen, die sie über mich vergoss, als ich ihr vor so vielen Jahren am Straßentor Lebewohl sagte, ein antiseptischer Zauber? Mary! Ich bin ihr von ihrer kränklichen, leidenden Kindheit bis in die Mädchenzeit gefolgt, von ihrer halbreifen, anmutig-schlaksigen Mädchenzeit bis zum Tag ihres Rückzugs aus der Welt, deren schönster Schmuck sie war. Die Zeit vom Mädchen zur Frau schien ein Triumphzug durch alle Höfe Europas gewesen zu sein – Szenen, von denen ich mir nie hätte träumen lassen – schmeichelndes Wettfreien um sie, das jeder Fürstin den Kopf verdreht hätte! Und sie war doch nur die schlichte Tochter eines arbeitsamen Wissenschaftlers und Arztes – die Enkelin eines Geigers!
Aber selbst österreichische Hofetikette wurde außer Kraft gesetzt, als es um das Kind des schlichten Dr. Seraskier ging.
Was für Männer habe ich zu ihren Füßen gesehen – was für glänzende, hübsche, galante, brillante, ritterliche, adlige und lebenslustige Männer! Und von ihrer Seite allen gegenüber die gleiche frohe Herzlichkeit, dieselbe freundliche, lachende, scherzende, unschuldige Heiterkeit ohne jeden Eigennutz.
Monsieur le Major hatte Recht – „elle avait toutes les intelligences de la tête et du cœur“. (Sie hatte alle Klugheit des Kopfes und des Herzens) Alt und Jung, die Besten und die Übelsten schienen sie gleichermaßen zu lieben und zu achten – Frauen ebenso sehr wie Männer – für ihre vollkommene Aufrichtigkeit und ihre süße Vernünftigkeit.
Und die ganze Zeit plagte ich mich an meinem tristen Zeichenbrett in Pentonville ab, führte die Pläne anderer für einen Stall oder die Hütte eines Armen aus und erfüllte nicht einmal diese armselige Aufgabe sonderlich gut.
Ich wäre vor Erniedrigung und Eifersucht verrückt geworden, hätte ich ihr vergangenes Leben sehen können, aber wir sahen es Hand in Hand zusammen – der magische Kreislauf war in Gang gesetzt! Und als ich sah, wie alles sie in Mitleidenschaft zog, wusste ich Bescheid und bewunderte die Schlichtheit, mit der sie all diesem Pomp und Glanz so geringe Bedeutung zumaß.
Und ich erzitterte, als ich herausfand, dass derjenige Platz in ihrem Herzen, der nicht mit der Erinnerung an ihre sehr geliebte Mutter und dem Bild ihres Vaters (einem der edelsten und besten aller Männer) gefüllt war, die lachhafte Gestalt eines kleinen Jungen mit weißseidenem Hut und Eton-Jacke bewahrte. Und dieser kleine Junge war ich!
Dann kamen die schrecklichen zwölf Monate, die ich nur allzu gerne leer ließ, die zwölf Monate, die ihre mädchenhafte Laune zugunsten ihres Gatten anhielt – an dann gehörte ihr Leben wieder mir – für immer!
Und mein Leben!
Das Leben eines Strafgefanenen ist in der Regel nicht glücklich; man stellt sich sein Bett nicht mit Rosen besteckt vor.
Meines war es!
Wäre ich der elendeste Aussätzige, der je zu seiner geflochtenen Hütte auf Molokai (eine der acht hawaiischen Hauptinseln) gekrochen ist, ich wäre doch der glücklichste aller Menschen, könnte ich dort, wo ich mich befände, nur schlafen und im Schlaf der Freund der schlafenden Mary Seraskier sein. Sie hätte mich nur umso mehr geliebt!
Sie hat mein langes Gefangenenleben mit mehr Glück gefüllt, als ein Monarch sich je erträumen könnte, und hat, indem sie das tat, ihr eigenes Glück gefunden. Das armselige, geplagte Leben, das ich vor meinem großen Missgeschick führte – ich habe versucht, es zu beschreiben – sie hat fast jede seiner Stunden mit leidenschaftlichem Interesse und großer Anteilnahme verfolgt, während wir Hand in Hand die Vergangenheit des jeweils anderen durchwanderten. Sie wäre jederzeit nur zu glücklich gewesen, es mit mir teilen und ihr eigenes aufgeben zu können.
Ich hatte Angst, wie eine so klägliche Enthüllung auf eine Frau wirken würde, die ein so glänzendes Leben in solcher Höhe geführt hatte. Ich hätte mich nicht fürchten müssen! Wie ich für die Achtjährige ein „engelhafter Held“ gewesen war, blieb sie ihr ganzes Leben lang davon überzeugt, dass ich ein Apollo war – ein missverstandenes Genie – ein Märtyrer!
Es macht mich krank vor Scham, wenn ich daran denke. Aber ich bin nicht der erste unwerte Sterbliche, den blinde, alles verzeihende Liebe auserwählt hat, um ihn mit ihren unbezahlbaren Schätzen zu überschütten. Tarapatapoum ist nicht die einzige Fee, die einen Riesenclown mit Eselskopf (Shakespeare: Sommernachtstraum) zu einem Prinz Charming verklärt hat; dies Schauspiel ist, leider! nicht selten. Aber ich bin wenigstens demütig dankbar gewesen für den unverdienten Segen, und habe seinen Wert erkannt. Und darüber hinaus kann ich, meine ich, Anspruch auf ein Talent erheben: Ich weiß durch Intuition, wann und wo und wie ich lieben muss – in einem Moment – blitzartig – und für immer!
Fünfundzwanzig Jahre!
Es kommt mir wie tausend vor, soviel haben wir in diesem tätig verzauberten Vierteljahrhundert gesehen, gefühlt und getan. Und doch. Wie schnell ist die Zeit vergangen!
Und jetzt muss ich mich bemühen, einige Rechenschaft über unser wundervolles inneres Leben abzulegen – à deux – eine heikle und schwierige Aufgabe.
Es liegt sowohl eine gewisse Unverschämtheit als auch ein Mangel an gutem Geschmack darin, wenn ein Mann vor der Öffentlichkeit – oder vor irgendwem – die Glückseligkeit offenlegt, die er erlangt hat durch die Liebe einer ihm ergebenen Frau, mit deren Leben sein eigenes sich verbunden hat.
Der wohlwollendste Leser ist geneigt, sich von einer solchen Enthüllung abgestoßen zu fühlen und an den Schönheiten, Tugen und geistigen Gaben einer Frau zu zweifeln, die er nie gesehen hat; bei allen Ereignissen zu fühlen, dass sie ihn nichts angehen, sondern Gegenstand heiliger Zurückhaltung ihres allzu glücklichen Liebhabers oder Gatten sein sollten.
Das Fehlen solcher Zurückhaltung hat den Wert so mancher Autobiografie und sogar manches Romans beschädigt; und wer weiß nicht auch aus schmerzlicher Erfahrung im Privatleben, wie peinlich für den Zuhörer solche zarten Offenbarungen manchmal sein können? Ich will mein Bestes tun, um in diesem Fall die Grenzen einzuhalten. Wenn es mir misslingt (es könnte mir bereits misslungen sein), kann ich mich nur damit verteidigen, dass die Umstände sehr außergewöhnlich sind und kaum verglichen werden können; und dass Ausnahmen gestattet sein müssen für die tiefe Dankbarkeit, die ich schulde und empfinde über meine leidenschaftliche Bewunderung und Liebe hinaus.
Für die nächsten drei Jahre hat mein Leben nichts vorzuweisen als den Wechsel zwischen Flitterwochen, wie es sie nie gab, und eintönigem, aber zufriedenem Gefängnisleben, von dem auch nicht eine Stunde erzählens- oder erinnernswert ist – außer als Folie für seine Alternative.
Es bestand eigentlich nur aus einer Stunde für mich, der Stunde des Schlafengehens, und zum Glück war sie zeitig.
Körperlich auf gesunde Weise ermüdet, geistig in glückseliger Erwartung, lag ich auf meinem Rücken, die Hände ordentlich unterm Kopf verschränkt, und bald umfing mich balsamischer Schlaf; bevor ich vergessen hatte, wer und was und wo ich in Wirklichkeit war, erreichte ich das Ziel, auf das mein Wille gerichtet war, und erwachend fand ich meinen Körper an einem anderen Ort, in anderer Kleidung, auf der Couch vor einem Zauberfenster, die Arme immer noch unterm Kopf verschränkt – in sakramentaler Haltung.
Dann streckte ich meine Glieder und befreite mich von meinem äußeren Leben, wie der neugeborene Schmetterling aus der Haft des selbst gesponnenen Kokons schlüpft, mit einem unsäglichen Gefühl von Jugend, Kraft, Frische und Glück; und die Augen öffnend sah ich auf der benachbarten Couch Marys Gestalt, auch in Rückenlage, aber bewegungslos und unbeseelt wie eine Statue; nichts konnte sie zum Leben erwecken, bis der Zeitpunkt kam: ihre Stunden waren etwas später, sie befand sich noch in den Zwängen des äußeren Lebens, das ich gerade hinter mir gelassen hatte.
Und diese Zwänge waren in ihrem Fall verwickelter als in meinem. Obgleich sie sich von der Welt zurückgezogen hatte, hatte sie viele Freunde und führte eine immense Korrespondenz. Und da sie eine Frau von grenzenloser Gesundheit und Energie war, von glänzender Spannkraft der sinnlichen Triebe und großen Fähigkeiten in allem Geschäftlichen, hatte sie sich mit vielerlei Pflichten und Beschäftigungen eingedeckt.
Sie war die eigentliche Leiterin eines Hauses für gefallene Mädchen, einer Besserungsanstalt für jugendliche Diebe und eines Kinderkrankenhauses – denen allen sie ihre unmittelbare persönliche Aufsicht und fast jeden Pfennig zuwandte, den sie hatte. Sie hatte ihr Haus in Hampshire vermietet und lebte mit ein paar Hausangestellten in einem kleinen möblierten Haus auf Camden Hill. Sie hatte keine Kutsche, benutzte Droschken und Omnibusse, kleidete sich wie eine Tageserzieherin, obgleich niemand königlicher und großartiger erscheinen konnte als sie, wenn wir zusammen waren.
Sie behielt ihren Namen und Titel als mächtiges Mittel des Einflusses zugunsten ihrer Wohltätigkeit und benutzte sie gnadenlos bei ihren ständigen Angriffen auf die Geldbörsen wohlwollender Philister, die große Leute lieben.
Was alles zu vielen Bemerkungen Anlass gab, die ihren Gleichmut nicht im Mindesten erschütterten.
Sie besuchte auch Vorträge, Ausschüsse, Gremien und Ratsversammlungen; eröffnete Basare, Suppenküchen, Kaffeestuben usw. Die Liste ihrer übernommenen Aufgaben war endlos. So war ihr äußeres Leben zum Bersten gefüllt, und anders als meins, war jede seiner Stunden berichtenswert – wie ich sehr gut weiß, denn ich habe sie alle miterlebt. Aber dies ist nicht der Ort, um vom äußeren Leben der Herzogin von Towers zu berichten; eine andere Hand hat das bereits getan, wie jedermann weiß.
Jede weitere Seite muss Mary Seraskier gewidmet sein, der Fee Tarapatapoum von Magna sed apta (denn so hatten wir das neue Zuhause, den Kunstpalast genannt, um den sie Parva sed apta erweitert hatte, dem Zuhause ihrer Kindheit).
Zurück dahin, wo wir sie ohne Bewusstsein liegen ließen. Bald würde die Farbe in ihre Wangen zurückkehren, der Atem zu ihren Nüstern, der Puls zu ihrem Herzen, und sie würde erwachen in ihrem Eden, wie sie es nannte – unserem gemeinsamen inneren Leben – dass wir es in Gesellschaft des jeweils anderen die nächsten acht Stunden verbrachten.
In Erwartung diese glücklichen Augenblicks, brühte ich Kaffee auf (was für Kaffee!), rauchte ein oder zwei Zigaretten; und um die richtig zu genießen, muss man ein gewohnheitsmäßiger Raucher sein, der sein wirkliches Leben in einem englischen Gefängnis verbringt.
Wenn sie aus ihrer sechzehnstündigen tätigen Trance der äußeren Welt erwachte, erwartete uns eine Auswahl von Vergnüglichkeiten, wie sie kein anderer Sterblicher je hatte. Sie war ihr ganzes Leben lang eine große Reisende gewesen, hatte in vielen Ländern und Städten geweilt und mehr von Leben, Welt und Natur gesehen als die meisten Menschen. Ich brauchte nur ihre Hand zu ergreifen, und einer von uns musste nur einen Wunsch äußern, und siehe! wo immer einer von uns gewesen war, was immer einer von uns gesehen oder gehört oder gefühlt, oder sogar gegessen oder getrunken hatte, es war alles wieder da, um darunter zu wählen und es mit dem, mit der anderen zu teilen – eine solche Hypnose unserer selbst und des jeweils anderen hätte sich niemand je erträumen können.
Alles war lebenswahr und so wirklich für uns beide, wie es im Augenblick seiner wirklichen Ereignung gewesen war – mit einem zusätzlichen Frischezauber, den es in der sterblichen Existenz nie gehabt hatte. Es war kein Traum; es war ein zweites Leben, ein besseres Land.
Wir mussten uns freilich an bestimmte Grenzen halten und uns hüten, bestimmte Gesetze, die wir selbst entdeckt hatten, aber nicht begründen konnten, zu übertreten. Zum Beispiel war es nicht gut, Dinge zu unternehmen, die außerhalb unserer wirklichen Erfahrung lagen: zu fliegen, aus großer Höhe zu springen oder irgendetwas von dem Unnatürlichen zu tun, das gerade den Reiz und das Wunderbare normaler Träume ausmacht. Wenn wir das taten, trübte sich unser Wahrtraum und wurde ein normaler Traum – unbestimmt, flüchtig, unwirklich und unwahr – das unfundierte Gewebe einer Vision. Auch durften wir uns in keiner Weise verändern; bis zur Form eines Fingernagels mussten wir uns gleich bleiben; dabei pflegten wir uns sehr und konnten uns unser Alter aussuchen. Wir wählten zwischen sechsundzwanzig und achtundzwanzig und blieben dabei.
Aber es gab auch Dinge, die im wirklichen Leben nicht möglich waren, die wir aber ungestraft tun durften – sehr schöne Dinge!
So war es nach dem Aufwach-Kaffee sicherlich wunderschön, ein paar Stunden im Yosemite Valley zu verbringen, gemächlich herumzuschlendern, die Mammutbäume zu betrachten – eine unerschöpfliche Quelle des Entzückens für uns beide – die duftende frische Luft zu atmen, die anderen Touristen zu beobachten und ihrem Gespräch zu lauschen in dem angenehmen Bewusstsein, dass wir, solide und substantiell für einander, doch völlig unhörbar, unsichtbar und unberührbar waren für sie. Oft verzichteten wir auf die Touristen und hatten das Yosemite Valley ganz für uns. (Immer dort und überall, wo sie mit ihrem Ehemann gewesen war, verzichteten wir auf ihre frühere Gestalt und auf ihn, seinen Anblick hätte ich nicht ertragen).

Wenn wir zu Genüge geschlendert waren und uns sattgesehen hatten, war es wiederum reizend, nur durch eine leichte Anstrengung ihres Willens und ein kurzes Augenschließen durch die Via Cornice zu einem hervorragenden Gartenkonzert in Dresden zu fahren oder in einer Gondel zum Samstags-Pop (Popular Concert) in der St. James Hall gerudert zu werden. Und dort würden wir dann in einen Hansom springen und über Piccadilly, durch den Park und am Arc de Triomphe vorbei zu „Magna sed apta“ in der Rue de la Pompe in Passy versetzt werden (eine bezaubernde Fahrt und kein bisschen zu lang), gerade rechtzeitig zum Mittagessen.
Ein sehr delikates kleines Essen, vernünftig nach ihrer Erinnerung zusammengestellt, nicht nach meiner (und serviert im erlesensten Restaurant von ganz Paris – dem Princesse de Chevagné): „huitres d’Ostende“ zum Beispiel und „soupe à la bonne femme“, auf die ein „perdrix au choux“ folgte, dann Pfannkuchen und „fromage de Brie“; und zu trinken eine Flasche „Romané Conti“; sogar ohne die Schererei mit Kellnern, die die Gänge auftragen; ein Wunsch, ein kurzes Augenschließen – Augenblick! – (im Original deutsch), und schon war serviert, und dann bedienten wir einander gegenseitig.
Nach meiner Gefängniskost und mit nichts Erinnerlichem aus letzter Zeit als Tenpenny-Mahlzeiten in London, wird man mich kaum für einen allzu krassen Materialisten halten, wenn ich diese kleinen Bankette und in dieser Gesellschaft schätzte. (Das einzige Essen, an das ich mich erinnern kann außer den Mahlzeiten in meiner Kindheit, das keine Tenpenny-Mahlzeit war, war das berühmte Essen bei den Crays, bei dem ich entdeckt hatte, dass die Herzogin von Towers Mimsey Seraskier war – und von dem habe ich nicht viel zu mir genommen).
Dann eine Zigarette und eine Tasse Kaffee und ein Glas Curaçao; und um dann unsere Privatloge zu erreichen, brauchten wir nur den Raum zu durchqueren und einen Vorhang beiseite zu schieben.

Und vor uns lag der Theater- oder Opernsaal, glanzvoll beleuchtet, die Instrumente stimmten, und das berühmte Publikum strömt herein. Gekrönte Häupter, berühmte Schönheiten, weltbekannte Feldherren und Staatsmänner, Garibaldi, Gortschakow, Cavour, Bismarck und Moltke, die jetzt so berühmt sind, und wer nicht? Mary benannte sie mir. Und in der Nachbarloge Dr. Seraskier und seine große Tochter, die anscheinend mit der ganzen glänzenden Menge befreundet waren.
Bald war es St. Petersburg, bald Berlin, bald Wien, Paris, Neapel, Mailand, London, jede große Stadt kam an die Reihe. Aber unsere Loge war immer dieselbe, und immer die beste im Haus, und ich als einziger genoss das Privileg, meine Zigarre unter den Augen königlicher Hoheiten, von Mode und Glanz zu rauchen.
Nach der Ouvertüre hob sich der Vorhang. Wenn es ein Stück auf Deutsch, Russisch oder Italienisch war, musste ich nur Marys kleinen Finger berühren, um alles zu verstehen – wahr aber unbegreiflich. Denn so gut wie ich alles verstand, sprach ich kein Wort dieser Sprachen, und von dem Moment an, in dem der Kontakt unterbrochen wurde, hätten sie für mich ebenso gut Hebräisch oder Griechisch sprechen können.
Für Musik freilich interessierten wir uns am meisten, und ich glaube, ich darf sagen, Musik hatten wir in den drei Jahren (und auch noch danach) im Überfluss. Denn trotz ihres so beschäftigten Wachlebens, fand Mary die Zeit, alles an guter Musik zu hören, was es in London gab, um es mir bei Nacht weiterzugeben; und wir hörten es uns zusammen wieder und wieder an, und da capo.
Es ist das seltene Privileg zweier privater Individuen, von denen einer Strafgefangener ist, einer Aufführung beizuwohnen, die unter der Patronage anwesender gekrönter Häupter steht und doch fähig zu sein, die Wiederholung von allem zu erzwingen, was ihnen gefällt. Wie oft haben wir das getan!
O Joachim! O Clara Schumann! O Piatti! Sie alle kenne ich so gut, und habe sie doch nie mit leiblichem Ohr gehört! O ihr anderen, die zu erwähnen unfair wäre, wenn man nicht alle erwähnt – eine glorreiche Liste! Wie haben wir euch, ohne dass ihr es merktet, dieselben Takte immer und immer wieder spielen und singen lassen, ohne dass ihr je das geringste Zeichen von Ungeduld oder Ermüdung gabt! Wie oft haben wir Liszt herausgerufen, auf seinem Lieblingsklavier zu spielen, das unseren liebsten Salon schmückte! Wie wenig wusste er (oder wird je davon wissen, ach!), welch ausgesuchtes Entzücken er uns vermittelte!
O Patti, Angelina! O Santley und Sims Reeves! O de Soria, Nachtigall des Salons, ich frage mich, ob du einen einzigen Ton ausgelassen hast!
Und du, Ristori, und du, Salvini, et vous, divine Sarah, qui débutiez alors! On me dit que votre adorable voix a perdu un peu de sa première fraîcheur. Cela ne m’étonne pas! Bien sûr, nous y sommes pour quelche chose! (und Sie, göttliche Sarah [Bernard], die damals debütierte. Man hat mir gesagt, dass Ihre anbetungswürdige Stimme ein wenig von ihrer früheren Frische verloren hat. Das erstaunt mich nicht! Klar, wir leben nicht umsonst!)
*****
Und dann die Bildergalerien, die Museen, die botanischen und zoologischen Gärten aller Länder – “Magna sed apta” hatte Platz für sie alle, sogar für den Raum der Elgin Marbles im Britischen Museum, den ich selbst hinzugefügt habe.
Was für begeisterte Stunden haben unter den Bildern und Statuen der ganzen Welt zugebracht, indem wir sie hier oder dort bald aussonderten, bald unterschiedlich hängten und in einem unserer Meinung nach besseren Licht plazierten! So zeigte sich die „Venus von Milo“ in „Magna sed apta“ sehr viel vorteilhafter als im Louvre.
Waren wir zu Hause wundervoll beschäftigt und wollten es noch schöner haben, bestellten wir für draußen schrecklich schlechtes Wetter; es regnete junge Hunde, oder der Nordwind pfiff, und Schnee fiel auf die trostlosen Gärten von „Magna sed apta“ und hüllte die Landschaft, soweit das Auge reichte, in Weiß.
Unseren Herzen am nächsten waren freilich einige Bilder unserer Zeit, denn wir waren letztlich, bei all unserem Bemühen um Kultiviertheit, Anhänger der Moderne.
Es gab kaum einen lebenden oder bis vor kurzem lebenden Meister in Europa, dessen beste Werke wir nicht besaßen, so belichtet und gehängt, dass die Meister selbst damit zufrieden gewesen wären; denn wir hatten viel Platz zu unserer Verfügung, und jedes Bild bekam eine Wand für sich in dem Farbton, der seiner Schönheit angemessen war, mit einem komfortablen zweisitzigen Sofa genau gegenüber.
Aber in dem kleinen Raum, in dem wir uns meistens aufhielten, dem Raum mit dem magischen Fenster, hatten wir einige besondere Lieblinge der englischen Schule versammelt, denn wir hatten so viel ausländisches Blut in uns, dass wir uns britischer fühlten als John Bull höchstpersönlich – plus royalistes que le roi. (königlicher gesinnt als der König.)
Dort fanden sich Millais‘ „Herbstblätter“, seine „Jugend von Sir Walter Raleigh“, sein „Oktoberfrost“; Watts‘ „Endymion“ und „Orpheus und Eurydike“; Burne-Jones‘ „Chant d’amour“ und sein „Laus Veneris“; Alma Tademas „Audienz des Agrippa“ und seine „Frauen von Amphissa“; J. Whistlers Porträt seiner Mutter; „Venus und Äsculap“ von E. J. Poynter, F. Leightons „Daphnephoria“; George Masons „Erntemond“; und Frederic Walkers „Hafen der Zuflucht“, und natürlich Merridews „Sonnengott“.
Auf einem von H. S. Marks entworfenen Wandschirm, am Rand erlesen geschmückt mit Goldregenpfeifern und ihren Eiern (die ich anbete), gab es kleinere Juwelen in Öl oder Aquarell, in die Mary sich zur einen oder anderen Zeit verliebt hatte. Die unsterbliche „Mondscheinsonate“ von Whistler; E.J. Poynters erlesene „Unsere liebe Frau von den Feldern“ (datiert Paris 1857); ein Paar der entzückenden „Bimbi“ von Valentine Prinsep, der Kinder zu lieben scheint; T. R. Lamonts berührendes „L’après dîner de l’Abbé Constantin“ mit dem niedlichen Mädchen an dem alten Spinett; und das bewundernswerte Werk von T. Armstrong aus seiner früheren und realistischeren Phase, „Le Zouave et la nounou“, nicht zu erwähnen genial hingehauene Skizzen von John Leech, Charles Keene, Tenniel, Sambourne, Furniss, Caldecott usw.; nicht zu erwähnen weiterhin Silberstiftskizzen eines unglaublich kolossalen schwärzlichen, zottigen Bernhardiners, signiert mit dem vertrauten französischen Namen eines fröhlichen Troubadours des Stifts, irgendein verirrter Mischling wie ich selbst, der seinen Hund so sehr geliebt haben muss wie ich meinen.
Aber inmitten all dieses unvergleichlichen künstlerischen Glanzes spürten wir, dass etwas fehlte. Alles war irgendwie hohl; und wir entdeckten, dass wir der wichtigsten Motive, um all diese schönen Dinge zu sammeln, ermangelten.
Wir waren nicht die einzigen Besitzer.
Wir hatten niemanden, dem wir sie zeigen konnten.
Deshalb konnten wir nicht stolz darauf sein.
Und wir fanden heraus, dass wir, wenn wir zur Abwechslung und um die Freuden des Zuhause zu genießen, schlechtes Wetter bestellt hatten, gerade so glücklich in meinem alten Schulzimmer waren, wo sich Eichhörnchen, Affe und Igel aufhielten, wir hatten beide einen Armstuhl mit Sitz aus Rohrgeflecht am Kamin, rösteten Maronen für einander und hatten ein Buch zwischen uns, aus dem der eine der anderen laut vorlas; oder, besser noch, die Morgen- und Abendzeitungen, die Mary vor einigen Stunden gelesen hatte; und, wunderbar zu berichten, sie hatte sie nicht einmal gelesen, als sie wach war, sie hatte sie nur sorgfältig überflogen, den Inhalt jeder Kolumne einer nach der anderen von unten nach oben in sich aufgenommen, und doch konnte sie jedes einzelne Wort aus der Traumzeitung vorlesen, die sie in Händen hielt, und so das Heu des Journalismus wiederkäuen.
Dies erschien uns immer, in begrenzter aber praktischer Weise, als der vollständigste und bezeichnendste Sieg, den unser Geist über die Materie errungen hatte.

Freilich konnten wir so sehr viel nicht lesen, wir hatten zu vieles, worüber wir reden mussten.
Unglücklicherweise war die Bibliothek die Schwachstelle von „Magna sed apta“. Natürlich konnte sie nur aus Büchern bestehen, die Mary oder ich im Wachzustand gelesen hatte. Sie hatte jedoch ein so tätiges Leben geführt, dass ihr nur wenig Muße zum Lesen übrig geblieben war, und ich hatte nur das gelesen, was ein junger Allerweltsmann, der gerne liest, eben so liest.
Gleichwohl waren von den Büchern, die wir gelesen hatten, die meisten da, und sie waren so hervorragend gebunden, dass ihre Autoren vor Stolz und Freude errötet wären, hätten sie sie sehen können. Und auch wenn wir wenig Zeit hatten, sie erneut zu lesen, konnten wir doch die eigentliche Wonne des Bibliophilen genießen und ihre Rücken anschauen, sie aus dem Regal nehmen, betasten und sorgsam wieder zurückstellen.
Bei den meisten dieser Vergnügungen, Ausflüge, Festlichkeiten und Kaminfreuden, war Mary natürlich die Führerin und Gastgeberin; es hätte kaum anders sein können.
Es gab einmal eine berühmte Mary, von der gesagt wurde, sie zu kennen, bedeute, liberal erzogen zu sein. Ich glaube, ich darf sagen, Mary Seraskier gekannt zu haben, hat genau das bei mir bewirkt.
Aber dann und wann machte ich einen kleinen Versuch, ihre Gastfreundschaft zu erwidern.
Wir haben uns in Clerkenwell, Smithfield, Cow Cross, in der Petticoat Lane, auf dem Ratcliffe Highway und in den Häfen von Ost- und Westindien unters gemeine Volk gemischt.
Sie hat mich in billige Komödienbuden und Varietés begleitet; zum Greenwich Markt und in die Gärten von Cremorne und Rosherville – und alles gefiel ihr. Sie kannte Pentonville so gut wie ich, auch meine alten Behausungen, wo wir uns beide über meine frühere Schulter beugten, während ich zeichnete oder las. Sie war es, die mein unbedeutendes prophetisches Liedchen über den „Glockenschlag“, das mir völlig entfallen war, der Vergessenheit entriss. Sie war auf Mr. Lintots Gesellschaften, die sie sehr amüsant fand – besonders Mr. Lintot.
Und tiefer in die Vergangenheit vordringend, ist sie mit mir durch ganz Paris gewandert, mit mir auf die Türme von Notre Dame gestiegen und hat vergeblich nach dem geheimnisvollen Wort Άνάνκη Ausschau gehalten!
Ich hatte ihr aber auch Besseres zu zeigen, wenn ich auch nicht weit herumgekommen war.
Sie hatte die Hampsteader Heide nie gesehen, die ich auswendig kannte; und die Hampsteader Heide ist zu jeder Zeit, besonders an einem sonnigen Morgen im späten Oktober, nicht zu verachten.
Die Hälfte der Blätter ist gefallen, so dass man die verblassende Pracht derer betrachten kann, die verbleiben; gelb, braun, blass und hektisch rot, leuchtend wie goldene Guinees und glänzende Kupfermünzen gegen das reiche, dunkle, geschäftliche Grün der Bäume, die den ganzen Winter hindurch prangen wollen wie die großen geneigten Kiefern bei den Spaniern, die alten Zedern und die Hecken von Eiben und Ilex, für die die Gärten von Hampstead berühmt sind.
Vor uns liegt ein Farnmeer, ins Rotbraune verwelkt, darin dunkelgrüne Inseln von Ginster und kleine Bäume mit scharlachroten, orangenen und zitronengelben Blättchen, die zu Boden segeln und einander auf dem blanken Gras verfolgen im frischen Westwind, der die Espen rascheln lässt, dass sie die weißen Seiten ihrer Blätter hervordrehen, als resignierten sie fromm vor dem bevorstehenden Wechsel.
Blau ragt in der Ferne Harrow-on-the-Hill mit seinem spitzen Kirchturm; und ferne Höhenzüge erheben sich aus dem Bodennebel wie zurückweichende Wellen ins Blaue, einer hinter dem anderen; der letzte Höhenzug verschmilzt bläulich mit dem All. In der Mitte von allem schimmert der Welsh Harp See, wie ein locker gewordenes Stück Himmel ist er in die Landschaft hinabgetaumelt mit der blanken Seite nach oben.
Auf der anderen Seite London, und nur das vergoldete Kreuz von St. Pauls befindet sich in Augenhöhe; die Stadt liegt zu unseren Füßen wie Paris von den Höhen von Passy aus, ein Anblick, der Wahrträumer starren und denken und nur noch mehr träumen lässt; und da sitzen wir, denken und träumen und starren uns satt, Hand in Hand, unsere Seelen stürzen ineinander.
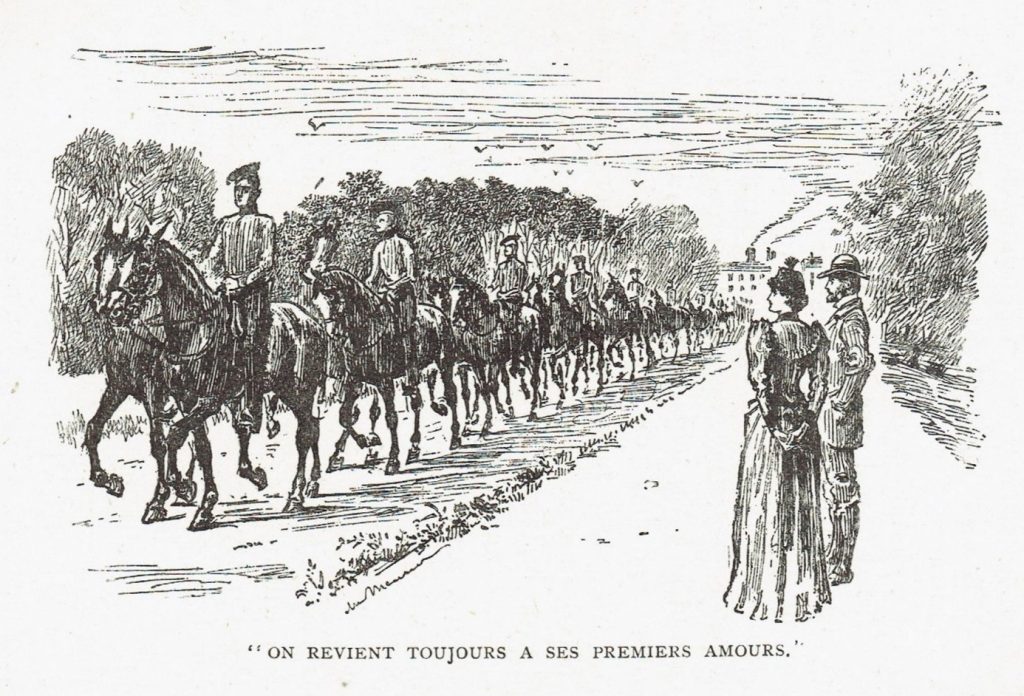
Als wir da einmal saßen, hörten wir Hufgetrappel hinter uns, es rührte von einer Truppe meines alten Regiments, das zum Exerzieren ausrückte. Unsichtbar für alle außer uns selbst, beobachteten wir die übermütigen Kavalleristen, die auf ihren sanften schwarzen Dienstpferden vorbeiritten.
An erster Stelle der Kornett – ein sonnengelockter Apoll, ein goldverbrämter Jüngling, anmutig und prachtvoll fürs Auge – sorglos, furchtlos, aber dumm, barsch und stolz – ein englischer Phöbus von Châteaupers, (fiktive Figur aus Victor Hugos „Glöckner von Notre Dame“) der Sohn eines großen Unternehmers; ich erinnere mich gut an ihn, und dass er mich nicht mochte. Dann die Dienstgrade in Reihe in ihren Stalljacken, die meisten von ihnen (bis auf den einen oder anderen strammen Korporal) raue, hoch aufgeschossene junge Männer, die viel künftige Kraft verhießen, und jeder führte ein Zweitpferd; und unter ihnen, am größten und schlaksigsten von allen, aber rot wie ein Ackerknecht, ritt mein früheres Selbst und pfiff stur „On revient toujours à ses premières amours“ vor sich hin – ein Anblick (und Ton), der eine der vielen zarten Saiten in Marys Natur anzuschlagen schien; denn ihre Augen füllten sich mit Tränen.
Es ist unnötig, Flitterwochen, die mit solchen Abenteuern gefüllt waren und drei Jahre dauerten, erschöpfend zu beschreiben. Es würde nur ein weiterer oberflächlicher Reisebericht von einer weiteren ungeübten Feder daraus. Und was für eine Feder wäre nötig für einen solchen Stoff! Es war kein bloßes Leben, es war die Sahne und Essenz des Lebens, die wir mit einander genossen, alle Mühsal, Reiberei und Ermüdung war weggelassen. Die notwendige irdische Reise durch Raum und Zeit zwischen den verschiedenen Freuden war ausgespart, es sei denn, eine solche Reise wäre eine Freude an sich.

Zum Beispiel kann man eine angenehme Stunde an Deck eines glänzenden Dampfers verbringen, der sich den Weg durch die saphirblaue tropische See zu irgendeinem lieblichen westindischen Eiland bahnt; mit einer guten Zigarre und der liebsten Begleiterin der Welt schaut man den Delphinen und den fliegenden Fischen zu und interessiert sich auch ein wenig für die Mitreisenden, den Kapitän und die Mannschaft. Und dann, wenn die Stunde um und die Zigarre geraucht ist, ist es an der Zeit, die Augen zu schließen und sein Selbst geruhsam an der Seite des Schiffs in einen schönen Schlitten hinabsinken zu lassen, um halb begraben unter kostbaren Pelzen an der vereisten Newa entlang zu wirbeln zu einem Ball im Winterpalais, dort mit deiner Mary durch die ganze adlige Schönheit von St. Petersburg zu walzen, und niemand beanstandet deine Art Walzer zu tanzen, die zunächst weit davon entfernt war, vollkommen zu sein, oder gar deine Garderobe, die ebenso wenig wie die von Mary nicht mehr die der damaligen Mode war. Wir waren ästhetische Wesen und sehr griechisch, wir entwarfen uns unsere Mode, die ich nicht beschreiben will, selbst.
Wo haben wir nicht Walzer getanzt vom Buckingham-Palast abwärts? Ich gestehe, ich entwickelte Geschmack am Walzen oder Walzer tanzen oder wie immer man es richtig nennt; und obgleich es da nicht viel zu rühmen gibt, darf ich doch sagen, dass es nach einem oder zwei Jahren keinen besseren Walzer-Tänzer in ganz Wien gab als mich.
Und hier möchte ich nebenher das Vergnügen erwähnen, das ich (Hand in Hand mit Mary natürlich) bei der Erneuerung und Verbesserung meiner Bekanntschaft mit unserer britischen Aristokratie empfand, die vor vielen Jahren auf Lady Crays Konzert auf so angenehme Art und Weise ihren Anfang genommen hatte.
Unsere britische Aristokratie tanzt Walzer keinesfalls gut, und es fehlt ihr allgemein an Leichtigkeit; aber es erfreut und ermutigt einige ihrer Mitglieder vielleicht zu hören, dass Peter Ibbetson (ehemaliger Rekrut, Architekt und Bauführer, Strafgefangener und geisteskranker Verbrecher), der unvergleichliche Möglichkeiten hatte, mit der Elite der europäischen Gesellschaft zu verkehren, unsere britische Aristokratie für die am besten aussehende, am besten gekleidete und sich am besten benehmende Aristokratie von allen hält, für die vernünftigste und am wenigsten exklusive – die vernünftigste vielleicht, weil sie so wenig exklusiv ist.
Sie brüskiert jene begabten und privilegierten Außenseiter schon mal, die (nur für die Ehre und den Ruhm der Sache) immer so bereit sind, ihr zu schmeicheln, sie zu belehren und zu amüsieren, stößt sie aber nicht gänzlich zurück, wenn sie ihre Botengänge erledigen, holen und schleppen und zu ihrem Vergnügen Purzelbäume schlagen und sogar ihre „hässlichen Entlein“ heiraten (oder sollten wir lieber sagen ihre „reizlosen Schwangössel“?), die keinerlei Aussicht haben, einmal einen Partner des gleichen Federkleids zu finden.
Denn sie hat das sichere englische Auge für körperliche Schönheit.
In der Tat wirft sie gerne das Taschentuch – erfolgreich natürlich – und zu ihrem Glück über die Grenzen ihres eigenen engen Bereichs hinaus – nein, sogar über den Atlantik hinweg in das Land, in dem Schönheit und Dollars so glücklich mit einander verbunden sind.
Ebenso wenig verachtet sie die Wohlgestalt der Töchter Israels, noch ihre Schekel, noch ihre Hirne, noch ihr altes und sehr wertvolles Blut. Sie kennt den geheimen Vorzug jener mechanischen Transfusion von Flüssigkeiten, die in der Wissenschaft als „einwärts und auswärts verlaufende Osmose“ bekannt ist (ich hoffe, ich hab’s richtig geschrieben), und praktiziert sie. Wobei sie sich als weise in ihrer Selbsterhaltung erweist und länger – aber nicht sehr lange – Bestand haben wird.
Peter Ibbetson (etc. etc.) zum Beispiel wünscht ihr keinerlei Schaden.
*****
Aber zurück. Trotz all dieser Versuchungen von Reise, Amüsement, Gesellschaft und weiter Welt, war doch unsere Zärtlichkeit „für den schönen Ort unserer Kindheit“ und all dessen, was mit ihm in Verbindung stand, so beschaffen, dass es unser größtes Vergnügen von allen war, unser altes Leben wieder und wieder zu durchleben, Gogo und Mimsey, unsere Eltern, unsere Cousins und Monsieur le Major ihre alten Wege immer wieder gehen zu lassen; und neue alte Wege für sie zu erinnern, was uns aus vereinzelten vergessenen Vergangenheitsstückchen manchmal gelang; nach ihnen zu suchen war der aufregendste Sport der Welt.
Unsere Zärtlichkeit für diese geliebten Schatten wuchs mit ihrer Vertrautheit. Wir konnten den ganzen Charme, die ganze Güte und Freundlichkeit dieser unserer lieben Väter und Mütter mit den Augen reifer Erfahrung anschauen, denn wir waren jetzt ziemlich genau in ihrem Alter; keine anderen Kinder konnten das je, seit die Welt steht, und wie wenige junge Eltern hätten einer so genauen Prüfung standgehalten wie die unseren!
Ach! Was hätten wir nicht gegeben, ihnen nur ein Fünkchen des Erkennens zu entlocken, aber das war unmöglich; oder ihnen nur ein einziges warnendes Wort zuflüstern zu können, das die ihnen drohenden Schläge des unerbittlichen Schicksals abgewendet hätte! Sie könnten heute vielleicht noch leben – alt natürlich, aber geehrt und geliebt wie keine Eltern je. Wie anders wäre alles gewesen! Aber leider! Leider!
Und wovon unter allen Dingen in der Welt wir nie genug bekommen konnten, das war der Spaziergang durch die Straße und den Park und den Bois de Boulogne zum Mare d’Auteuil; dort gemächlich an einem Frühlingsnachmittag entlang zu schlendern, gerade zeitig genug, um ein oder zwei Mittsommerstunden auf der Bank zu verbringen, die alte Wasserratte, den Gelbrandkäfer, die Kaulquappen und die Molche zu beobachten und die Frösche springen zu sehen; in der Dämmerung des Spätherbsts heimzukehren und im Schulzimmer meines alten Zuhauses Maronen rösten; dann zurück zum warmen, gut erleuchteten „Magna sed apta“, bei Mondlicht durch die Straße des Neujahrsabends, knöcheltief im Schnee; alles in wenigen kurzen Stunden.
Traumwinde und Traumwetter – was für ein Entzücken! Und alles real!
Sanfte, zärtliche Regentropfen, die uns nicht nass machen, wenn wir es nicht wollen; scharfe Fröste, die erstarren lassen, aber nicht erkälten; strahlende Sonne, die weder brennt noch blendet.
Tobende Winde des Frühlingsanfangs, die durch unsere festen Gerippe zu fegen scheinen und uns bis aufs Mark mit der alten Heldenerregung und –ekstase erfüllen, die wir in glücklicher Kindheit so gut kannten, jetzt aber, wenn wir wach sind, nicht mehr fühlen können!
Angenehme Sommerlüftchen, schwer vom Duft längst entschwundener französischer Wälder, Felder und blühender Gärten; schnelle, sanfte, feuchte Äquinoktialstürme wehen aus den weit entfernten Obstgärten von Meudon oder den alten Marktgärten von Suresnes in ihrem herbstlichen Verfall, beladen, wir wissen nicht, warum, mit einer seltsamen, geheimnisvollen, beunruhigenden Reminiszenz, zu subtil und unfassbar, um in irgend einer Sprache ausgedrückt zu werden – zu süß für Worte! Und dann der dunkle Dezemberwind, der von Norden herabweht und das kurze, frühe Zwielicht bringt und den Schnee, uns angenehm fröstelnd nach Hause treibt vor den Kamin mit seinen zischenden Baumstämmen – chez nous!
Es ist die letzte Nacht des alten Jahrs – la veille du jour de l’an.
Knöcheltief im Schnee, wandern wir ins warme, gut erhellte „Magna sed apta“, die mondbeschienene Straße hinauf. Es ist Traumschnee, und doch fühlen wir ihn unter unseren Füßen knirschen; aber wenn wir uns umdrehen und schauen, sind unsere Fußspuren verschwunden, und wir werfen keine Schatten, obgleich der Vollmond ist!
Monsieur le Major kommt vorbei, auch Yverdon, der Postbote, und Vater François mit seinen großen Holzschuhen und andere, und ihre Fußspuren bleiben – und ihre Schatten sind stark und scharf!
Sie entbieten einander die Grüße der Saison, wenn sie sich treffen und vorübergehen; uns wünschen sie nichts! Wir wünschen ihnen la bonne année mit lauter Stimme; sie beachten uns nicht im Geringsten, obgleich unsere Stimmen nicht weniger voll sind als ihre. Wir wünschen ihnen ein „frohes neues Jahr“, das zum Guten oder Bösen dämmerte vor fast zwanzig Jahren.
Heraus kommt Gogo von den Seraskiers, mit Mimsey. Er macht einen Schneeball und wirft ihn. Er fliegt mitten durch mich hindurch und zerplatzt auf Père François‘ breitem Rücken. „Ah, ce polisson de Monsieur Gogo … Attendez un peu!“ – (O, dieser Schlingel von einem Monsieur Gogo … Wartet ein bisschen!) und Père François erwidert das Kompliment – wieder mitten durch mich hindurch, wie es scheint; und ich fühle es nicht einmal! Mary und ich sind für einander so körperlich, wie Fleisch und Blut uns machen können. Wir können diese Traumleute nicht einmal berühren, ohne dass sie in dünner Luft zerfließen; wir können sie nur hören und sehen, das aber in Perfektion!
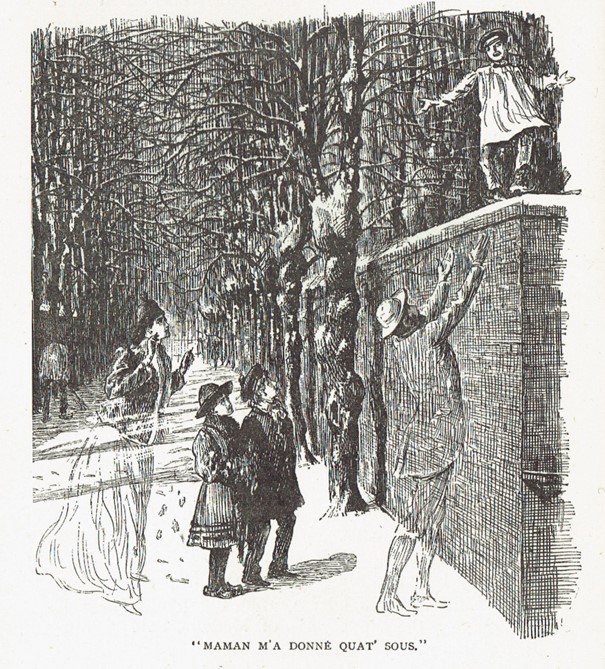
Da ist der kleine André Corbin, der Sohn des Geflügelhändlers, läuft oben auf Madame Pelés glitschiger Gartenmauer entlang, die fast zehn Fuß hoch ist.
„Himmel“, ruft Mary, „halt ihn auf! Erinnerst du dich nicht? Wenn er ans Ende kommt, wird er runterfallen und beide Beine brechen!“
Ich renne und brülle zu ihm hinauf:
„Descends donc, malheureux; tu vas te casser les deux jambes! Saute! Saute!“ … Ich schreie, öffne meine Arme. Er beachtet mich nicht im Geringsten; er erreicht das Ende, unten folgen ihm Gogo und Mimsey, die außer sich sind vor selbstloser, neidischer Bewunderung. Ermutigt von ihrem Beifall, wird er immer verwegener und möchte auch noch komisch sein, steht auf einem Bein und singt ein Lied, das so beginnt:
Maman m’a donné quat‘ sous
Pour m’en aller à la foire,
Non pas pas pour manger ni boire,
Mais pour m’régaler d’joujoux!
(Mama hat mir vier Sous gegeben,
Damit ich auf den Jahrmarkt gehen kann,
Nicht um zu essen und zu trinken,
Sondern um mich mit Spielzeug einzudecken!)
Dann rutscht er plötzlich herunter, der arme Kerl, bricht beide Beine unterm Knie an einer Eisenschiene und wird lebenslang ein Krüppel.
Diese ganze traurige kleine Tragödie eines Altjahrsabends spielt sich von neuem ab. Die mitfühlende Menge versammelt sich; Mimsey und Gogo weinen; die gebrochenen Eltern erscheinen, auch der gute kleine Doktor Larcher; und Mary und ich fühlen uns wie Verbrecher, so unfassbar scheint es, dass wir nicht alles verhindert haben!
Allein wir beiden leben und haben Substanz in dieser ganzen fremdartigen Welt von Schatten, die aber, soweit wir sehen und hören, nicht weniger substanziell und lebendig sind als wir. Sie existieren für uns; wir existieren nicht für sie. Wir existieren für einander, wachend oder schlafend; denn selbst die Menschen, unter denen wir unser Wachleben verbringen, wissen kaum mehr von uns und unserer wirklichen Existenz als der arme kleine André Corbin, der gerade erneut für uns seine Beine gebrochen hat!
So kehren wir zurück zu „Magna sed apta“, betrübt von diesem beklagenswerten Missgeschick, um über diese Wunder nachzusinnen, zu reden und zu staunen; durchdrungen bis auf den tiefsten Herzensgrund von der dunklen Ahnung einer überwältigenden, geheimnisvollen Macht, verborgen im Unterbewusstsein des Menschen – bisher unbekannt, ungeträumt, verknüpft sie ihn mit dem Unendlichen und Ewigen.
Und über wie Vieles hatten wir außerdem noch zu reden!
Der Himmel weiß, ich bin kein glänzender Unterhalter, aber sie war die am leichtesten amüsierbare Person der Welt – interessierte sich für alles, wofür ich mich interessierte, und ich entschädigte mich (disdamaged – einer ihrer Anglo-Gallizismen) für das beklommene Schweigen vieler Jahre.
Von ihr als Gefährtin mag ich nicht sprechen. Es wäre unverfroren, ja, aberwitzig, wenn eine Person in meiner Lage sich über die sozialen Fähigkeiten der berühmten Herzogin von Towers verbreiten würde.
So unglaublich es jedoch erscheinen mag, der größte Teil unseres Gesprächs betraf ganz allgemeine und alltägliche Themen – ihre Häuser und Zufluchten, die Schwierigkeiten ihrer Unternehmensführung, ihren ständigen Geldbedarf, ihre vielen Vorhaben und Pläne, ihre Experimente, Misserfolge und Enttäuschungen – an denen allen ich natürlich warmen Anteil nahm. Und dann mein Gefängnis und alles, was da geschah – und auch ich begann mich dafür zu interessieren, weil es sie so leidenschaftlich interessierte; sie kannte jeden seiner mir bekannten Winkel, jedes kleine Detail des Haftlebens – den Namen, das Aussehen und die Geschichte fast jedes Insassen, und kritisierte seine innere Struktur mit einem praktischen Geschäftssinn und einer unternehmerischen Klugheit, die ich nicht aufhören konnte zu bewundern.
Eine meiner lustigsten Erinnerungen betrifft einen Besuch, den sie mir dort im Fleisch abstattete, begleitet von einigen berühmten Philanthropen beiderlei Geschlechts. Ich wurde von ihnen als beispielhafter Häftling interviewt, der zwar unkonventionell war, aber doch zum Ansehen der Einrichtung beitrug. Sie lauschte ernsthaft meinen klugen Antworten, als ich nach meiner körperlichen Gesundheit usw. und auch gefragt wurde, ob ich über irgendetwas zu klagen hätte. Zu klagen! Nie war ein gefangener Vogel je so zufrieden mit seinem Nest – so gesund, so glücklich, so brav. Sie notierte sich alles.
Acht Stunden zuvor waren wir durch die Uffizien in Florenz gewandert; acht Stunden darauf würden wir einander in den Armen halten.
*****
Seltsam zu erzählen, dass dieses unser Glück – so tief, so intensiv, so jenseitig, so beispiellos in der ganzen Geschichte menschlicher Zärtlichkeit – dennoch nicht immer frei war von unvernünftigen Sehnsüchten und Reuegefühlen. Kein Mensch ist vom Glück so verwöhnt, dass er sich sein Glück nicht noch größer wünschen könnte.
Die Wirklichkeit unserer nahen Gefährtenschaft, unserer wahren Besessenheit voneinander (in der uns zugemessenen Zeit), war absolut, vollständig und uneingeschränkt. Kein Darby, der je lebte, kann jemals süßere, wärmere, zärtlichere Erinnerungen an irgendeine Joan gehabt haben, als ich sie jetzt habe an Mary Seraskier! (Darby und Joan, ideales Musterehepaar seit einem Gedicht des 17. Jahrhunderts von Henry Woodfall, vergleichbar mit Philemon und Baucis). Obgleich jeder in gewisser Weise nur eine scheinhafte Illusion im Gehirn des anderen war, war die Illusion für uns keine solche. Es war eine Illusion, die die Wahrheit zeigte, wie die Illusion des Sehens. Wie Zwillingskerne in einer Schale („Vielliebchen“ nannte Mary sie) berührten wir einander an vielen Stellen und waren einander näher als dem Rest der Menschheit (von der ein jeder seine eigene Schale hat). Wir untersuchten und testeten dies in jeder erdenklichen Weise, und fanden nie, dass wir uns irrten, und hörten auch nie auf, dies als ein großes Wunder zu bestaunen. Zum Beispiel empfing ich Briefe von ihr im Gefängnis (und beantwortete sie) in einer komplizierten Geheimschrift, die wir zusammen komplett in der Schlafenszeit ausgetüftelt und perfektioniert hatten, Briefe, die sich auf Dinge bezogen, die uns beiden, als wir zusammen waren, widerfuhren.[4]1
Wir hatten Privilegien, wie sie menschliche Wesen vor uns kaum je genossen haben können. Raum und Zeit waren für uns aufgehoben, wenn einer von uns es nur wünschte – wir lebten in einem Palast des Entzückens; alle vorstellbaren Luxusgüter gehörten uns, und, besser als alles und für immer, eine solche Frische, ein solches Hochgefühl, wie nur der Frühling des Lebens es kennt, und eine so starke Liebe zu einander (die mehr war als eine bloße Folge der Verhältnisse), dass die Zeit sie niemals auslöschen oder dämpfen konnte, bis der Tod kam und uns trennte. All dies und mehr war unser Anteil in den acht Stunden von allen vierundzwanzig.
Das Einzige, worüber wir uns manchmal ärgerten, war, war, dass die sechzehn verbleibenden Stunden uns nicht ebenfalls gehörten; dass wir zwei Drittel unseres Lebens getrennt verbringen mussten; dass wir die Mühen und Sorgen unseres normalen Alltags, unserer Wachzeit nicht ebenso mit einander teilen konnten wie den glückseligen Lohn unseres scheinbaren Schlafs – die Herrlichkeiten unseres gemeinsamen Träumens.
Und dann beklagten wir die verlorenen Jahre, die wir in wechselseitiger Unkenntnis und Trennung verbracht hatten – eine beklagenswerte Verschwendung von Leben; da doch das Leben, ob schlafend oder wachend, so kurz war.
Wie anders hätte alles verlaufen können, wenn wir von einander gewusst hätten!
Wir hätten einander nicht aus den Augen und aus dem Sinnverloren; wir wären zusammen aufgewachsen und hätten von allem Anfang an gelernt, gearbeitet und gekämpft – Junge und Mädchen, Bruder und Schwester, Liebende, Mann und Weib – und hätten unser gesegnetes Traumland dennoch gefunden und ebenso bewohnt.
Kinder wären uns geboren worden! Süße Kinder, beaux comme le jour, wie in den Märchen von Perrault; ebenso schön und gut wie ihre Mutter.
Als wir von diesen imaginären kleinen Wesen sprachen und versuchten, sie uns vorzustellen, spürten wir in uns eine so überwältigende Fähigkeit, sie zu lieben, dass wir einander weinend um den Hals fielen. Gerade als wären sie Teil meiner eigenen persönlichen Erfahrung, kannte ich die Leidenschaft und Zärtlichkeit, all die vergebliche Angst von Marys kurzer, vom Unglück verfolgter Mutterschaft: Das Leid meiner Eifersucht, dass sie einem anderen Mann ein Kind geboren hatte, war vergessen in diesem eindringlichen und intensiven Verstehen! Ach ja … Diese hungrige Liebe, dieses traurige Mitleid – wer es nicht kennt, hat kaum gelebt! Kinderlos, wie ich bin (obgleich alt genug, um ein Großvater zu sein), hab ich es doch alles im Herzen!
Niemals konnten wir auf einen eigenen Sohn, eine eigene Tochter hoffen. Die gesegnete Blume der Liebe in ihrer reichen, üppigen, unverwelklichen Blüte war unser; aber ihre gesegnete Lebensfrucht – niemals, niemals, niemals!
Unsere einzigen Kinder waren Mimsey und Gogo, zwischen ihnen und uns lag eine unpassierbare Kluft, sie wussten nichts davon, dass es uns gab, bis auf Mimseys seltsame Ahnung, dass eine Fee Tarapatapoum und ein Prinz Charming über sie und Gogo wachten.
All dies würde enden, wie es enden musste, nämlich damit, dass wir immer deutlicher erkannten, wie alles, was das Leben lebenswert machte, ja, undankbar wie wir waren, zu einem Himmel auf Erden für uns beide, auf unserer gegenseitigen Abhängigkeit beruhte; und wirklich mussten wir erkennen, dass allein so zu lieben und geliebt zu werden, (ohne all die anderen Segnungen) etwas so Gewaltiges war, dass wir nicht ohne Grund zitterten über unsere Kühnheit, noch mehr davon haben zu wollen.
*****
So eilten drei Jahre dahin, und auch die restliche Zeit wäre vielleicht so schnell vergangen, hätte es nicht einen Zwischenfall gegeben, der Epoche machte in unseren verknüpften Leben, indem er alle unsere Gedanken und Energien in eine neue Richtung lenkte.

Teil Sechs
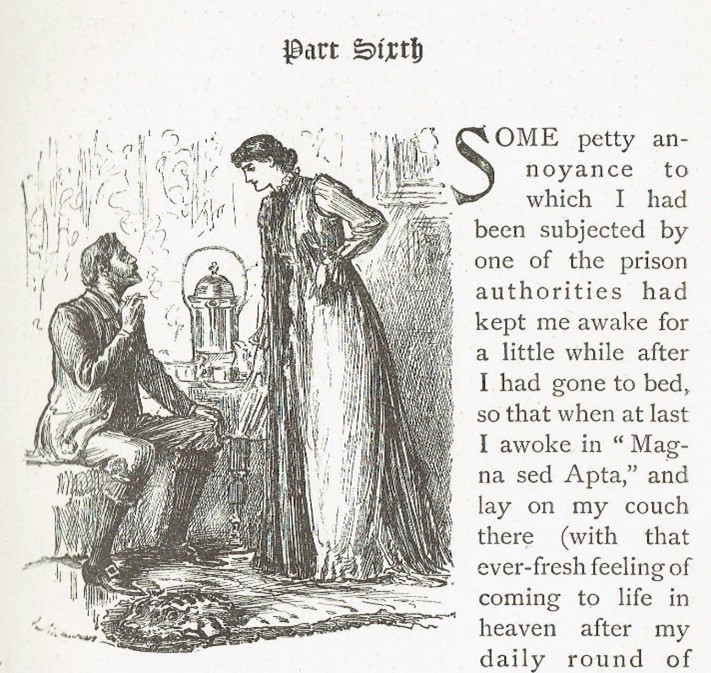
Irgendein geringfügiger Ärger über jemanden von der Gefängnisleitung hatte mich für einige Zeit wach gehalten, nachdem ich ins Bett gegangen war, so dass ich, als ich schließlich in „Magna sed apta“ erwachte, dort auf der Couch lag (mit dem immer neuen Gefühl, nach meiner täglichen Arbeitsrunde in einem irdischen Gefängnis nun im Himmel zu erwachen) und merkte: Mary war schon da und machte Kaffee, dessen Duft den Raum erfüllte, und während sie das tat, summte sie leise eine Melodie, eine alte, originelle aber sehr schöne Melodie, die mich mit unbeschreiblicher Aufregung erfüllte, denn ich hatte sie mit leiblichem Ohr nie zuvor gehört, und doch war sie mir so vertraut wie „God save the Queen“.
Als ich ihr mit verzückten Ohren und geschlossenen Augen lauschte, wanderten wundervolle Szenen an meinem geistigen Auge vorbei: Die schöne weißhaarige Dame meiner Kinderträume, die ein kleines Mädchen an der Hand hielt – und dieses Kind war ich; die Tauben und ihr Turm, der Fluss und die Wassermühle; der weißhaarige junge Mann mit roten Absätzen; eine sehr feine Dame, sehr groß, sehr stolz, in mittleren Jahren, herrlich gekleidet in Brokatseide; ein Park mit Rasenflächen, Allen und Bäumen, die zu Gestalten geschnitten waren; ein Schloss mit Türmen – alle Arten bezaubernder Szenen und Menschen eines anderen Zeitalters und Landes.
„Was um Himmelswillen ist das für eine wundervolle Melodie, Mary?“, rief ich aus, als sie fertig war.
„Es ist meine Lieblingsmelodie“, antwortete sie. „Ich summe sie selten aus Angst, dass ihr Zauber sich abnutzt. Deshalb hast du sie wahrscheinlich noch nie gehört. Ist sie nicht hübsch? Sie sollte mein Wecklied für dich sein.
Mein Großvater, der Geiger, pflegte sie mit eigenen Variationen zu spielen und machte sie zu ihrer Zeit berühmt; aber sie wurde nie gedruckt und ist heute vergessen.
Ihr Titel ist ‚Lied vom traurigen Tischgenossen‘, und wurde von seiner Großmutter komponiert, einer schönen Französin, die auch die Geige spielte; aber nicht als Beruf. Er erinnerte sich, diese Melodie von ihr als Kind gehört zu haben, als sie schon eine ganz alte Dame war, genau wie ich mich daran erinnere, sie von ihm gehört zu haben, als ich ein Mädchen in Wien und er schon ein weißhaariger alter Mann war. Ich glaube, sie hielt die Fidel auf ihr Knie aufgestützt, wenn sie spielte; und sie spielte immer in perfekter Stimmung, genau in der Mitte des Tons, und mit sehr viel Geschmack und Ausdruck; ihr Spiel machte ihn zum Geiger. Aber sie war wie „Single-speech Hamilton“ (William Gerald Hamilton, irischer Politiker des 18. Jahrhunderts, der nur eine einzige bedeutende Rede gehalten haben soll), denn es war das einzige Stück, das sie je komponierte. Sie komponierte es in großer Trauer und Erregung, kurz nachdem ihr Mann am Biss eines Wolfs gestorben war und kurz vor der Geburt ihrer Zwillingstöchter – ihrer einzigen Kinder – eins der beiden Mädchen war meine Urgroßmutter.“
„Und wie hieß diese wunderbare alte Dame?“
„Gatienne Aubéry; sie heiratete einen bretonischen Junker namens Bude, der ein gentilhomme verrier in St. Prest in Anjou war, d.h. er stellte Glas her – Karaffen, Wasserflaschen, Becher und all das, nehme ich an – trotz seines Adels. Es wurde nicht als standeswidrig angesehen, es war das einzige der noblesse erlaubte Handwerk, und man musste wenigstens ein Junker sein, um es auszuüben. Sie war eine sehr angesehene Frau, la belle Verrière, wie sie genannt wurde; und sie leitete die Glashütte viele Jahre nach dem Tod ihres Mannes und verdiente viel Geld für ihre beiden Töchter.“
„Wie seltsam!“, rief ich aus; „Gatienne Aubéry! Dame du Brail – Budes – die Namen sind mir total vertraut. Mathurin Budes, Seigneur de Monhoudéard et de Verney le Moustier.“
„Ja, das stimmt. Wie wunderbar, dass du es weißt! Eine Tochter, Jeanne, heiratete meinen Urgroßvater, einen Offizier der ungarischen Armee; und Seraskier, der Geiger, war ihr einziges Kind. Die andere (ihrer Schwester so ähnlich, dass nur die Mutter sie unterscheiden konnte), hieß Anne und heiratete einen Comte de Bois irgendwas.“
„Boismorinel. Unfassbar, all die Namen gibt es auch in meiner Familie. Mein Vater ließ mich ihre Wappen mit allen Viertelungen malen, als ich ein Kind war, am Sonntagmorgen, um mich ruhig zu stellen. Vielleicht sind wir blutsverwandt, du und ich!“
„O das wäre zu schön!“, sagte Mary. „Ich frage mich, wie wir es herausfinden können? Hast du keine Familiendokumente?“

Ich: „Es gab Massen davon in einem Schrankkoffer aus Rosshaar, aber ich weiß nicht, wo sie hingeraten sind. Was hätten Familiendokumente mir genützt? Ibbetson übernahm sie, als ich meinen Namen änderte. Ich nehme an, seine Anwälte haben sie.“
Sie: „Ich habe eine tolle Idee. Wir schaffen das ohne Anwälte. Lass uns herumgehen zu deiner alten Behausung, Gogo soll die geviertelten Wappen erneut für uns zeichnen, und wir schauen ihm über die Schulter.“
Wirklich eine tolle Idee! Wir tranken unseren Kaffee und gingen in mein altes Haus mit dem Wunsch (dem Vater der Tat), dass Gogo da sein möchte, erneut seiner längst vergessenen Befähigung hingegeben, Wappen zu zeichnen.
Es war ein schöner Sonntagmorgen, und wir fanden Gogo schwer beschäftigt an einem kleinen Tisch vor einem offenen Fenster. Der Boden war mit alten Urkunden, Pergamenten und Familienpapieren bedeckt; und le beau Pasquier war an einem anderen Tisch in seinen eigenen Stammbaum vertieft und schrieb Anmerkungen an den Rand – eine Beschäftigung, die er liebte – und unbewusst summte er dabei vor sich hin. Der sonnige Raum war erfüllt von dem durchdringenden weichen Klang seiner Stimme, wie ein Wintergarten erfüllt ist vom Duft seiner Blumen.
Was für eine Ungereimtheit, dass mein lieber Vater, im Herzen ein echter Republikaner (trotz all seiner eingebildeten Ergebenheit für die weiße Lilie der Bourbonen), ein bemühter Wissenschaftler, den ein kluger und fleißiger französischer Mechaniker weitaus mehr interessierte als ein Fürst (er hätte die Freundschaft und Gesellschaft des ersteren weitaus vorgezogen), dass dieser Mann zugleich auf diese alten Pergamente und obskuren geviertelten Wappen stolz war. Vielleicht wäre es mir genauso ergangen, wenn mein Leben anders verlaufen wäre – denn welcher wahre Demokrat, wie unleidlich ihm eine solche Schwäche auch bei anderen erscheint, nimmt seine eigenen Ansprüche auf vornehme Herkunft, so vage sie sein mögen, nicht doch sehr ernst?
Er liebte Sprichwörter und Aphorismen wie „noblesse oblige“, „bon sang ne sait mentir“, „bon chien chasse de race“ usw., und er hatte ein paar eigene Aphorismen geprägt, die ihn beruhigten, wenn er in Not war: „Bon Gentilhomme n’a jamais honte de la misère.“ All diese Sprüche, das sei der Gerechtigkeit halber angemerkt, reservierte er ausschließlich für den Hausgebrauch, und er wäre der erste gewesen, der gelacht hätte, wenn jemand anderes sie in den Mund genommen hätte.
Von seiner einen großen Begabung, dem Schatz in seiner Kehle, hielt er überhaupt gar nichts.
„Ce que c’est que de nous!“
Gogo kolorierte die geviertelten Familienwappen der Pasquiers – la maison de Pasquier, hieß es in einem gedruckten Werk (Armorial général du Maine et de l’Anjou), nach den unten auf der Seite gegebenen Instruktionen. Er benutzte eine von Madame Liards Drei-Sous-Schachteln, und die Farbtöne ließen viel zu wünschen übrig.
Wir sahen ihm über die Schulter und lasen den pittoresken alten Jargon, der sich im Französischen noch hübscher, angenehmer und verrückter anhört als im Englischen. Es klang so:
„Pasquier (branche des Seigneurs de la Marière et du Hirel), party de 4 pièces et coupé de 2.
Au premier, de Hérault, qui est écartelé de gueules et d’argent.
Au deux, de Budes, qui est d’or au pin de sinople.
Au trois, d’Aubéry – qui est d’azur à trois croissants d’argent.
Au quatre, de Busson, qui est d’argent au lyon de sable armé couronné et lampassé d’or.“ Und so weiter durch alle Viertelungen: Bigot, Epinay, Malestroit, Mathefelon. Und schließlich, „sur le tout, de Pasquier qui est d’or à trois lions d’azur, au franc quartier écartelé des royaumes de Castille et de Léon“.
[Pasquier (Zweig der Herren von de la Marière und von Hirel), Wappen zu 4 Teilen und längsgeteilt in 2. Zuerst von Hérault, das geviertelt ist in Rot und Silber. Dann von Budes, golden mit einer grünen Pinie. Drittens von Aubéry, blau mit drei silbernen Sicheln. Viertens von Busson, silbern mit schwarzem gekröntem Löwen und roter Zunge … Über allem das von Pasquier, golden mit drei blauen Löwen, das freie Viertel geteilt in die Königreiche von Kastilien und Léon.] (Übersetzt mit Hilfe des glossaire héraldique unter http://leherautdarmes.chez.com/)
Kurz darauf kam meine Mutter von der englischen Kirche in der Rue Marbœuf nach Hause, wo sie mit Sarah, unserem englischen Mädchen, gewesen war. Es wurde zum Essen gerufen, und wir blieben mit den Familienpapieren allein. Mit unendlicher Vorsicht – um den Traum nicht zu trüben – konnten wir finden, was wir finden wollten – insbesondere, dass wir die Urgroßenkel und einzigen lebenden Nachkommen von Gatienne waren, der blonden Glasmacherin und Komponistin des „Lieds vom traurigen Tischgenossen“.
Der Stammbaum verläuft so:
Jean Aubéry, Herr von Brail, heiratete Anne Busson. Seine Tochter, Gatienne Aubéry, Herrin von Brail, heiratete Mathurin Budes, Herrn von Verny le Moustier und von Monhoudéard.
| Anne Budes, Herrin von Verny le Moustier, heiratete Guy Hérault, Grafen von Boismorinel. | Jeanne Budes, Herrin von Brail und von Monhoudéard, heiratete Ulric Seraskier. |
| Jeanne Françoise Hérault de Boismorinel heiratete François Pasquier de la Marière. | Otto Seraskier, Violinist, heiratete Teresa Pulci. |
| Jean Pasquier de la Marière heiratete Catharine Ibbetson-Biddulph. | Johann Seraskier, M.D., heiratete Laura Desmond. |
| Pierre Pasquier de la Marière (alias Peter Ibbetson, Häftling). | Mary Seraskier, Herzogin von Towers. |
Voller Freude kehrten wir in “Magna sed apta” zurück und feierten unsere frischentdeckte Verwandtschaft mit einer schlichten Mahlzeit aus meinem damaligen Repertoire. Sie bestand aus Austern von Rules in der Maiden Lane für einen Sixpence das Dutzend sowie Dunkelbier in Flaschen (l’eau m’en vient à la bouche); und wir verbrachten den Rest der uns in dieser Nacht zugemessenen Stunden damit, indem wir nach bestem Vermögen aus der alten Melodie des „Lieds vom traurigen Tischgenossen“ mit wechselndem Erfolg Visionen entwickelten; sie summte es und begleitete sich auf ihre professionelle Art mit einer Hand auf dem Klavier, und meine mit ihrer anderen haltend, sah sie alles, was ich sah.
In langsamer Abstufung wurden die heraufgerufenen Szenen und Menschen weniger verschwommen, und wann auch immer die glänzende und bedeutende Dame erschien, in der wir alsbald mit Gewissheit Gatienne, unsere gemeinsame Ururgroßmutter erkannten, „la belle verrière de Verny le Moustier“ – war sie deutlicher als die anderen, sicherlich deshalb, weil wir mit einem wesentlichen Bestandteil teilhatten an ihrer Individualität, und auch, weil diese so stark ausgeprägt war.

Und noch bevor ich von der gnadenlosen Uhr weggerufen wurde, sahen wir sie zu unserer großen Befriedigung die Fiedel spielen für eine schattenhafte Gesellschaft von zusammengeflickten, gepuderten und perückenbewehrten Damen und Herren, die sich an ihrem Spiel und auch daran wohlwollend zu ergötzen schienen, den feinen, unirdischen Tönen der so originellen und herrlichen Melodie „Le chant du triste commensal“ zu lauschen, unhörbar auf dem Spinett begleitet von ihrer Tochter, offenbar Anne Hérault, Gräfin von Boismorinel, geborene Budes, während die kleine Jeanne de Boismorinel (später Dame Pasquier de la Marière) träumerisch hingerissen zuhörte.
Und genau, wie Mary gesagt hatte, spielte sie die Fiedel mit senkrecht auf ihren Knien ruhendem Resonanzkörper, als wäre sie ein verkleinertes Cello. Ich erinnerte mich undeutlich, als kleines Kind von einer solchen Gestalt geträumt zu haben.
Binnen vierundzwanzig Stunden nach diesem seltsamen Abenteuer war die praktische und geschäftstüchtige Mary leiblich und mit ihrem Mädchen in den Teil von Frankreich aufgebrochen, in dem diese meine Vorfahren einst gelebt hatten, und binnen vierzehn Tagen hatte sie sich zur Herrin meiner gesamten französischen Familiengeschichte aufgeschwungen und all die verschiedenen Wohnsitze meiner Verwandtschaft aufgesucht, als gäbe es sie noch.
Das turmreiche Schloss meiner kindlichen Träume mit der benachbarten Glashütte, das immer noch Verny le Moustier hieß, war einer von ihnen. Er befand sich im Besitz eines gewissen Grafen Hector du Chamorin, dessen Großvater ihn zu Beginn des Jahrhunderts gekauft hatte.
Er hatte eine völlig neue Fabrik gebaut und aus ihr eine der ersten Glashütten Westfrankreichs gemacht. Aber der alte turmreiche Wohnkörper hatte überdauert, sein Hüttenmeister lebte darin mit Frau und Familie. Der Taubenturm hingegen war abgerissen worden, um Platz für den Schuppen einer Dampfmaschine zu schaffen, die Ansicht des Ortes war von Grund auf umgestaltet; aber der Fluss und die Wassermühle (diese nur noch eine pittoreske Ruine) waren noch da; der Fluss jedoch war kaum mehr als ein Flüsschen, einige zehn Fuß tief und zwanzig Fuß breit, gesäumt von knorrigen krummen Weiden und Erlen, viele von ihnen tot.
Er hieß „Le Brail“, war dreißig Meilen von dort (und vor vielen Jahrhunderten) entsprungen und hatte dem Besitz meiner Ururgroßmutter seinen Namen gegeben. Aber das alte Château du Brail, das Stammhaus der Aubérys, war ein Bauernhof geworden.
Das Château de la Marière in seinem von Mauern umgebenen Park und mit seinem schönen, schlanken, sechseckigen Turm von 1550, meilenweit rundum sichtbar, war jetzt eine blühende Apfelwein-Mosterei und ist es noch, sie liegt an der Heerstraße von Angers nach Le Mans.
Der alte Forst von Boismorinel, der einmal der Familie Hérault gehört hatte, existierte noch; Holzkohle erzeugende Köhler fanden sich in seinen Tiefen und ein oder zwei vereinzelte Rehböcke, aber keine Wölfe und Wildeber mehr wie in alten Zeiten. Und wo das alte Schloss gewesen war, stand jetzt der neue Bahnhof von Boismorinel und Saint Maixent.
Die meisten Budes, Bussons, Héraults, Aubérys und Pasquiers, die sich noch im Land befanden, waren wahrscheinlich entfernte Verwandte von Mary und mir: Rechtsanwälte, Ärzte oder Priester, oder sie waren Kaufleute und respektabel, aber uninteressant geworden; so wie sie waren, hätten sie kaum Wert darauf gelegt, mit jemandem wie mir verwandt zu sein.
Aber vor hundert und mehr Jahren waren diese Namen in Maine und Anjou von einiger Bedeutung. Ihre Träger stammten zum größten Teil aus den jüngeren Zweigen von Familien, die sich im Mittelalter mit dem Besten, was es in Frankreich gab, versippt hatten, und auch wenn der Hofadel von Versailles auf sie wie auf alle Provinzadligen herabblickte, hielten sie sich gut auf ihrer eigenen Scholle; sie feierten, jagten und schossen mit einander; tanzen, fiedelten, machten Liebe und heirateten unter einander; bliesen Glas und wurden reicher und reicher, bis die Revolution kam und sie und ihr Glas in die Luft pustete – und mit ihnen viele, die größer, aber nur selten besser waren als sie; und alle Erinnerung an diese netten und freundlichen Menschen und ihre Taten ist verloren und kann nur im Traum heraufgeholt werden.
Verny le Moustier war nicht das uninteressanteste von diesen alten Herrenhäusern.
Es war vor dreihundert Jahren am Ort eines noch älteren Klosters (daher sein Name) errichtet worden. Die Mauerreste der alten Abtei waren und sind immer noch sichtbar im Hausgarten, bedeckt mit Aprikosen-, Pfirsich- und Birnbäumen, gesät oder gepflanzt von unserer gemeinsamen Vorfahrin, als sie eine Braut war.
Graf Hector erläuterte Mary mit dem größten Vergnügen die Geschichte des Ortes; er hatte selbst ein schönes neues Haus im Überrest des alten Parks gebaut, nur eine Viertelmeile vom alten Herrenhaus entfernt. Er zeigte ihr jeden Raum des letzteren; es gab noch alte Holztäfelungen, hübsch bemalt im Stil alter Zeiten; alte Dokumente und pergamentene Urkunden, Pachtverträge über Fischereirechte, Höfe und dergleichen, unterzeichnet von meinem Großvater Pasquier und meinem Urgroßvater Boismorinel sowie von unserer Ururgroßmutter und ihrem Ehemann, Mathurin Budes, dem Herrn von Verny le Moustier, wurden ihr vorgelegt; und die Erinnerung an Gatienne, la belle verrière (auch, wie es scheint, la reine de Hongrie genannt) lebte noch auf dem Land; und viele ältere Leute erinnerten sich mehr oder weniger genau an „Le chant du triste commensal“, der hundert Jahre zuvor in aller Munde war.
Sie war angeblich die größte und hübscheste Frau des ganzen Anjou gewesen, von bestimmender Willenskraft und sehr maskulinem Charakter, aber außerordentlich beliebt bei den Reichen wie bei den Armen; von unbezähmbarer Energie, und es gab keinen Teig, in dem sie nicht einen Finger hatte; aber immer mehr zum Nutzen anderer als zu ihrem eigenen – eine typische, alles lenkende französische Geschäftsfrau – und eine ausgezeichnete Musikerin darüber hinaus.
Das war unsere gemeinsame Vorfahrin, von der wir zweifellos unsere Liebe zur Musik, unsere seltsame, fast hysterische Empfänglichkeit für die Macht der Töne hatten; sie hatte die beiden geborenen Nachtigallen unserer Rasse hervorgebracht – den Geiger Seraskier und meinen Vater, den Sänger. Und so merkwürdig es ist, ihre Augenbrauen trafen sich wie meine auf der Nasenwurzel – und darunter strahlten die schwarz bewimperten, graublauen Mary-Augen, und es trat Sonnenfinsternis ein, wann immer ihre Besitzerin lachte oder lächelte!
Während dieser interessanten leiblichen Reise Marys trafen wir uns geistig wie gewöhnlich jede Nacht in „Magna sed apta“; und ich wurde in jedes ihrer Ereignisse einbezogen.
Wir saßen vor dem magischen Fenster und sahen zu unserer Unterhaltung bald die Glashütte von Verny le Moustier in ihrem heutigen Zustand, voller heutigem Leben, heutiger Farbe, heutigem Ton, Dampf und Gas, wie Mary sie wenige Stunden zuvor gesehen hatte; bald das alte Schloss, wie es vor hundert Jahren aussah; verschwommen und unklar, als sähen wir es mit kurzsichtigen Augen am Ende eines grauen, dunstigen Nachmittags im Spätherbst durch eine beschlagene Fensterscheibe, mit bewegten, aber stillen Schatten, die sich herumgeisterten – still, weil wir ihr Sprechen zuerst nicht hören konnten; es war zu leise für unsere sterblichen Ohren, sogar in diesem Traum innerhalb unseres Träumens! Nur Gatienne, die herrschende und befehlende Gatienne, war schwach zu vernehmen.

Dann gingen wir hin und mischten uns unter sie. Von einem Augenblick zum anderen befanden wir uns in der Mitte einer bezaubernd altmodischen Familiengruppe von Schatten: Gatienne mit ihren hübschen Zwillingstöchtern Jeanne und Anne, umgeben von Gärtnern, die junge Pfirsich- und Aprikosenbäume an die alten Stützpfeiler und Mauern binden, die von der Abtei von Verny le Moustier noch übrig geblieben sind – all dies vor mehr als hundert Jahren – während die bleiche Sonne eines längst vergangenen Mittags die schwächeren Schatten dieser schwachen Schatten auf den schattigen Gartenweg fallen lässt.
Dann, presto! Szenenwechsel wie bei einer Laterna magica, wir überspringen ein Jahrhundert – und siehe da!
Eine andere französische Familiengruppe, ebenso bezaubernd und am selben Ort, in der Kleidung von heute und in keiner Weise mehr schattenhaft oder stumm. Kleine Bäume sind groß geworden; große Bäume sind verschwunden und haben Platz industriellen Werkhallen und Maschinen Platz gemacht; aber die alten Abteimauern wurden respektiert, und der muntere, freundliche Vater, die hübsche Mutter und die lieblichen Töchter, alle pressen sie auf „la belle Duchesse Anglaise“ Pfirsiche und Aprikosen aus der Zucht ihrer Ururgroßmutter.
Denn die liebenswerte Familie der Chamorins hatte sich mit Mary in sehr kurzer Zeit angefreundet, ja, im Moment ihres ersten Sehens; und sie sollte ihre Freundlichkeit, Höflichkeit und Gastlichkeit nie vergessen; schon nach fünf Minuten fühlte sie sich bei ihnen, als hätte sie sie seit vielen Jahren gekannt.
Hier möchte ich auch anfügen, dass sie einige Monate später von Mademoiselle du Chamorin (mit einem lieben Brief) eben die Geige bekam, die einst der belle verrière gehört hatte; Graf Hector hatte sie im Besitz eines alten Bauern gefunden – des urenkels von Gatiennes Kutscher – und hatte sie gekauft, um sie als Neujahrgeschenk ihrer Nachfahrin, der Herzogin von Towers, zukommen lassen zu können.
Jetzt gehört sie mir, ach! Ich kann sie nicht spielen; aber es erfreut und beruhigt mich, wenn ich völlig wach bin, ein Instrument in Händen zu halten, das Mary und ich in unseren Träumen so oft gehört und gesehen hatten und das in alten Zeiten die Melodie, die einen so großen Einfluss auf unsere Leben genommen hat, zum Erklingen brachte. Sein Anblick, seine Form, seine Farbe, jeder Abdruck, jeder Fleck darauf waren uns vertraut, bevor wir sie mit leiblichem Auge sahen oder mit der fleischlichen Hand berührten. Es kam zu uns direkt aus der dämmrigen und fernen Vergangenheit, angekündigt vom Geist ihrer selbst!
*****

Zurück! Allmählich, durch Übung und die Konzentration unserer vereinten Willenskräfte gewannen die Gestalten aus alter Zeit Substanz und Farbe, und ihre Stimmen wurden hörbar; bis schließlich der Tag kam, an dem wir uns unter ihnen bewegen, sie hören und so genau sehen konnten wie unsere unmittelbaren Vorfahren und Vorgänger – wie Gogo und Mimsey, wie Monsieur le Major und die übrigen.
Das Kind, das an der Hand der weißhaarigen Dame ging (deren Haar nur gepudert war) und die Tauben fütterte, war meine Großmutter, Jeanne de Boismorinel (die François Pasquier de la Marière heiratete). Ihr Vater trug Schuhe mit roten Absätzen und unterstützte sie in ihrem Glauben, kleine Dreispitze aus buntem Glas fertigen zu können; immer wenn ich als Kind diesen herrlichen Traum hatte, war sie in mir aufgelebt.
Jetzt konnte ich sie nach Belieben heraufrufen; und mit ihr wurden viele begrabene Erinnerungen der Vergessenheit entrissen.
Unter anderen wundervollen Dingen hörte ich den Herrn mit den roten Absätzen (meinen Urgroßvater) schöne Lieder von Lully und anderen zum Spinett singen, das er bezaubernd spielte – eine seltene Fähigkeit in jenen Tagen. Und sieh an! Dies waren die Melodien, die oft unaufgefordert in meinem Bewusstsein erklungen waren – und ich war so töricht zu glauben, ich hätte sie als kleine eigene Impromptus selbst komponiert. Und siehe noch mal! Seine Stimme, dünn, hoch, nasal, aber sehr sympathisch und musikalisch war die nie verstummende kleine Stimme, die ohne Unterlass für mehr als ein halbes Jahrhundert in der vernachlässigten, schmucklosen Ecke meines Hirns erklungen war, wo all die Spinnweben sind.
Und diese Spinnweben?
Nun, ich tauchte während meiner täglichen Haftmühsal (die die Klarheit und Freiheit meines Geistes nicht schwächte, sondern stärkte) tief in mein inneres Wachbewusstsein ein, und es wurde mir klar, dass ich voll, ja, vollgestopft war mit zarten flüchtigen Erinnerungen, die weder aus meinem Wachleben noch aus meinem Traumleben mit Mary stammten: Erinnerungen von Tiefträumen im Schlaf, die meiner Kindheit und frühen Jugend entstammten; Tiefträume, die zweifellos vergessen waren, wenn ich erwachte, denn dann konnte ich mich nur an die oberflächlichen Träume erinnern, die meinem Erwachen unmittelbar vorausgegangen waren.
Teiche, Flüsse, Brücken, Straßen und Ströme, Alleen, Lauben, Wind- und Wassermühlen, Korridore und Räume, kirchliche Feiern, dörfliche Jahrmärkte, Festlichkeiten, Männer, Frauen und Tiere, alle aus einer anderen Zeit und einem anderen Land, in das ich nie meinen Fuß gesetzt hatte – all das war meiner Erinnerung eingeschrieben. Ich musste nur tief genug in mich selbst hinabtauchen, und da fand ich es; und wenn Nacht und Schlaf kamen und „Magna sed apta“, konnte ich alles erneut heraufrufen und wirklich und greifbar machen für Mary und mich selbst.
Dass es sich bei diesen subtilen Erinnerungen wirklich um vorgeburtliche Eindrücke handelte, wurde bald bewiesen durch meine Ausflüge in die Vergangenheit mit Mary; und ihre Erfahrung mit solchen Erinnerungen und ihrer Bekräftigung waren dieselben wie bei mir. Wir haben gehört und gesehen, wie ihr Großvater den „Chant du triste commensal“ vor einem dicht gefüllten Konzertsaal spielte – und längst tote und begrabene und vergessene Menschen klatschten ihm widerhallenden Beifall!
Heute glaube ich, dass solche Erinnerungen ein Teil des Unterbewusstseins nicht nur von Mary und mir, sondern von allen sind und dass viele, wenn sie nur ausdauernd genug in sich selber suchen erfolgreich Zugang zu ihnen finden – vielleicht sogar leichter und vollständiger, als es uns gelang.
Es ähnelt dem Lauschen auf die Obertöne einer musikalischen Note; zuerst hören wir sie nicht, obgleich sie da sind und darum betteln, bemerkt zu werden; und wenn wir sie schließlich hören, wundern wir uns über unsere frühere Stumpfheit, so deutlich sind sie.
Lass einen Mann mit normalem Gehör, wie ungeübt auch immer, das tiefe C auf einem guten Klavier anschlagen und dabei das Forte-Pedal treten. Zuerst wird er allein die reiche Basisnote C hören.
Aber machen wir ihn aufmerksam auf bestimmte andere Noten; z.B. auf das C eine Oktave höher, dann das G direkt darüber, dann das E noch ein wenig höher; er wird sie alle zugleich ebenso klar vernehmen wie die ursprünglich angeschlagene Note; und schließlich wird ein schrilles, leises, geisterhaftes und recht lästiges zweigestrichenes B so unüberhörbar an sein Ohr dringen, dass er es hinfort immer hören wird, sooft ein tiefes C angeschlagen wird.
Aber in genauso einem Prozess, nur mit sehr viel mehr Qualen (und am Ende mit welchem Genuss, welcher Überraschung) wird ihm im Laufe der Zeit eine schemenhafte, verborgene, vorgeburtliche Erfahrung bewusst werden, die unter seiner eigenen persönlichen Lebenserfahrung liegt.
Wir fanden auch heraus, dass wir solchen Vergangenheitsszenen nicht nur als bloße Zuschauer beiwohnen, sondern gelegentlich mit den handelnden Personen verschmelzen und für den Augenblick aufhören konnten, Mary Seraskier und Peter Ibbetson zu sein. Besonders mit Gatienne war dies der Fall. Wir konnten beide für eine gewisse Zeit Gatienne sein (wenn auch niemals beide gleichzeitig), und wenn wir unsere eigene Persönlichkeit wieder annahmen, nahmen wir ein Stückchen der ihren mit – ein seltsames Phänomen, wie der Leser sich vorstellen kann, da es den Keim einer vergleichsweisen persönlichen Unsterblichkeit auf Erden enthält.
Bei meiner Arbeit im Gefängnis konnte ich mich genau daran erinnern, dass ich Gatienne gewesen war. Sodass Gatienne, eine französische Provinzbewohnerin, die vor hundert Jahren lebte, in der Zeit, in der ich sie war, klaglos eine Zuchthausstrafe in einem englischen Gefängnis der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts absaß.
Ein fragwürdiges Privileg, vielleicht.
Aber wenn sie nicht in mir lebte, konnte sie zum Ausgleich in Mary zum Leben erwachen (offenbar immer nur in einem von uns beiden zur Zeit), konnte Eisenbahn und Dampfer fahren, den Gebrauch von Gas und Elektrizität kennen und die telegrafierten Nachrichten „unserer Sonderkorrespondenten“ in der Times lesen, und so das 19. Jahrhundert unter angenehmeren Bedingungen kennenlernen.
So übernahmen wir la belle verrière im Wechsel, und sie sah und hörte Dinge, von denen sie sich vor hundert Jahren nicht hatte träumen lassen. Außerdem konnte auch sie die Vorzüge von „Magna sed apta“ genießen.
Und je besser wir sie kennenlernten, desto mehr liebten wir sie; es war schön, von einer so netten Person abzustammen, und Mary und ich waren uns einig, dass wir keine bessere Ururgroßmutter hätten aussuchen können und fragten uns, wie wohl die sieben anderen wären, denn wir hatten im Ganzen fünfzehn von ihnen zwischen uns und ebenso viele Ururgroßväter.
Dreißig Ururgroßväter und Ururgroßmütter hatten uns zu dem gemacht, was wir waren; es hatte keinen Sinn, gegen sie und die Millionen zu kämpfen, die hinter ihnen standen. Welcher von ihnen allen, stark aber edel und scheu, hasste den bloßen Anblick von Blut – und sah doch Rot, wenn er gereizt wurde, und dürstete nach dem Blut seines Feinds?
Welche von ihnen allen, leidenschaftlich und zartfühlend, aber stolz, hochsinnig und keusch, der die Welt zu Füßen lag, war imstande, „ihren Hut über die Windmühlen zu werfen“ [Anspielung auf Don Quixote] und, für die Welt verloren, alles der Liebe zu opfern?
*****
Wir waren uns sicher genug, dass wir uns auf diese Weise nur leichter und gründlicher mit unseren eigenen unmittelbaren Vorfahren identifiziert hatten. Aber nach reiflicher Überlegung beschlossen wir (aus heiligen Gründen der Diskretion, die der Leser billigen wird), von allen weiteren Versuchen solcher Identitätsübertragungen Abstand zu nehmen
Aber dass dies eines Tages geschehen wird (wo der Weg nun gebahnt ist) und dass die Misslichkeiten und möglichen Missbräuche einer solchen Möglichkeit durch die immer wache menschliche Erfindungsgabe vermieden oder minimalisiert werden können, ist für mich so gut wie entschieden.
Es ist eine zu wertvolle Möglichkeit, als dass man sie in der Schwebe lassen könnte, und ich überlasse die wahrscheinlichen und möglichen Konsequenzen ihrer Nutzung der Vorstellungskraft des Lesers – und weise ihn nur darauf hin (als Einführung in die Nutzung dieser Möglichkeit in ihm selbst), dass uns auf dem dornigen Weg zu Glück und Tugend nichts mehr beglücken kann als die Gewissheit, dass die, die nach uns kommen, sich erinnern, dass sie, und wenn auch nur träumend, wir waren – so wie das frisch geschlüpfte Küken sich bereits in seinem Ei an den Gebrauch der Augen und der Ohren und den ganzen Rest aus der Fülle seiner vorgeburtlichen Erfahrung erinnert; und, glücklicher in dieser Hinsicht als das hilflose menschliche Kind kann es sofort in die Tätigkeiten und die Freuden seines kurzen verantwortungslosen Lebens aufbrechen!
*****
Weshalb es sich für dich, o Leser (nicht um derer, die nach dir kommen, sondern um deinetwillen) schickt, wenn du geistig und körperlich gesund bist, voranzuschreiten und dich aufs Äußerste zu vervielfachen, früh zu heiraten und viele und oft, und die besten des anderen Geschlechts deiner Art auszuwählen für diesen höchst wertvollen, hervorragenden und gesegneten Zweck; damit all deine (und ihre) künftigen Reinkarnationen, wie kurz sie auch immer ausfallen, zahlreich sein mögen; und dir nicht nur Freude, Frieden und vergnügliches Staunen und Erholung bringen, sondern auch den unschätzbaren Lohn wohlverdienter Selbstbestätigung!
Denn wer immer sich daran erinnert, dass er einmal du war, der weckt dich für den Moment aus dem – sollen wir es so nennen? – Nirwana. Seine Kraft, seine Schönheit, sein Witz gehören dir, und das Glück, das sie ihm in seinem Erdenleben schenken, kann von dir geteilt werden, wann immer die subtile Erinnerung an dich in sein Bewusstsein dringt; und du kannst nie wieder völlig im Nirwana versinken, solange auch nur noch einer deiner künftigen Erwecker lebt!
Das ist wie ein kleines altmodisches französisches Spiel, das wir in Passy zu spielen pflegten und das gut zu einem dunklen, regnerischen Nachmittag passt: Die Teilnehmer sitzen im Kreis, und jeder gibt dem Nachbarn einen gerade ausgeblasenen Span, ein gerade erloschenes Schwefelhölzchen, in dem aber noch ein kleiner Lebensfunke nachglüht, und sagt, wenn er das tut:
„Petit bonhomme vit encore!“
(Der kleine Kerl lebt noch.)
Und derjenige, in dessen Hand der Funke erlischt, muss Strafe zahlen und scheidet aus:
„Hélas! Petit bonhomme n’est plus! …
Pauv‘ petit bonhomme!“
(O weh! der kleine Kerl ist nicht mehr!
Armer kleiner Kerl!)
Gerade so kann ein kleiner Lebensfunke deines eigenen individuellen Bewusstseins, wenn die volle, flüchtige Flamme deines gegenwärtigen Lebens hienieden erloschen ist, sanft glühend an deine fernste Nachkommenschaft weitergegeben werden. Möge sie nie ganz erlöschen – sie braucht es nicht! Mögest du immer von Generation zu Generation sagen dürfen „Petit bonhomme vit encore!“ und wenigstens einen Finger im vergnüglichen Erdenkuchen behalten!
Und, Leser, bemühe dich, dein Erdenleben so zu gestalten, dass die Erinnerung an dich (wie die an Gatienne, la belle Verrière de Verny le Moustier) süß dufte und blühe im Staub – als eine Erinnerung, die man gerne heraufruft – damit seine Aufrufe und ihre Aufrufer so zahlreich seien, wie Kindesliebe und Vorfahrenstolz sie machen können …
Und o! wenn du zurückblickst, wie wir es taten, sei gnädig mit den Verfehlungen deiner Vorfahren, die, als sie lebten, kaum geahnt haben dürften, dass die Geheimnisse ihrer längst begrabenen Herzen sich dir eines Tages enthüllen würden! Ihre Verfehlungen sind in Wahrheit deine eigenen wie gleichsam die Verfehlungen deiner unschuldigen, unwissenden Kindheit, als du es nicht besser wusstest wie jetzt; oder bald wissen wirst dank
„Le chant du triste commensal!“
*****
Deshalb also, nehmt euch in Acht und seid beizeiten gewarnt, ihr zehnten Fortpflanzer eines schwachsinnigen Gesichts, ihr unbesonnenen Erzeuger kranker oder mickriger Körper mit vergleichbaren Herzen und Hirnen! Weit hinab durch die Korridore der Zeit wird klumpfüßige Vergeltung euren Fußtapfen folgen und euch an jeder Wegbiegung einholen! Erbarmungslos und rachsüchtig werdet ihr wachgerüttelt werden zu schlaflosen Stunden unerträglichen Elends (den Alpträumen künftigen Wachens), aus eurem falschen, unguten Todestraum; um teilzuhaben an einem Erbe des Leids noch schlimmer als eures; schlimmer durch all den in langen Jahren und Jahrhunderten aufgelaufenen Zins schändlicher Genusssucht und vergiftet durch den Stachel von Selbstvorwürfen, die erst aufhören werden, wenn der letzte eurer verdorbenen Nachkommenschaft ausstirbt und sein und euer verdientes Nirwana in den dunklen, vergessenen Tiefen des interstellaren Raums findet!
*****
Und hier möchte ich aufs Gewissenhafteste versichern, dass ich im klaren Bewusstsein der Feierlichkeit eines solchen Appells und der schweren Verantwortung, die ich mit seiner Abfassung auf mich nehme; noch mehr aber, damit dich, o Leser, die volle Bedeutsamkeit dieser apokalyptischen und irgendwie bedrohlichen Äußerung beeindrucke (und dein tieferes Gefühl in mitternächtlichen Stunden der Einkehr heimsuche), dass ich also mein Bestes gegeben habe, mein wirklich Allerbestes, um sie, diese Äußerung, in der dunkelsten und unverständlichsten Ausdrucksweise zu formulieren, die ich irgend ersinnen konnte. Sollte mir das misslungen sein, sollte unabsichtlich irgendeinen Teil des von mir Angedeuteten klar geworden, sollte ich irrtümlicher Weise in etwas abgekommen sein, was wie Sinn erscheinen könnte – und sei es bloßer Gemeinsinn – so liegt der Fehler bei meiner halb französischen und sehr unvollkommenen Erziehung. Ich bin eben nur ein armseliger Schreiberling!
*****
So habe ich einen ungefähren Überblick über das Wichtigste unserer vereinten Entdeckungen in der seltsamen neuen Welt zu geben versucht, die uns der Zufall enthüllte. Mehr als zwanzig Jahre unserer vereinten Leben haben wir der Verfolgung dieser zarten Spur gewidmet – mit welch überraschenden Resultaten wird sich sicherlich in weiteren Bänden zeigen.
Wir hatten nicht die Zeit, unsere englische Herkunft ebenso zu enthüllen – die Crays und die Desmonds, die Ibbetsons und Biddulphs usw. – die uns mit der Geschichte Englands verbinden. Je tiefer wir in die französische Vergangenheit vordrangen, desto fesselnder und verständlicher wurde sie, und es wurde uns immer schwerer, sie zu verlassen.
Was für eine beispiellose Erfahrung haben wir gemacht! Zu bedenken, dass wir Napoleon Bonaparte höchstpersönlich gesehen, wirklich gesehen haben – de nos propres yeux vu – ihn, den Erzherrn der Welt auf dem Höhepunkt seines Stolzes und seiner Macht; mit seinem kleinen Dreispitz, dem grauen zweireihigen Mantel, auf seinem weißen Schlachtross, umgeben von seinem Stab, wie er so oft gemalt wurde! Sicherlich die eindrucksvollste, unvergesslichste, unauslöschlichste kleine Gestalt der gesamten jüngeren Geschichte, und gekleidet in den am schlausten erdachten Aufzug, den je ein Bühnenkostümier entwarf, um das Auge des Publikums zu fesseln und seine Erinnerung für alle noch kommenden Zeiten heimzusuchen.
Es ist ein einzigartig neues, pikantes und erregendes Gefühl, persönlich und wie gegenwärtig vergangene Wirklichkeiten anzuschauen und zugleich Vergangenes voraussehen und Künftiges erinnern zu können!
Zu denken, dass wir ihn sogar gesehen haben, bevor er Erster Konsul wurde – schlank und bleich, das strähnige Haar schlenkert ihm in Nacken und Wangen, noch eindrucksvoller, wenn das möglich ist! Unschuldig wie ein Kind an allem, was noch vor ihm lag! Europa zu seinen Füßen – der Thron – Waterloo – St. Helena – der Iron English Duke (Wellington?) – so schnell vom Gipfel zum Pranger!
„O corse, à cheveux plats, que la France était belle
Au grand soleil de Messidor!”
(O Korse mit glattem Haar, wie schön war Frankreich
unter der großen Sonne des Messidor!
Auguste Barbier: L’idole)
*****
Mirabeau, Robespierre, Danton, Marat und Charlotte Corday! Auch sie haben wir gesehen; Marie Antoinette und die Fischweiber und „den schönen Kopf der Lamballe“ (auf der Pike!) … Haben die Karren über die Place du Carrousel fahren sehen und die Guillotine bei Mondschein angeschaut – still und schreckensstarr, das Herz schlug uns bis zum Halse …
Und mitten in dem allen stahlen sich lächerliche vereinzelte Erinnerungen an Madame Tussaud in unseren grässlichen Traum von Blut und Vergeltung, vermischten Vergangenes, Gegenwärtiges und Künftiges auf unbeschreibliche Art und Weise und machten uns Lachen unter Tränen!
Dann waren wir (einige Male!) bei der Einnahme der Bastille dabei und wurden Zeugen der meisten stürmischen Szenen jenes stürmischen Zeitalters, mit unserem Carlyle (Thomas Carlyle: The French Revolution 1837) in Händen; und wie oft haben wir gedacht und mussten herzlich darüber lachen, welchen Spaß es machen muss, unsterbliche Geschichtsbücher zu schreiben ohne einen einzigen Augenzeugen, der dir widersprechen könnte!
Und noch weiter zurückgehend, haben wir Versailles in seinen Glanzzeiten heimgesucht und uns sattgetrunken an all den Herrlichkeiten des Hofes von Ludwig XIV.!
Was für imposante Zeremonien, was für erstaunliche Festlichkeiten haben wir besucht, wo all die Schönheit, all der Geist, der ganze Adel Frankreichs, hingestreckt in ehrfürchtiger Scheu (als wäre ein Gott gegenwärtig) loyal dem größten Monarchen huldigte, den diese Welt je gesehen hat, während wir auf den Stufen seines Thrones saßen, als er seine königlichen Tagebefehle erteilte! und laut lachten unter der Nase dieses seichten, albernen, pompösen Snobs und ihn gern an ihr gezogen und versucht hätten, seine fettige, nach Zibetkater riechende üppige Perücke mit den heilsamen Düften eines Ornats aus dem 19. Jahrhunderts zu desinfizieren!
Nichts aus dieser närrischen und fesselnden Zeit entging uns. Stadt, Weiler, Fluss, Wald und Feld; königlicher Palast, fürstliches Schloss und die Kate des verhungernden Bauern; Pult, Bühne und Salon; Hafen, Heerlager und Marktplatz; Gericht und Universität; Fabrik, Laden, Studio, Schmiede; Kneipe, Spielhölle und Diebeshöhle; Kloster und Gefängnis, Folterkeller und Galgenberg, und was nicht sonst noch!
Und bei jeder folgenden Stufe schwollen unsere einstmals so verzagten, überängstlichen und überbürdeten heutigen Herzen vor Freude, Stolz und Hoffnung ob des Triumphs unserer Gegenwart auf der ganzen Linie! Jawohl, und das, obgleich wir den berühmten Bossuet predigen hörten, Molière in einem seiner eigenen Stücke Beifall klatschten und Racine, Corneille, Boileau, Fénélon und den guten Lafontaine hörten und sahen (und ihnen beinahe vergaben), diesen fünf mitleidlosen Quälgeistern unserer eigenen unschuldigen französischen Kindheit!
Und den Zeitstrom noch weiter hinaufschwimmend, haben wir geplaudert mit Montaigne und Rabelais, fühlten uns persönlich gelangweilt von Malherbe (François de Malherbe, franz. Dichter des Frühbarocks), saßen Ronsart zu Füßen, ritten Seite an Seite mit Froissart und sumpften mit François Villon – in was für entzückenden Sümpfen! …
François Villon! Gedenkt seiner, ihr stolzen britischen Sänger und Sängerlein von heute – ihr Möchtegernübersetzer und –nachahmer der unübersetzbaren, unnachahmlichen Klage, der unsterblichen Ballade des dames du temps jadis!
Und wo ich schon davon spreche, kann ich auch gleich noch erwähnen, dass wir auch sie – oder einige von ihnen – gesehen haben, diese schönen Damen, die er nie gesehen hat, weil sie schon weggeschmolzen waren, als er erschien, wie der Schnee des Vorjahrs – les neiges d’antan! (der Schnee von einst) Bertha mit den großen Füßen; Johanna von Orléans, die gute Lothringerin (was würde sie heute von ihrem Geburtsland denken?); die hochgelehrte Héloïse, für deren Liebe Peter Esbaillart oder Abaelard (ein noch unglücklicherer Peter sogar als ich!) so grausame Ungerechtigkeit von Mönchshänden erlitt; und die hochmütige, unartige Königin in ihrem Turm von Nesle,
„Qui commanda que Buridan
Fut jecté en ung sac en Seine …”
(die befahl, dass Buridan
in einem Sack in die Seine geworfen wurde …)
Ja, wir haben sie mit eigenen Augen gesehen, haben sie sprechen und singen hören, schimpfen und scherzen, lachen und weinen und sogar beten! Und ich habe sie gezeichnet, wie du eines Tages sehen wirst, lieber Leser! Und ich darf dir verraten, dass ihre Schönheit keinesfalls zum Wahnsinn reizte: der Standard weiblicher Lieblichkeit hat sich gehoben, sogar in Frankreich! Selbst la très sage Héloïse war ein solches Opfer kaum wert, wie – aber halt! Zähme die Ungeduld deines Herzens; all das, und es ist sehr viel, wird zu gegebener Zeit erscheinen, mit Beschreibungen und Illustrationen, auf die die Welt, schmeichle ich mir, nicht vorbereitet war und die sie wertschätzen wird wie noch keinen historischen Bericht zuvor!
Tag für Tag, für mehr als zwanzig Jahre, hat Mary ein umfangreiches Tagebuch geführt (in einer uns beiden geläufigen Geheimschrift); es ist jetzt in meinem Besitz, und in ihm ist jedes Detail unserer langen Reise in die Vergangenheit niedergelegt.
Gleichzeitig, Tag für Tag (in der Freizeit, die mir durch das Entgegenkommen von Direktor – bewilligt wurde) habe ich aus meinem Gedächtnis die Skizzen von Menschen und Orten nachgezeichnet, die ich während jener wundervollen Nächte in „Magna sed apta“ nach der Natur anzufertigen in der Lage war. Ich kann die Gewähr für ihre Richtigkeit und Wirklichkeitstreue übernehmen; auch wenn ihre Ausführung zweifellos viel zu wünschen übrig lässt.
Sie hat ihre Arbeit (für die künftige Veröffentlichung, in die diese Autobiografie nur einführen soll) mit ebenso großer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ausgeführt wie ich die meine; weder Zeit noch Mühe wurde gespart. Zum Beispiel hat uns allein die mörderische Bartholomäusnacht, die wir aus siebzehn verschiedenen Perspektiven studieren konnten, nicht weniger als zwei Monate unermüdlicher Arbeit gekostet.
Als wir im Strom der Zeit weiter und weiter zurück gelangten, wurde die Arbeit gewissermaßen leichter; aber wir mussten mehr verallgemeinern und aus Mangel an Zeit und Raum Typen statt Individuen benutzen. Denn mit jeder weiteren Generation vermehrte sich die Zahl unserer Vorfahren quadratisch (wie in der Aufgabe von den Nägeln im Hufeisen), bis eine Grenzmenge erreicht war – nämlich die Summe aller Bewohner der Erdkugel. Im siebten Jahrhundert gab es keine lebende Person in Frankreich (um von Europa zu schweigen), die keine unmittelbaren Vorfahren von uns waren, ausgenommen natürlich diejenigen, die ohne Leibeserben gestorben und somit bloße Seitenverwandte waren.

Wir konnten sogar, wenn auch dunkel wie in einem Glas die matten Schatten des Mammuts, des Höhlenbären und des Menschen sehen, der sie jagte, tötete und aß, um zu leben und sich durchzusetzen.
Das Mammut!
Wir sind um es herum und unter ihm hindurch gegangen, als es äste, und sogar durch es hindurch, als es lag und ruhte, wie man an einem stillen, nasskalten Morgen durch den falben Nebel in einer kleinen Bodensenke geht; als wir uns (in angemessener Entfernung) umdrehten und schauten, war die unverkennbare Gestalt wieder da, gerade deutlich genug, um die Linien der vagen, urweltlichen, dahinter liegenden Landschaft zu verdecken und ein Loch in den leeren Himmel zu zeichnen. Eine furchtbare Silhouette, die unsere Herzen mit Scheu erfüllte – verschwommen und undeutlich wie eine mehrfach belichtete Photographie – nur der Typus, wie er allgemein von allen gesehen wurde, die ihn je sahen, von denen jeder (exceptis excipiendis) notwendigerweise ein Vorfahr von uns und jedem heute lebenden Menschen war.
Da stand oder lag es, das Monstrum, wie das Phantom eines übergroßen behaarten Elefanten; wir konnten den Ausdruck seines trägen, kalten, vorsintflutlichen Auges sehen – oder uns einbilden, es zu sehen – und sogar einen Schimmer von Rotbraun in seinem Fell erkennen.
Mary glaubte fest daran, dass wir mit der Zeit auch zu unserem behaarten Vorfahren mit Spitzohr und Schwanz vordringen würden und herausfinden könnten ob er in seiner Lebensform ein Baumbewohner war oder nicht. Mit welch leidenschaftlichem Interesse wäre sie ihm gefolgt, hätte ihn studiert und beschrieben! Und ich erst! Mit wie eifriger Freude, und zugleich mit welch kindlicher Verehrung hätte ich sein Aussehen skizziert, mit welcher gewissenhaften Treue im Rahmen meiner beschränkten Möglichkeiten! (Denn nach allem, was wir an Gegenteiligem wissen, könnte er das reizvollste und bezauberndste kleine Tier gewesen sein, das es je gab und von dem abzustammen sehr viel weniger demütigend wäre als von so manchem adligen Radaubruder heutiger Zeit.)
Doch o weh, das Schicksal wollte es anders, und anderen gut Ausgebildeten fällt die herrliche Aufgabe zu, dem Hinweis zu folgen, den wir so glücklich waren zu entdecken.
*****
Nun ist es für mich an der Zeit, so kurz wie möglich die Geschichte meines Verlustes zu erzählen – eines so unermesslichen Verlustes, dass niemand, ob lebend oder tot, je einen vergleichbaren erlitten haben kann; und zu erklären, wie es kam, dass ich ihn nicht nur überlebte und bei Verstand blieb (woran manche Leute anscheinend zweifeln), sondern hier in aller Ruhe und Heiterkeit meine Erinnerungen niederschreibe, ganz als wäre ich ein berühmtes Mitglied der Akademie, ein Schauspieler, Romanautor, Staatsmann oder regelmäßig auswärts Essender – sanft geschwätzig und sehr zufrieden mit mir und der Welt.
Während der letzten Jahre unserer gemeinsamen Existenz waren Mary und ich von unserer spannenden Reise durch die Jahrhunderte so in Anspruch genommen, dass wir wenig oder nichts vom äußeren Leben des anderen mitbekommen hatten, genauer: ich hatte nichts von ihrem gesehen (denn sie begleitete mich manchmal in mein Gefängnis); ich sah sie nur, wenn sie sich entschied, in unserem Traum zu erscheinen.
Grundlage dafür mag auf ihrer Seite ein weiblicher Widerwille gewesen sein, als Alternde gesehen zu werden, denn in „Magna sed apta“ waren wir immer achtundzwanzig oder drum herum – und es ging uns bestens. Wir hatten wahrhaftig den Jungbrunnen entdeckt und hatten daraus getrunken! Und im Traum fühlten wir uns sogar noch jünger als wir aussahen; wir hatten die Spannkraft und Frische von Kindern.
Oft hatten wir über Tod und Trennung gesprochen und über das dahinter liegende Geheimnis, aber nur wie das Leute tun, für die das ein sehr fernliegender Eventualfall ist; aber in der Wirklichkeit verraste die Zeit für uns wie für andere, auch wenn wir das weniger fühlten.
Es kam der Tag, an dem Marys überschäumende Vitalität, so lange überschätzt, zusammenbrach, und sie wurde eine Zeit lang krank; aber das hielt uns nicht davon ab, uns wie immer zu treffen, und es gab an ihr keine merkliche Veränderung, wenn wir uns trafen. Aber ich bin sicher, dass sie in Wirklichkeit nie wieder dieselbe wie früher war, und die erschreckende Möglichkeit, dass wir uns eines Tages trennen müssten, tauchte in unseren Gesprächen häufiger, in unseren Herzen zu oft auf, und unsere Herzen waren eins.
Sie wusste: Wenn ich zuerst stürbe, würde alles verschwinden, was ich in „Magna sed apta“ eingebracht hatte (es war wenig genug), selbst mein Körper, der immer in Rückenlage auf der Couch beim Zauberfenster lag, wenn sie zufällig vor mir zu unserem gemeinsamen Leben erwacht oder noch geblieben, ich aber schon ins Gefängnis abberufen worden war.
Und ich wusste: Wenn sie stürbe, würde nicht nur ihr Körper auf der benachbarten Couch, sondern ganz „Magna sed apta“ selbst hinwegschmelzen, und es würde sein, als wäre es nie gewesen mit seinen endlosen Galerien, Gärten, magischen Fenstern und all den Wundern, die es enthielt.

Manchmal hatte ich eine scheußliche nervöse Angst, wenn ich einschlief, der Fall könnte eingetreten sein – und dann war das himmlische Entzücken, wenn ich beim Erwachen alles wie üblich vorfand, umso heftiger. Ich kniete neben ihrem noch unbeseelten Körper nieder und betrachtete sie mit einer Leidenschaft, die aus allen verschiedenen Spielarten menschlicher Liebe zusammengesetzt war; sogar die Liebe eines Hundes zu seinem Frauchen war dabei und die eines wilden Tieres für sein Junges. Mit sehnlicher, bebender Angst und seufzender Spannung belauschte ich den ersten zarten Hauch von ihren Lippen, die erste leichte Rottönung ihrer Wange, die ihre Rückkehr ins Leben immer ankündigte. Und wenn sie ihre Augen öffnete und lächelte und ihre schlanken jungen Glieder in der Lust des Erwachens streckte, was für Schübe von Dankbarkeit und Erleichterung!
O weh – die Erinnerung!
*****
Schließlich kam die schreckliche, unvergessliche Nacht, in der meine Vorahnung sich erfüllte.
Ich erwachte in dem kleinen Abstellraum von „Parva sed apta“, wo immer die Tür zu und von unserem Palast des Entzückens war. Aber da gab es keine Tür mehr – nichts als eine glatte Mauer …
In unbeschreiblichem Zustand erwachte ich zurück in meiner Zelle. Ich spürte, dass da etwas falsch war, und nach langwierigen Anstrengungen konnte ich erneut einschlafen, aber mit demselben Resultat: die glatte Mauer, die Gewissheit, dass „Magna sed apta“ für immer geschlossen, dass Mary tot war; und dann der furchtbare Sprung zurück in mein Dasein als Häftling.
Das passierte mehrere Male in der Nacht, und als der Morgen dämmerte, war ich ein rasender Wahnsinniger. Ich hielt den Wärter, der als erster (herbeigerufen durch meine „Mary!“-Rufe) hereinkam, für Colonel Ibbetson, versuchte, ihn zu töten, und hätte das getan, wenn er nicht ein sehr großer Mann gewesen wäre, fast so stark wie ich und nur halb so alt.
Andere Wärter kamen zur Hilfe, ich hielt sie alle für Ibbetsons und kämpfte wie der Wahnsinnige, der ich war.
Als ich wieder zu mir kam nach nicht enden wollendem Grauen, Hirnfieber und was nicht allem, wurde ich aus dem Gefängnisspital an einen anderen Ort verlegt, an dem ich mich jetzt befinde.
Ich war plötzlich wieder zur Vernunft gekommen und erwachte zu geistigen Todesqualen, wie ich, der ich auf der Anklagebank gesessen hatte und zu einem schändlichen Tod verurteilt worden war, sie mir nie hätte träumen lassen.
Das Wissen um meinen Verlust wurde mir bald bestätigt, ich hörte (was seit mehr als neun Tagen Stadtgespräch gewesen war), dass die berühmte Mary, Herzogin von Towers, in der –Station der Stadtbahn ihren Tod gefunden hatte.
Eine Frau mit Kind auf dem Arm war von einem Betrunkenen angerempelt worden, als gerade ein Zug in die Station einfuhr, sie hatte ihr Kind aufs Gleis fallen lassen. Sie wollte hinterherspringen, wurde aber zurückgehalten, und Mary, die gerade heraufgekommen war, sprang an ihrer Stelle, und durch ein Wunder von Kraft und Beweglichkeit konnte sie das Kind fassen und auf den Sechsfußweg gelangen, als die Maschine einfuhr.
Sie konnte das Kind halten, bis der Zug durch war, und man half ihr auf den Bahnsteig. Es war ihr Zug, und sie stieg ein, war aber tot, bevor er die nächste Station erreichte. Ihr Herz (das offenbar seit einiger Zeit geschwächt war) hatte versagt, und alles war vorbei.
So starb Mary Seraskier mit 53 Jahren.
*****
Ich war viele Wochen ein leiblicher Rekonvaleszent, befand mich aber in einem Zustand dumpfer, trockener, tränenloser Verzweiflung, deren Druck keinen Augenblick nachließ, außer im traumlosen Schlaf durch Chloral, das mir in großen Mengen verabreicht wurde – und dann das Erwachen!
Ich sprach nie, beantwortete keine Fragen und bewegte mich kaum. Nur eine Idee beherrschte mich: die der Selbstzerstörung; nach zwei erfolglosen Versuchen wurde ich gefesselt und Tag und Nacht beobachtet, so dass ein weiterer Versuch nicht möglich war. Bereits ein Zahnstocher, ein Knopf oder ein Stück Bindfaden in meinen Händen erregte ihr Misstrauen.
Ich versuchte, mich tot zu hungern und wies jede feste Nahrung zurück. Aber ein unerträglicher Durst (vielleicht künstlich verstärkt) machte es mir unmöglich, auch Flüssiges, das mir angeboten wurde, zurückzuweisen, und ich wurde zu Milch, Fleischbrühe, Portwein und Sherry verlockt, und das hielt mich am Leben …
*****
Ich hatte das Verlangen zu träumen völlig verloren.
Schließlich überwältigte mich eines Nachmittags ein seltsames, unerklärliches, unbändiges, wehmütiges Verlangen, noch einmal das Mare d’Auteuil wiederzusehen – nur ein einziges Mal; ein letztes Mal dorthin zu gehen die Chaussee de la Muette entlang, vorbei an den Befestigungsanlagen.
Es wuchs in mir, bis es zur Folter wurde, auf die Schlafenszeit zu warten, so rasend war meine Ungeduld.
Als die heißersehnte Stunde schließlich da war legte ich mich wieder (soweit meine Fesseln das zuließen) in die alte Position, die ich so lange nicht ausprobiert hatte, richtete meinen Willen auf die Porte de la Muette, ein altes steinernes Tod, das die Grande Rue des Passy vom Eingang in den Bois de Boulogne trennte – eine Art Temple Bar.
Es ist vor fünfundvierzig Jahren abgerissen worden.
Bald war ich genau da, wo die Grande Rue auf die Rue de la Pompe trifft, ich ging durch den Bogen und blickte in Richtung Bois.
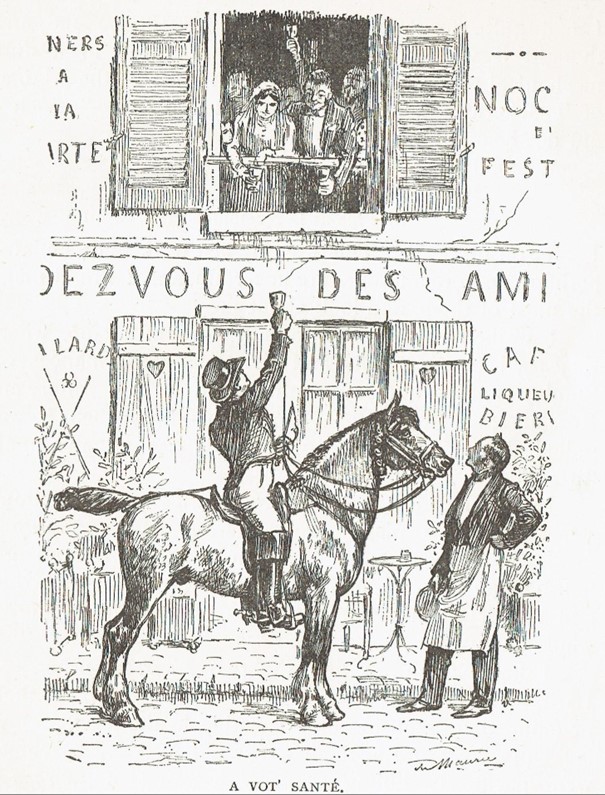
Es war ein trister, bleierner Tag im Herbst; wenige Leute waren unterwegs, aber ein fröhlicher repas de noces (Hochzeitsmahl) wurde in einem kleinen Restaurant zu meiner Rechten ausgerichtet. Dort sollte die Hochzeit von Achille Grigoux, dem Gemüsehändler, mit Félicité Lenormand gefeiert werden, die bei den Seraskiers Hausmädchen gewesen war. Ich erinnerte mich plötzlich an all dies und dass Mimsey und Gogo mit von der Partie waren – der letztere sogar als premier garçon d’honneur, auf den nun die Aufgabe zukam, das Strumpfband der Braut zu stehlen und es in kleine Stücke zu zerschneiden, um die Knopflöcher der männlichen Gäste damit zu schmücken, bevor der Ball begann.
In einer Einfahrt zu meiner Linken warteten geduldig einige verlorene, abgetakelte alte Klepper, knielahm und kurzatmig, fertig gesattelt und gezäumt, auf Mieter – Chloris, Murat, Rigolette und andere; ich kannte sie und hatte sie alle vor einem halben Jahrhundert geritten. Arme alte Schatten einer längst toten Vergangenheit, so lebenswahr, real und rührend – es griff mir ans Herz, sie zu sehen!
Ein hübscher junger Kurier namens Lami in blauem Mantel mit silbernen Knöpfen kam von St. Cloud angetrabt auf einem grauroten Pferd unter großem Geklingel der Pferdeglöckchen und dem Knallen seiner kurzstieligen Peitsche. Er verhielt vor dem Restaurant, rief nach einem Glas Weißwein, erhob sich in seinen Steigbügeln und rief unbekümmert nach Monsieur und Madame Grigoux. Sie kamen im ersten Stock ans Fenster, sahen sehr glücklich aus, er trank auf ihr Wohl, sie tranken auf seins. Ich konnte Gogo und Mimsey unter den Leuten hinter ihnen erkennen und wunderte mich wieder ein wenig, wie ich mich schon so oft zuvor gewundert hatte, dass ich das alles von draußen aus einer ganz anderen Perspektive als Gogo sehen konnte.
Dann dienerte der Kurier galant, rief: „Bonne chance!“, und trabte auf seinem Weg zu den Tuilerien die Grande Rue hinab; die Hochzeitsgäste aber begannen zu singen, sie sangen ein Lied, das mit den Zeilen beginnt:
„Il était un petit navire
Qui n’avait jamais navigué …”
(Es war einmal ein kleines Schiff,
das noch nie zur See gefahren war …“
Ich hatte es ganz vergessen, hörte es mir bis zum Ende an und fand es sehr hübsch; und war irgendwie dumpf und mechanisch an der Entdeckung interessiert, dass es die Vorlage von Thackerays berühmter Ballade von „Little Billee“ sein musste, die ich erst sehr viele Jahre später hörte.
Als sie zu den letzten Versen kamen
„Si cette histoire cvous embête,
Nous allons la recommencer,”
(Wenn diese Geschichte euch nervt,
werden wir mit ihr von vorne anfangen)
ging ich meiner Wege. Dies war vielleicht mein letzter Spaziergang durchs Traumland, Traumstunden sind ungewiss, ich wollte sie nutzen und mich umsehen.
Ich ging in Richtung Ranelagh, eine Art von Kasino, wo sie an Sonntag- und Donnerstagabenden Bälle und Theatervorstellungen gaben (und Wo Rossini später seine letzten Lebensjahre verbrachte; dann wurde es abgerissen, habe ich gehört, um vielen hübschen Villen Platz zu machen).
Auf der Wiese gegenüber von Monsieur Erards Park spielten Saindous Schuljungen Schlagball – la balle au camp – woraus ich schloss, dass es Donnerstagnachmittag sein musste, ein halber freier Tag; hätten sie saubere Hemden angehabt (was nicht der Fall war) dann wäre es Sonntag und ein ganzer Feiertag gewesen.
Ich kannte sie alle und die beiden pions oder Platzanweiser, Monsieur Lartigue und le petit Cazal, machte mir aber nichts mehr aus ihnen und fand sie weder amüsant noch auch nur ein wenig interessant.
Gegenüber vom Ranelagh schlugen ein paar alte Droschkenkutscher in aller Seelenruhe die Zeit tot mit dem bouchon Spiel – Sous von einem Korken mit anderen Sous herunterkicken – große dicke Sous und Doppelsous, die längst außer Gebrauch sind. Es ist ein sehr gutes Spiel, und ich beobachtete es eine Zeitlang und beneidete die längst verstorbenen Spieler.
In der Nähe gab es einen hölzernen Schuppen oder baraque, hübsch angemalt und geglättet und an der Oberkante mit kleinen Trikoloren geschmückt; er gehörte einem Paar alter Damen, Mère Manette und Grandmère Manette – den ältesten Frauen aller Zeiten. Sie waren sehr geschäftstüchtig und gaben nicht einen Centime Kredit – nicht einmal englischen Jungen. Es hieß, sie seien unendlich reich und ganz allein in der Welt. Wie völlig tot müssen sie jetzt sein!, dachte ich. Ich staunte sie an und wunderte mich über ihre Lebhaftigkeit und Lebensfreude. Sie verkauften vielerlei: Nougat, pain d’épices, (Gewürzbrot), Rohrpfeifen, Hupen, Trommeln, laute Federballschläger und Federbälle; für zehn Sous kleine Handspiegel, sauber in Zink eingefasst, die man öffnen und schließen konnte.
Ich sah mich an in einem dieser Spiegel, der draußen hing; ich war alt, verbraucht und grau – war schlecht rasiert, mein Haar fast weiß. In keinem Traum vorher war ich alt gewesen.
Ich ging durch das Tor auf die Befestigungsanlagen und weiter zur äußeren Böschung (die damals noch völlig kahl war) in Richtung Mare d’Auteuil. Der Platz schien verlassen und grau für einen Donnerstag. Es war ein trauriger und trüber Spaziergang; meine Melancholie war unerträglich, mein Herz völlig gebrochen und mein Körper so müde, dass ich mich kaum voranschleppen konnte. Niemals zuvor hatte ich mich in einem Traum müde gefühlt.
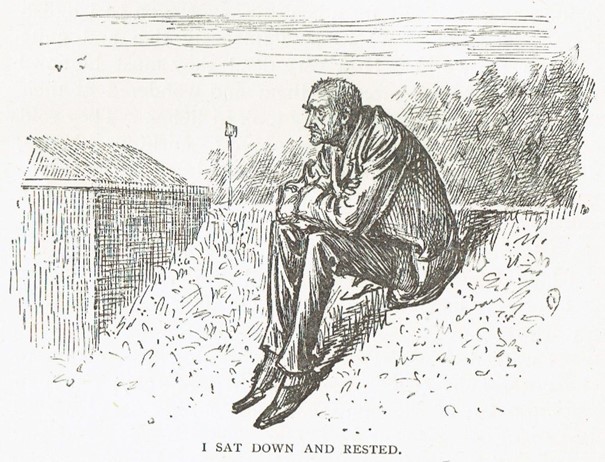
Ich glotzte die berühmten Befestigungen in ihrer ganzen brandneuen Rosigkeit an, die Gerüste waren gerade abgebaut, einige von ihnen lagen noch in dem ausgetrockneten Graben dazwischen – und ich grinste, als ich bedachte, wie wenig diese Ziegel- und Granitmauern helfen würden, um die Deutschen dreißig Jahre später (vor zwanzig Jahren) aus Paris heraus zu halten. Ich versuchte, einen Stein über eine schmale Stelle zu werfen und merkte, dass ich keine Steine mehr werfen konnte; deshalb setzte ich mich hin und ruhte aus. Wie dünn meine Beine waren! und wie elend gekleidet – in alte Gefängnishosen, fettig, fleckig und ausgefranst, die Knie schändlich ausgebeult – und was für Stiefel!
In keinem Traum zuvor war ich schäbig gewesen.
Warum konnte ich nicht ein für alle Mal auf die andere Seite herumgehen, von den hochaufragenden Bollwerken einen Kopfsprung à la hussarde machen und mich für immer und ewig umbringen? O weh! Ich würde den Traum nur eintrüben und vielleicht sogar in meiner elend engen Weste erwachen. Und ich wollte immer noch das mare wiedersehen, so sehr!
Das machte mich nachdenklich. Ich würde meine Taschen mit Steinen füllen und mich ins Mare d’Auteuil werfen, nachdem ich einen letzten Blick darauf und auf seine Umgebung geworfen hatte. Vielleicht würde der Gefühlsschock mich in meinem jetzigen Zustand von Schwäche wirklich im Schlaf töten. Wer weiß? Den Versuch war es dennoch wert.
Ich stand auf und schleppte mich zum mare. Es war verlassen bis auf eine einsame weibliche Gestalt, schlicht in Schwarz und Grau gekleidet, bewegungslos saß sie auf der Bank bei der alten Weide.
Ich ging langsam herum und auf sie zu, hob Steine auf, steckte sie in meine Taschen und sah, dass sie grauhaarig war und mittleren Alters, mit sehr dunklen Augenbrauen und außerordentlich groß, und dass ihre herrlichen Augen mir folgten.

Dann, als ich näher kam, lächelte sie, zeigte schimmernde weiße Zähne, und ihre Augen kräuselten und schlossen sich beinahe, als sie es tat.
„O mein Gott!“, schrie ich; „das ist Mary Seraskier!“
*****
Ich rannte zu ihr hin – warf mich ihr zu Füßen und begrub mein Gesicht in ihrem Schoß, und dort schluchzte ich wie ein hysterisches Kind, während sie mich zu begütigen suchte, wie man ein Kind begütigt.
Nach einiger Zeit blickte ich auf in ihr Gesicht. Es war alt, erschöpft und grau, und ihr Haar wie meins fast weiß. So hatte ich sie vorher nie gesehen; sie war immer achtundzwanzig gewesen. Aber das Alter stand ihr gut – sie sah so liebevoll-schön, ruhig und erhaben aus, dass ich Ehrfurcht empfand, und schnelle kalte Schauer liefen mir den Rücken hinab.
Ihr Kleid und ihre Mütze waren alt und schäbig; ihre Handschuhe waren geflickt – alte Kinderhandschuhe mit Pelzbesatz um die Gelenke. Sie zog sie ab, nahm meine Hände, ließ mich neben ihr sitzen und sah mich eine Weile schweigend mit all ihrer Macht an.
Schließlich sagte sie: „Gogo mio, durch die Berührung deiner Hand weiß ich alles, was du durchgemacht hast. Erzählt dir die Berührung meiner Hand nichts?“
Sie erzählte mir nichts, nur ihre große Liebe zu mir, und nur die war mir wichtig, und das sagte ich ihr.
Sie seufzte und sagte: „Das habe ich befürchtet. Der alte Kreislauf ist zerbrochen und kann nicht wieder hergestellt werden – noch nicht!“
Wir versuchten es noch einmal mit aller Kraft; es war nutzlos.
Sie schaute herum und zu den Baumspitzen hinauf, überallhin; sah dann wieder mich an, mit sehr viel Wehmut, erschauerte und begann schließlich zu sprechen; zögernd zuerst und auf eine ihr fremde Weise. Aber bald wurde sie offenbar wieder sie selbst, fand zurück zu ihrem alten geschwinden Lächeln und Lachen, ihrem vergnügten leichten Schulterzucken, ihren Gesten, ihren vielsprachigen Redewendungen aus alter Zeit (die ich weglasse, weil ich sie nicht immer richtig schreiben kann); ihrer vertrauten, schlichten Sprechweise, ihrer fließenden, magnetischen Ausstrahlung, den reizvollen und sympathischen Modulationen ihrer Stimme, den schnellen, humorvollen Wechseln zwischen Ernst und Heiterkeit – all dem, was ihre Äußerungen so vieldeutig auflud mit allem, was sie außerdem sagen wollte.
„Gogo, ich wusste, dass du kommen würdest. Ich wünschte es mir! Wie furchtbar hast du gelitten! Wie dünn du bist! Es erschüttert mich, dich zu sehen! Aber das geht nicht mehr lange; wir werden das alles ändern.
Gogo, du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer es für mich war, zurückzukommen, selbst für wenige kurze Stunden, denn ich halte nicht sehr lange durch. Es ist, als ob ich hinge und mich mit den Händen an der Fensterbank festhielte. Dieses Mal schwimmt Hero zu Leander, oder Julia klettert zu Romeo empor.
Niemand ist je zurückgekommen.
Ich bin nur eine arme Hülse meines früheren Selbst, unter großen Qualen für dich zusammengesetzt, damit du mich erkennst. Ich konnte mich nicht wieder zu der machen, die ich immer für dich gewesen bin. Ich musste mich hiermit zufrieden geben und das musst auch du. In diesen Kleidern bin ich gestorben. Aber du kanntest mich ja sehr gut, lieber Gogo.
Ich bin einen weiten Weg gegangen – einen so weiten Weg – um ein aboccamento mit dir zu haben. Ich hatte dir so viel zu sagen. Und nun sind wir beide hier, Hand in Hand wie früher, und ich weiß nicht mehr, was es war, was ich dir sagen wollte; und wenn ich es wüsste, ich könnte mich dir nicht verständlich machen. Aber du wirst es eines Tages wissen – und wir haben keinerlei Eile.
Ich kenne schon jeden Gedanken, den du hattest, seit ich starb; dein Teil des Kreislaufs ist wenigstens noch heil. Ich weiß, warum du diese Steine aufhobst und in deine Taschen stecktest. Daran darfst du nie wieder denken – wirst es nie tun. Außerdem wäre es auch zwecklos, lieber Gogo!“
Dann sah sie wieder zum Himmel auf und um sich herum, lächelte auf ihre alte fröhliche Weise, rieb sich die Augen mit den Handrücken und schien sich für eine gute lange Rede zurechtzusetzen – für ein abboccamento!
*****
Von allem, was sie sagte, kann ich nur einige Bruchstücke wiedergeben, all das, was ich heraufrufen und verstehen kann, wenn ich wach bin. Wo immer ich etwas vergessen habe, werde ich eine Linie kleiner Punkte setzen. Nur wenn ich schlafe und träume, kann ich den Rest heraufrufen und verstehen. Dann kommt mir alles sehr einfach vor. Ich sage oft zu mir selbst: „Ich will es mir fest einprägen und in gut gewählten Worten ausdrücken – ihren Worten – und sie auswendig lernen; dann vorsichtig aufwachen, die Worte erinnern und in ein Buch schreiben, damit sie anderen das leisten, was sie mir geleistet haben: Zweifel in frohe Zuversicht zu verwandeln, Verzweiflung in Geduld und Hoffnung in Hochgefühl.“
Aber die Klingel schellt, ich erwache und mein Gedächtnis verlässt mich. Nichts bleibt als das Wissen, dass alles gut für uns alle werden wird und von solcher Art, dass alle, die nicht nach dem Mond seufzen, sehr zufrieden sein werden.
Ach, dieses Wissen: Ich kann es anderen nicht vermitteln. Wie viele, die vor mir lebten, kann ich nicht beweisen – ich kann nur zusichern …
*****
„Wie skurril und altbacken es sich anfühlt“, fing sie an, „wieder Augen und Ohren zu haben und all das, kleine offene Fenster für das, was uns umgibt. Es sind sehr plumpe Behelfsvorrichtungen! Ich hatte sie schon vergessen.
*****
Schau, da läuft unser alter Freund, die Wasserratte, unter der Bank – der alte fette Rattenvater – le bon gros père – wie wir ihn zu nennen pflegten. Er ist nur ein flaches Bildchen, das sich hinauf und hinab in entgegengesetzter Richtung über den Hintergrund unserer Augen bewegt, und je weiter er sich entfernt, desto kleiner scheint er zu sein. In ein paar hundert Yards Entfernung sehen wir ihn wahrscheinlich gar nicht mehr. So wie es ist, können wir ihn nur von außen sehen und jeweils immer nur von einer Seite, und doch ist er voller wunderbarer Dinge, die hervorzubringen Millionen von Jahren nötig waren – wie wir! Um ihn überhaupt zu sehen, müssen wir direkt hinschauen, und dann können wir nicht sehen, was hinter uns und um uns herum ist, und wäre es dunkel, sähen wir überhaupt nichts.
Arme Augen! Säckchen voller Wasser mit einem kleinen Vergrößerungsglas darin und einem Blatt Kresse dahinter – um das Licht einzufangen und zu fühlen!
Ein gefeierter deutscher Augenarzt sagte Papa einmal, wenn sein Instrumentenbauer ihm eine so schlecht gefertigte Maschine wie das menschliche Auge schickte, er würde es zurücksenden und sich weigern, die Rechnung zu bezahlen. Ich kann das jetzt verstehen; und doch, was würde aus uns auf Erden ohne Augen? Und nachher, wo sollten wir sein, wenn nicht einige von uns sie auf Erden gehabt hätten?
*****
Ich kann deine liebe Stimme hören, Gogo, mit beiden Ohren. Warum zwei Ohren? Warum nur zwei? Was du möchtest, denkst, fühlst, du sagst es mir in Lauten, die du gelehrt wurdest – Englisch, Französisch. Wenn ich kein Englisch und Französisch könnte, was auch immer du sagtest, es wäre nutzlos. Sprache ist was Armseliges. Du füllst deine Lungen mit Luft und bringst einen kleinen Schlitz in deiner Kehle zum Vibrieren und bewegst den Mund, und das lässt die Luft vibrieren; und die Luft bringt ein Paar kleiner Trommeln in meinem Kopf zum Vibrieren – eine sehr verwickelte Anlage mit vielen Knöchelchen dahinter – und mein Hirn erfasst ungefähr, was du andeutest. Was für ein komplizierter Weg – und was für eine Verschwendung von Zeit!
*****
Und so geht es mit allem. Wir können nicht einmal richtig riechen! Ein Hund würde uns auslachen – und nicht einmal er könnte es gut!
Und fühlen! Wir können zu heiß und zu kalt empfinden, und manchmal macht es uns krank oder bringt uns sogar um. Aber wir können den kommenden Sturm nicht fühlen, ob er von Norden oder von Süden weht, können den Neumond nicht sehen oder die Sonne um Mitternacht, noch mittags die Sterne, noch wieviel Uhr es ist nach unserem eigenen Ermessen. Mit verbundenen Augen können wir nicht einmal nach Hause finden – nicht einmal eine Taube kann das, auch eine Schwalbe nicht, auch keine Eule! Nur ein Maulwurf oder vielleicht ein blinder Mann, kläglich tastend mit seinem Stock – wenn er auch vorher schon blind war.
Und der Geschmack! Mit Recht heißt es, dass er nicht begründbar ist.
Und dann, um all das in Gang zu halten, müssen wir essen und trinken und schlafen und all das. Was für eine Last!
*****
Und du und ich, wir sind die einzigen mir bekannten Sterblichen, die je Zugang zum Innersten des jeweils anderen durch bloßes Berühren der Hände gefunden haben. Aber dafür mussten wir zunächst einschlafen. Unsere Körper waren Meilen voneinander entfernt; wobei das keinerlei Unterschied machte, denn es wäre uns im Wachzustand nie möglich gewesen – niemals; selbst wenn wir einander gedrückt hätten bis zum Ersticken!
*****
Gogo, ich finde keine Worte, um dir zu sagen, wie, denn in all den Sprachen, die ich je kannte, gibt es keine, die es ausdrücken; aber da, wo ich bin, ist alles Ohr und Auge und der ganze Rest, alles in einem, und es gibt noch – o wie viel – außerdem! Dinge, die eine Brieftaube wusste, eine Ameise, ein Maulwurf, ein Wasserkäfer, ein Regenwurm, ein Blatt, eine Wurzel und ein Magnet – sogar ein Stück Kreide und noch mehr. Man kann einen Ton nicht nur hören, sondern sehen, riechen, fühlen und schmecken, und vice versa. Es ist so einfach, auch wenn es dir jetzt nicht einfach vorkommt.
Und die Töne! O, was für Töne! Die dicke Erdatmosphäre ist kein guter Leiter für solche wie sie, und irdische Ohr-Trommeln keine guten Empfänger. Ton ist alles. Ton und Licht sind eins.
*****
Und was bedeutet das alles?
Ich wusste, was es bedeutete, als ich da und wenigstens Teil davon war – und werde es in wenigen Stunden wieder wissen. Aber dieser, mein armer, alter Erdverstand, den ich wieder anziehen musste, wie eine alte Frau eine Nachthaube aufsetzt, gleicht meinen Augen und Ohren. Er kann jetzt nur verstehen, was auf der Erde ist – was du, Gogo, verstehen kannst, der du ja noch auf der Erde bist. Ich vergesse, wie man einen normalen Traum vergisst, wie man die Lösung eines Rätsels vergisst oder den letzten Vers eines Lieds. Man hat ihn auf der Zungenspitze, aber da sitzt er fest und will nicht herunter.
Bedenke, nur in deinem Hirn lebe ich jetzt – deinem Erdenhirn, das für so viele glückliche Jahre mein einziges Zuhause war – wie meins deins.
Wie haben wir gekuschelt!
*****
Aber dies eine weiß ich: Man muss sie alle einmal gehabt haben – Intelligenz, Ohren, Augen und den Rest – auf Erden. ‚Il faut avoir passé par là!‘ – ohne das wäre für Mensch und Tier kein Nachleben möglich oder vorstellbar.
Man kann einem taubstumm Geborenen nicht beibringen, eine Partitur zu verstehen, einem blind Geborenen nicht, Farbe zu fühlen. Für Beethoven, der einmal mit den Ohren hören konnte, machte die Taubheit ebenso wenig einen Unterschied wie die Blindheit für Homer und Milton.
Verstehst du mein kleines Gleichnis?
*****
Klang und Licht und Wärme, Elektrizität und Bewegung, Wollen, Denken und Erinnern, Liebe, Hass und Mitleid, das Verlangen geboren zu werden und zu leben, und das Verlangen aller lebenden und toten Dinge, einander nahe zu kommen oder auseinander zu fliegen – und Massen von anderen Dingen außerdem! All das läuft auf dasselbe hinaus – ‚C’est comme qui dirait bonnet blanc et blanc bonnet‘, wie Monsieur le Major zu sagen pflegte. ‚C’est simple comme bonjour!‘
Da, wo ich bin, Gogo, kann ich hören, wie die Sonne auf die Erde scheint, die Blumen zum Blühen bringt, die Vögel singen und die Glocken zu Geburt, Eheschließung und Tod läuten lässt – herrlicher, herrlicher Tod, wenn du nur wüsstest – ‚C’est la clef des champs!‘ (Das ist der Schlüssel ins Weite)
Sie scheint auf Monde und Planeten, und ich kann sie hören, aber auch das Echo, das sie von ihnen zurückbekommt. Sogar die Sterne singen; ziemlich weit weg! Aber es ist ihre Mühe wert bei dem Publikum, das zwischen uns und ihnen liegt; und sie können es nicht ändern …
Hier kann ich es nicht hören – kein bisschen – jetzt, wo ich meine Ohren wiederhabe; außerdem sind die Erdwinde zu laut …
Ah, das ist Musik, wenn du willst; aber Männer wie Frauen sind stocktaub dafür – ihre Ohren sind ihnen im Weg! …
Die armen unsichtbaren Plattfische, die in Dunkelheit und Moder am Grund tiefer Meere leben, können die Musik, die Männer und Frauen auf der Erde machen, so armselig sie ist, nicht wahrnehmen. Aber wann immer ein zartes Murmeln, getragen von den Flügeln und Flossen eines Sonnenstrahls, sie um Mittag für wenige Minuten erreicht, und wenn sie dann nur ein Klümpchen Rückenmark haben, um es zu fühlen, und keine störenden Ohren und Augen, dann sind sie besser dran als jeder Mensch, Gogo. Ihre dumpfe Existenz ist gesegneter als seine.
Und doch bedaure ich sie! Ihnen fehlt die Erinnerung an ein Auge und ein Ohr, und ohne sie wird ihnen das Rückenmarkklümpchen nichts nützen; sie müssen sich wie du damit zufrieden geben zu warten …
Die Blinden und Tauben?
O ja; là-bas (da drüben) ist für arme Taubstumme und auf der Erde blind Geborene gesorgt; sie können sich mit Hilfe der früheren Augen und Ohren der anderen erinnern. Überdies, gibt es kein sie mehr. Es gibt kein sie! Das ist nur ein Detail.
*****
Du musst versuchen zu erkennen, dass es gerade so ist, als wäre der gesamte Raum zwischen uns und der Sonne und den Sternen angefüllt mit Rückenmarkklümpchen, viel zu klein für jedes Mikroskop, kleiner als alles in der Welt. Der ganze Raum ist damit angefüllt, Schulter an Schulter – fast so eng wie Sardinen in der Dose – und es ist immer noch Platz für mehr! Aber ein einziger Tropfen Wasser würde sie alle enthalten und kein bisschen weniger durchsichtig sein. Sie alle erinnern sich, dass sie auf der Erde oder sonst wo in dieser oder jener Form lebendig waren, und alle wissen, dass die anderen sich erinnern. Ich kann es nur damit vergleichen.
Einst war der ganze Raum gefüllt mit Steinen, rasenden, wirbelnden, auf einander treffenden und zusammenkrachenden Steinen, und sie schmolzen und dampften in der Weißglut ihrer eigenen Eile. Aber jetzt gibt es da eine Ernte von etwas Besserem als Steinen, das kann ich dir versprechen. Es will sich sammeln, will geballt, gemischt, gesiebt und geworfelt werden – die kostbare, unzerstörbare Ernte von wie vielen Millionen Lebensjahren!
*****
Und das weiß ich: Je länger und strebsamer und vollkommener man sein Leben auf Erden lebt, desto besser für alle. Es ist das Fundament für alles. Wenn die Menschen dies nicht wüssten, aber erraten könnten, was nach dem Tod auf die zukommt, sie hätten nicht die Geduld zu leben, sie würden nicht warten wollen! Denn wer möchte sinnlos Lasten schleppen? Sie würden sich Steine in die Taschen stecken wie du und den nächsten Teich suchen.
Das dürfen sie nicht!
*****
Nichts ist verloren – nichts! Vom unaussprechlichen, hohen, strömenden Gedanken, den auszudrücken einem Shakespeare die Worte fehlen, bis zur zartesten Empfindung eines Regenwurms – nichts! Nicht das Gefühle eines Blattes für Licht, nicht der Sinn eines Magnetsteins für Plus und Minus, kein einziger vulkanischer oder elektrischer Schauer von Mutter Erde.
Alles Wissen muss für uns auf Erden beginnen. Es ist der am meisten begünstigte Planet in diesem unserem heutigen armen System und wird das für einige kurze Millionen von Jahren bleiben. Es gibt noch ein paar andere, vielleicht drei; aber sie haben keine große Nachwirkung. ‚Il y fait trop chaud – ou pas assez!‘ (Es ist zu warm dort – oder nicht warm genug) Es sind Fehlschläge.
Le soleil, die väterliche Sonne, le bon gros père, lässt Leben regnen auf Mutter Erde. Ärmliches Leben war es zuerst, wie du weißt – Gräser und Moos und kleine durchsichtige, sich schlängelnde Dinger – ganz Magen; das ist wahr! Daher kommen wir – Shakespeare und du und ich!
*****
Nach dem Tod jedes Einzelnen behält die Erde seine lehmige Substanz und benutzt sie wieder und wieder; und so viel ich sehen kann, regnet sie alle individuelle Substanz auf die Sonne zurück – oder irgendwo in ihre Nähe – wie ein wertvoller Wassertropfen, der ins Meer zurückkehrt, wo er sich mischt, nachdem er herumgekommen ist und was von der Welt gesehen und den Gebrauch der fünf kleinen Sinne gelernt hat – und sich an alles erinnert! Ja, wie der arme, kleine wandernde Wassertropfen im Exil in dem hübschen Lied, das dein Vater zu singen pflegte, der doch zuletzt immer wieder nach Hause findet –
„Va passaggier in fiume,
Va prigionier in fonte,
Ma sempre ritorn‘ al mar.“
*****
Oder es ist auch so, als ob Salzkörnchen ins Mare d’Auteuil gestreut würden, um sich aufzulösen und mit dem Wasser und mit einander zu mischen, bis das Mare d’Auteuil so salzig ist, wie Salz sein kann.
Erst wenn das Mare d’Auteuil von der Sonne mit dem Salz der Erde, des Erdenlebens und irdischen Wissens gesättigt ist, wird das Ziel erreicht sein, und dann mag die alte Mutter Erde gern ausdörren zu einer Schlacke wie der Mond; seine Arbeit ist getan wie die ihre – ‚adieu, panier, les vendanges sont faites!‘ (Adieu, Korb, die Ernten sind vollbracht!)
Und was die Sonne und den sie umgebenden Lebensozean betrifft – ach, das ist jenseits von mir! Aber die Sonne wird auch eintrocknen und ihr Lebensozean wird zweifellos in andere größere Sonnen hineingezogen werden. Denn alles scheint mehr oder weniger auf die gleiche Art weiter zu gehen, nur crescendo, überall und für immer.
*****
Du musst begreifen, dass es kein bisschen wie ein Ozean ist, kein bisschen wie Wassertropfen oder Salzkörner oder Klümpchen von Rückenmark; aber ich kann dir eben nur durch solche armseligen Metaphern einen Schimmer von dem vermitteln, was ich meine, weil du mich nicht mehr wie früher, als es nur um irdische Dinge ging, durch die bloße Berührung unserer Hände verstehen kannst.
*****
Gogo, ich bin das einzige Wassertröpfchen, das einzige Salzkorn, das noch nicht hat wegschmelzen und in die Allsee sich auflösen können; ich bin die Ausnahme.
Es ist, als wäre ich noch mit einer langen unsichtbaren Kette an die Erde gebunden, als hinge ich an ihrem anderen Ende in einem kleinen durchsichtigen Medaillon, einer Art Käfig, der mich alles ringsum sehen und hören lässt, mich aber daran hindert, hinweg zu schmelzen.
Und bald bemerkte ich, dass dieses Medaillon aus der Hälfte von dir gemacht ist, die noch in mir ist, so dass ich mich nicht auflösen konnte, weil ich zur Hälfte überhaupt noch nicht tot war; denn die Kette band mich an die Hälfte von mir, die ich in dir zurückgelassen hatte, so dass eine Hälfte von mir nicht hier war, um sich aufzulösen … ich werde ziemlich konfus!
Aber wie ich meine Kette liebkoste, du meines Herzens wahre Liebe, mit dir an ihrem anderen Ende!
Du kannst dir die Qualen und Anstrengungen nicht vorstellen, unter denen ich an ihr zur dir zurückgekrochen bin wie eine Spinne an einem endlosen von ihr selbst gesponnenen Faden. Liebe wie meine ist wirklich stärker als der Tod.
*****
Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass wir untrennbar sind für alle Zeiten, du und ich, ein Doppelklümpchen Rückenmark – Vielliebchen! – ein kleines Salzkorn, ein Tropfen. Für uns gibt es keinen Abschied – das sehe ich; aber dies außerordentliche Glück scheint bisher allein auf dich und mich beschränkt; und es ist ganz unser eigenes Werk.
Aber erst wenn du mir folgst, werden du und ich ganz und frei sein, um in den Allozean uns aufzulösenund unsere Rolle zu übernehmen in allem, was sein wird.
Dieser Moment – du musst ihn um keinen Moment beschleunigen. Zeit ist nichts. Ich fange sogar an zu glauben, dass es sie gar nicht gibt; der Unterschied zwischen einem Jahr und einem Tag ist là-bas so gering! Und was den Raum betrifft, du liebe Zeit, ist nicht ein Zoll so gut wie eine Elle?
So können die Dinge nicht gemessen werden.
Das Leben einer Mücke ist so lang wie ein Menschenleben, denn sie hat Zeit, um ihr Geschäft zu lernen, nach besten Kräften Leid zuzufügen, zu kämpfen, Liebe zu machen, zu heiraten, ihre Art zu reproduzieren, desillusioniert, gelangweilt und krank zu werden und glücklich zu sterben – alles an einem Sommernachmittag. Ein durchschnittlicher Mensch kann an die siebzig Jahre leben, ohne viel mehr zu tun.
Und dann gibt es große Mücken, schlaue und gut aussehende, und Mücken von großer persönlicher Kraft und Geschicklichkeit, die ein bisschen schneller und weiter fliegen können als die anderen und eine Stunde länger leben, um einen ganzen Tropfen Blut von einer anderen Kreatur zu trinken; aber wo ist der Unterschied?
*****
Nein, Zeit und Raum bedeuten dasselbe wie ‚nichts‘.
Aber für dich bedeuten sie viel, weil du noch viel zu tun hast. Unser vereintes Leben muss enthüllt werden, das lange süße Phantasieleben, das so viel wirklicher war als die Wirklichkeit. Ach, wo und was waren Zeit und Raum damals für uns?
Du musst alles, was wir herausgefunden haben und wie wir es herausfanden, erzählen; der Weg muss anderen gezeigt werden, die klüger sind als wir und gebildeter, als wir waren. Der Wert für die Menschheit heute und später könnte unabsehbar sein.
*****
Denn eines Tages, wenn alles herausgefunden wurde, was auf Erden herausgefunden werden kann und es zum Gemeinbesitz aller geworden ist (oder sogar schon vorher), wird vielleicht der große Mann erstehen und den großen Rat erstellen, der uns befreien wird für jetzt und immer. Wer weiß?
Ich ahne, dass dieser glänzende Rater ein inspirierter Musiker der Zukunft sein wird, einfach in allen Dingen wie ein kleines Kind bis auf sein Wissen von der Kraft des Klangs; aber selbst kleine Kinder werden in jenen Tagen viel wissen. Er wird nach neuen Tönen verlangen und wird sie finden, neue Töne zwischen den schwarzen und weißen Schlüsseln. Er wird blind sein wie Milton und Homer, und taub wie Beethoven; und dann, in der Stille und Dunkelheit, aus den Tiefen seiner verlorenen und einsamen Seele wird er seine schönste Musik schöpfen, und aus den endlosen Labyrinthen ihres Kontrapunkts wird er ein Geheimnis entwickeln, wie wir es aus dem ‚Chant du triste commensal‘ entwickelten, aber es wird ein größeres Geheimnis sein als unseres. Andere werden diesem verborgenen Schatz sehr nah gewesen sein; aber er wird direkt auf ihn stoßen, ihn ausgraben und ans Licht bringen.
Ich kann ihn mir an der Klaviatur vorstellen, seit alter Zeit vertraut mit dem Fühlen seiner virtuosen Finger; mühsam diktiert er seine Partitur einer geduldigen und ergebenen Freundin – der Mutter, der Schwester, der Tochter, der Gattin – die Partitur, die er niemals sehen oder hören wird.
Was für ein Stammler! Nicht nur blind und taub, sondern verrückt, verrückt in den Augen der Welt für fünfzig, hundert, tausend Jahre. Zeit ist nichts; aber die Partitur wird überleben …
Er wird daran sterben, klar; und wenn er stirbt und zu uns kommt, wird Freude sein von hier bis zum Sirius und darüber hinaus.
Und eines Tages werden sie auf der Erde herausfinden, dass er nur taub und blind – aber überhaupt nicht verrückt war. Sie werden hören und verstehen – sie werden wissen: Er sah und hörte, wie keiner vor ihm jemals gesehen und gehört hatte.
*****
Denn ‚wie wir säen, so ernten wir‘; das ist ein wahrer Spruch, und gesät wird hier auf Erden, geerntet aber jenseits. Der Mensch ist eine Larve; sein toter Überrest, wie er eingesargt im Grab liegt, ist der verlassene Kokon, den er während seines Erdenlebens für sich gesponnen hat, aus dem er hervorbricht und sich erhebt mit all seinen Erinnerungen, sogar den verlorenen. Wie die Libelle, der Schmetterling, die Motte … und wenn sie sterben, ist es dasselbe, und dasselbe mit einem Grashalm. Wir sind alle, tous tant que nous sommes, Beutelchen voll unsterblicher Erinnerung; dafür sind wird da. Aber wir können dem Aktienkapital nur hinzufügen, was wir haben. Wie Père François zu sagen pflegte: ‚La plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu’elle a.‘ (Das schönste Mädchen kann der Welt nur geben, was es hat.)
*****
Außerdem bin ich deine irdische Frau, Gogo – deine liebende, treue, ergebene Gattin, und ich möchte, dass das bekannt ist.
*****
Und dann zuletzt, in der Fülle der Zeit – nur wenige Jahre, ach dann –
Erneut führt Neuha ihren Torquil bei der Hand …“
*****
„O Mary!“ schrie ich, „werden wir drüben wieder glücklich sein? So glücklich, wie wir waren – vielleicht noch glücklicher?“
„Ach, Gogo, ist ein Mensch glücklicher als eine Maus, eine Maus als eine Rübe, eine Rübe als ein Stück Kreide? Aber welcher Mensch möchte Maus oder Rübe sein – und vice versa? Welche Rübe möchte ein Stück – von irgendwas sein außer ihr selbst? Sind zwei Menschen glücklicher als einer? Du und ich, ja; weil wir einer sind; aber wer sonst? Eins ist alles. Glück ist wie Raum und Zeit – wir machen und messen es selbst; es ist eine Vorstellung – so groß, so klein wie du willst; einfach eine Sache des Kontrasts und Vergleichs wie Gesundheit, Stärke, Schönheit oder andere Güter, und wir würden sie gar nicht bemerken, wären da nicht die traurigen persönlichen Erfahrungen ihres Gegenteils! – oder ihrer Steigerung!
Ich habe alles vergessen bis auf dies, und das gilt für dich und mich: Wir sind für immer untrennbar. Sei gewiss. Wir werden nicht für einen Augenblick zurückkehren wollen.“
„Und gibt es weder Strafe noch Lohn?“
„Ach, das nun wieder! Was für ein Detail! Arme, kleine freche und perverse Mücken – sie wurden so geboren und können nicht anders! arme kleine beispielhafte Mücken, die, selbst wenn sie wollten, nicht fehlgehen können! Kommt es drauf an? Ist es nicht genug Strafe oder Belohnung, dass die Geheimnisse aller Mückenherzen offengelegt und für alle anderen Mücken sichtbar werden? Überleg mal!
*****
Es müssen Schlachten geschlagen und Rennen gewonnen werden, aber nicht mehr ‚gegen einander‘. Es braucht Stärke und Schnelligkeit, um sie zu gewinnen; aber es gibt kein Stark und kein Schnell. Es gibt Schwäche und Feigheit, aber keine Feiglinge und Schwächlinge. Gut und Böse, das Böseste und das Beste – es ist alle vermischt; aber das Gute kommt steigt auf, das Böse sinkt nach unten – wird abgelagert, wie Papa zu sagen pflegte. Es ist kein erfreuliches Sediment mit seiner einst nützlichen Grausamkeit auf dem tiefsten Grund von allem – aus den Augen, aus dem Sinn – so gut wie vergessen. C’est déjà le ciel.
*****
Und das Ziel? Die Ursache, das Wohin und das Warum von allem? Ach Gogo, so rätselhaft, so undenkbar wie immer, bis der große Rater kommt! Wenigstens kommt es mir so vor, wenn ich wie eine Närrin spreche aus den Tiefen meines armseligen Unwissens; denn ich bin ein Neuzugang und eine vollkommene Außenseiterin, mit meiner Kette, meinem Medaillon auf dich wartend.
Ich habe nur ein paar Sandkörner am Spülsaum jener See aufgesammelt – einige kleine Muscheln, und ich kann dir nicht einmal zeigen, wie sie aussehen. Ich merke, dass es nicht einmal gut ist, davon zu sprechen, ach! Und ich hatte mir so viel vorgenommen.
O, wie jämmerlich war meine Erziehung auf Erden, wie jämmerlich deine! und wie fühle ich das jetzt, wo ich so viel in Worten zu sagen hätte, in bloßen Worten! Denn um in Worten das Bisschen, das winzige Bisschen auszudrücken, das ich sehe, damit du es verstehen kannst, dafür müssten wir beide der größte Dichter und Mathematiker, den es je gab, in einem sein! Wie du mir Leid tust, Gogo, mit deiner ungeübten, ungeschickten, unschuldigen Feder, armer Schreiberling! Musst das alles aufschreiben – denn du musst es – und dein armes kleines Bestes geben, wie ich es gab, als ich es dir erzählte! Du musst dein Herz sprechen lassen und dich um Stil und Manier nicht scheren! Schreib irgendwie! Schreib für den größten Bedarf und die größte Zahl.
Aber versuch dies zu sehen, Liebster, und mache nach Kräften das Beste draus: Was ich erkennen kann, ist: Alles scheint überall ein immer tiefer, immer breiter werdender Strom zu sein, der mit unfassbarer Geschwindigkeit für sein eigenes Niveau sorgt, für seine VERVOLLKOMMNUNG! … Sich ihr immer mehr nähert und sie nie erreicht, sie zum Glück nie erreichen wird!
Nur dass es sich, anders als bei einem Strom auf der Erde, eher um die munter strömende Flut eines endlosen, grenzenlosen, uferlosen Bachs zu handeln scheint (wenn du dir das vorstellen kannst), und das Niveau, das er sucht, ist unermesslich viel höher als seine Quelle. Und überall ist Leben, Leben, Leben darin! Immer sich erneuernd und verdoppelnd, lässt es den mächtigen Fluss anschwellen, der keine Ufer hat!
Und überall erzeugt Gleiches darin Gleiches, plus ein wenig Besseres oder ein wenig Schlechteres; und das etwas Schlechtere findet seinen Weg in ein totes Wasser, bleibt dort hängen, sinkt schließlich auf den Grund, und es kümmert keinen. Und das etwas Bessere bessert und bessert sich – der Wahnsinn, die Verdrehtheit aller kann das nicht verhindern, kann den Kopfüberstrom nicht aufhalten oder abschwellen oder auch nur für einen Moment rückwärts strömen lassen – c’est plus fort que nous! … Der Rekord will sich selbst übertreffen, die Hochwassermarkierung steigt höher und höher, bis die höchste erreicht ist, die es auf Erden geben kann, und dann, nehme ich an, erkaltet die Erde, die Sonne erlischt, um in Stücke zu zerfallen, die vielleicht erneut Verwendung finden! Und das Gebesserte fliegt in wärmere Zonen und größere Systeme, um sich noch weiter zu bessern! Und so weiter, von besser zu besser, von wärmer zu wärmer und größer zu größer, für immer und immer und ewig!
Aber der letzte Superlativ von allem, absolute Allgüte und Allhöhe, absolutes Allwissen, absolute Allmacht, über die hinaus nichts mehr ist und sein kann, wird überhaupt niemals erreicht werden – denn Derartiges gibt es nicht; es sind Abstraktionen; außerdem bedeutet Erreichen Ruhe, und Ruhe Stagnation, und Stagnation das Ende von allem! Aber es gibt kein Ende, kann keins geben – kein Ende der Zeit und all dessen, was darin aufgehoben ist – kein Ende des Raums und all dessen, was ihn füllt, oder alles würde sich zu einem Haufen zusammenballen und in der Mitte zerschmettern – und es gibt keine Mitte! Kein Ende, keinen Anfang, keine Mitte! Keine Mitte, Gogo! bedenk das! es ist das Unvorstellbarste von allem!!!
Wer also soll sagen, wohin Shakespeare gehört, wohin du, wohin ich – winzige Glieder einer endlosen Kette, so klein, dass selbst Shakespeare nicht größer ist als wir! Und nur ein kleines Wegstück hinter uns die kleinen sich windenden Dinger, die nur Magen sind und von denen wir abstammen; und weit vor uns, aber in direkter Abstammungslinie von uns, eine immer wachsende Macht, so stark, so froh, so schlicht, weise, mild und wohltätig, dass wir, was bleibt uns übrig als auf die Knie zu fallen, die Stirn im Staub, die Herzen voller Verwunderung, Hoffnung, Liebe und zärtlich zitternder Ehrfurcht; und anzubeten, was jetzt noch ein ungeborenes, kaum empfangenes und kaum schon gezeugtes Kind ist, was wir immer gelehrt wurden, als Vater anzubeten, der es noch nicht ist, sondern sein wird, das, in das wir uns alle teilen werden, um Teil und Bestandteil davon in dämmernder Zukunft zu sein, das, was sich langsam, sicher, schmerzhaft aus uns und unseresgleichen herausspinnt durchs unbegrenzte All, und dessen Kommen wir nur vage voraussagen können, weil sein Schatten auf unsere eigenen, langsam, sicher und schmerzhaft erwachenden Seelen fällt.“
*****
Dann kam sie auf irdische Dinge zu sprechen und stellte mir Fragen auf ihre vertraute praktische Art. Zuerst nach meiner körperlichen Gesundheit, mit zärtlichster Besorgnis und weisestem Rat, wie eine Mutter sich danach erkundigt bei ihrem Sohn. Sie bestand sogar darauf, wie ein Arzt mein Herz abzuhören.
Dann sprach sie des Längeren über die Wohltätigkeit, in der sie sich engagiert hatte, und gab mir viele Anweisungen, die ich, als kämen sie von mir, an bestimmte Leute weiterleiten sollte, deren Namen und Adressen sie mir mit großer Sorgfalt einprägte.
Ich habe getan, was sie wünschte, und die meisten dieser Anweisungen wurden buchstabengetreu umgesetzt, nicht ohne eine gewisse Verwunderung auf Seiten der Welt (wie die Welt sehr gut weiß), dass solche nützlichen und weisen Reformen ihren Ursprung beim Insassen eines Asyls für wahnsinnige Verbrecher hatten.
*****

Schließlich kam für uns die Zeit, auseinander zu gehen. Sie sah voraus, dass ich in wenigen Minuten erwachen würde, und sagte, indem sie aufstand:
„Und nun, Gogo, Meistgeliebter aller Zeiten auf Erden, nimm mich noch einmal in deine lieben Arme und gib mir einen Lebewohlkuss – auf Wiedersehen (Im Original deutsch). Komm hierher, um auszuruhen, nachzudenken und dich zu erinnern, wenn dein Körper schläft. Mein Geist wird hier immer bei dir sein. Vielleicht kann ich sogar selber zurückkommen – als diese meine arme Hülse – für die Augen kaum mehr als ein Bündel alter Kleider; und doch eine Welt der Liebe, nur für dich gemacht. Lebe wohl, lebe wohl, Teuerster und Bester. Zeit ist nichts, aber ich werde die Stunden zählen. Lebe wohl …“
Sie drückte mich noch an ihre Brust, als ich erwachte.
*****
Ich erwachte und wusste, dass der schreckliche schwarze Schatten der Melancholie mich verlassen hatte wie ein scheußlicher Albtraum – wie ein langer schrecklicher Winter. Mein Herz war voller Frühlingssonnenschein – die Fröhlichkeit eines Erwachens zu neuem Leben. Ich lächelte meinen Nachtwärter an, der meinen Blick erstaunt erwiderte und rief:
„Na Sir, wenn Sie nicht wirklich ein völlig neuer Mensch sind. Alle Wetter!“
Ich drückte ihm die Hand und dankte ihm für erwiesene Geduld, Freundlichkeit und Nachsicht in einem solchen Erguss, dass ihm Tränen in die Augen traten. Ich hatte wochenlang nicht gesprochen, und er hörte meine Stimme zum ersten Mal.
An diesem Tag gab ich auch ohne jede Vorbereitung oder Erklärung dem Arzt, dem Kaplan und dem Direktor mein Ehrenwort, dass ich weder auf mein Leben noch das von jemand anderem jemals wieder einen Anschlag verüben würde, und man glaubte und vertraute mir auf der Stelle; ich wurde entfesselt.
Ich war nie so bewegt in meinem Leben.
Innerhalb einer Woche erlangte ich meine frühere Kraft wieder; aber ich war ein alter Mann. Das war eine große Veränderung.
Die meisten Menschen altern langsam und unmerkbar. Zu mir war das Alter plötzlich gekommen – in einer Nacht sozusagen; aber mit ihm und ebenso plötzlich die resignierte und frohe Ergebung, die milde Heiterkeit, die es mehr als ausgleichen.
Meine Hoffnung, meine Gewissheit mit Mary eines Tages eins zu sein – das ist mein Hafen, mein Himmel – eine Vollendung der Vollkommenheit, über die hinaus es nichts zu wünschen, nichts vorzustellen gibt. Komme, was da wolle, dies ist sicher, und das ist alles, woran mir liegt. Sie konnte mich und viele andere Dinge außerdem lieben, und dafür liebe ich nur umso mehr; aber ich kann nur sie lieben.
Früher oder später – ein Jahr, zehn Jahre; es kommt nicht darauf an, wie viele. Auch ich fange an, an der Existenz der Zeit zu zweifeln.
Das war das schönste Erwachen meines Lebens – schöner sogar als das Erwachen in der Zelle nach meiner Verurteilung zum Tod, als ein anderer schwarzer Schatten mich verließ – der des Schafotts.
O Mary! Was hat sie nicht alles für mich getan, wie viele Wolken hat sie vertrieben!
Als die Nacht wieder herbeikam, machte ich mich erneut auf den Weg, Schritt um Schritt, von der Porte de la Muette zum Mare d’Auteuil, alles genau wie vorher, das fröhliche Hochzeitsfest, der blausilberne Kurier, die fröhlichen Gäste, die die
„il était un petit navire”
sangen. Nichts war verändert, nicht einmal das tristgraue Wetter. Aber o, welch ein Unterschied in mir!
Ich wollte das Korkenspiel mit den Droschkenkutschern oder Schlagball mit meinen alten Schulkameraden spielen. Ich hätte sogar mit „Monsieur Lartigue“ und „le petit Kazal“ Walzer tanzen können.
Ich sah in Mère Manettes kleinen Spiegel und sah wieder mein verbrauchtes, graues, hageres altes Gesicht, und ich mochte es, fand mich recht gut aussehend. Ich setzte mich hin und ruhte auf den Befestigungsanlagen aus, wie ich es in der Nacht zuvor getan hatte, denn ich war noch müde, aber es war eine höchst köstliche Ermattung; meine Schäbigkeit kam mir annehmbar vor – pauvre, mais honnête. Ein Häftling, ein Wahnsinniger, aber – als Geliebter von Mary – ein Fürst unter den Menschen!
Und als ich schließlich den Ort erreicht hatte, den ich immer als den schönsten auf Erden geliebt hatte, seit ich ihn als Kind zum ersten Mal sah, fiel ich auf die Knie und weinte im reinen Überschwang der Freude. Es war wirklich mein Ort; er gehörte mir, wie kein Land oder Gewässer je irgendwem zuvor gehört hatte.
Mary war natürlich nicht da. Ich erwartete sie nicht.
Aber es scheint seltsam und unbegreiflich, sie hatte ihre Handschuhe vergessen; hatte sie zurückgelassen. Einer lag auf der Bank, der andere auf dem Boden; arme alte geflickte Handschuhe mit der wohlbekannten Form ihrer lieben Hände darin; jede Falte und Runzel erhalten wie in einer Gießform, sogar der Abdruck ihrer Fingernägel; und der Duft von Sandelholz, den sie und ihre Mutter so geliebt hatten.
Ich legte sie mit den Handtellern nach oben neben einander auf die Bank, wo sie in der Nacht zuvor gesessen hatte. Kein Traumwind hat sie weggeweht, kein Traumdieb gestohlen; dort liegen sie immer noch und werden dort liegen, bis der große Wandel über mich kommt und mich mit ihrer Besitzerin vereint.
*****
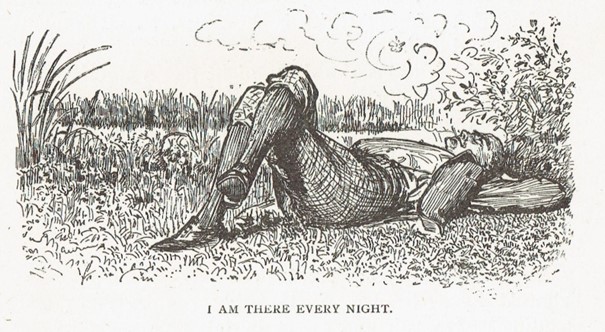
Dort bin ich jede Nacht – im Schein der lieblichen Frühlings- oder Herbstsonne – meditiere, erinnere mich, nehme Töne wahr – Traumtöne, die ich auswendig lerne und tags darauf für einen wirklichen Zweck benutze.
Ich gehe herum und herum oder sitze auf Bänken oder liege am Ufer im Gras, rauche Zigaretten ohne Ende und beobachte das alte Amphibienleben, das ich vor einem halben Jahrhundert so bezaubernd fand und immer noch bezaubernd finde.
Manchmal tauche ich in den Wald ein (der jetzt dem Erdboden gleichgemacht wurde. Seit 1870 ist freie Fläche rund ums Mare d’Auteuil. Ich hatte das seither in einem Traum mit Mary gesehen, die nach dem Krieg Paris besuchte und bei Tag zu all den Plätzen pilgerte, die unseren Herzen so teuer und jetzt so verändert sind; und dann, wenn die Nacht kam, wurde ich ihr Pilgerkamerad. Es war eine betrübliche Entzauberung für uns beide).
Mein Mare d’Auteuil, an dem ich so viele Stunden verbringe, ist das Mare d’Auteuil von Louis Philippe, unveränderlich bis auf solche kleinen Veränderungen, wie sie dann und wann in den Jahren zwischen 1839 und 1846 vorgekommen sein werden: Eine geflickte zerbrochene Bank, eine neu an der Heerstraße aufgestellte Absperrung, ein kleiner hölzerner Steg, wo das Ufer absackt.
Und das Dickicht daneben und dahinter ist auf Meilen dunkel und dicht, mit großen Bäumen und einem üppigen Gewirr von Unterholz.
Es gibt eine Rieseneiche, die in dem Labyrinth schwer zu finden ist (und jetzt für alle Welt sichtbar allein im Offenen steht; eine Zierde der Rennbahn von Auteuil). Ich bin als Junge oft mit Mimsey und den anderen hinaufgestiegen; jetzt komme ich nicht mehr hinauf, aber ich liege gern in ihrem Schatten im Gras und träume dort in meinem Traum, von allen Seiten umschlossen von duftendem, undurchdringlichem Grün; und meine Gesellschaft besteht aus Vögeln, Bienen, Schmetterlingen, Libellen, seltsamen Käfern und kleinen Feldmäusen mit hellen Augen, geschmeidigen gefleckten Schlangen, lebhaften braunen Eichhörnchen und schönen grünen Eidechsen. Dann und wann zeigt sich ein sanfter Rehbock und äst furchtlos in meiner Nähe, und der Maulwurf wirft seinen kleinen Erdhügel auf und steckt die Nase an die Luft.
Es ist eine bezaubernde Einsamkeit.
Bei Tag, wenn ich hellwach in meinem traurigen englischen Gefängnis und unter meinen verrückten Leidensgenossen bin, lache ich bei der Vorstellung, dass meine nächtliche, schattige, französische Einsamkeit, so viele Meilen und Jahre entfernt, heute eine gewöhnliche nackte weitläufige Grasfläche ist, überragt von einer prunkvoll beflaggten großen Tribüne. Stellen wir uns vor, es sei Sonntag, und nach allem, was ich weiß, könnte es ein großes Rennen geben, ganz Paris ist auf den Beinen, arm und reich. Kleine, rot behoste Soldaten, große, blau behoste Gendarmen halten den Parcours frei; die Sonne scheint, die Trikolore flattert, die fröhliche, vertraute Sprache verwandelt die Sommerbrise in Musik. Es ist alles sehr hübsch und belebt, aber der ganze Platz widerhallt vom vulgären Geschrei der Buchmacher, und die Luft ist staubig und schwer vom Geruch starken Tabaks, dem Gestank sich abmühenden französischen Menschentums; und der hagere Eiffelturm schaut vom Himmel über Paris auf alles herab (so hat man es mir erzählt) wie ein Skelett auf ein Fest.
Dann wird es dämmrig, die Massen haben sich zerstreut; zu Fuß, zu Pferd; auf zwei- oder dreirädrigen Fahrrädern, in jeder Art von Fahrzeug; viele mit dem chemin de fer de ceinture, dessen Auteuil-Station in der Nähe ist … Alles ist ruhig, nackt und grau.
Dann fällt die stille Nacht wie ein Vorhang, und unter ihrem freundlichen Schutz findet geschwind die seltsame Umwandlung statt, und alles wird für mich vorbereitet. Die große Tribüne verdampft, die Bahnstation zerschmilzt zu dünner Luft; den Eiffelturm mit seinem elektrischen Licht gibt es nicht mehr! Der süße Wald von vor fünfzig Jahren erhebt sich plötzlich aus dem Boden, und das ganze wilde Leben, das einst darin lebte, feiert fröhliche Urständ.
Ein stiller, tiefer Teich in einem vergangenen französischen Wald, geheiligt durch solche Erinnerungen! Was kann entzückender sein? O sanftes und süßes Heimweh, so bald schon gelindert!

Die heitere Sonne, das Licht anderer Tage, erhebt sich zu dem ihr bestimmten Himmelsort – Zenith, Osten oder Westen nach der Ordnung. Ein leichter Wind bläst von Süden, alles ist angemessen entkeimt, erwärmt, beleuchtet und behaglich, und siehe! Old Peter Ibbetson betritt die Szene, der absolute Monarch all dessen, was er in den nächsten acht Stunden untersucht – einer, dessen Rechte buchstäblich nicht bestreitbar sind.
Ich bestimme, dass weder dort noch am Teich zu lärmenden Versammlungen ermutigt wird; ich möchte den lieblichen Platz ganz für mich haben; Darin ist keine Selbstsucht, denn ich beraube wirklich niemanden. Wer immer jetzt dahin kommt, kommt dorthin vor fünfzig Jahren und weiß es nicht; sie müssen alle lämngst tot sein.
Manchmal ist es ein garde champêtre im Blausilber von Louis Philippe, mit seiner schwarzen Pfeife, seinen Gamaschen, seinem alten Hinterlader und seiner bestickten Seitentasche. Er passt gut in die Landschaft.
Manchmal ist es ein Paar von Liebenden, wenn sie gut aussehen und manierlich sind, oder sonst die Jungen aus Saindous Schule, um „fly the garter“ zu spielen – la raie. (Geschicklichkeits-Wurfspiel, Boule und Boccia ähnlich)
Manchmal ist es der Herr Curé, der friedlich seine Stundengebete paukt und mit langsamem, nachdenklichem Schritt Runde um Runde geht. Ich studiere sein ruhiges, wohlwollendes Licht jetzt im Licht der Lebenserfahrung eines halben Jahrhunderts. Und habe diesen stillen, schwarzen, meditativen Anblick schätzen gelernt, der mich, als ich ein kleiner Junge war, so abstieß – er ist nicht derjenige, der kleine Ketzer lebendig verbrannt! Diese Welt ist groß genug für uns beide – und das trifft auch zu für die künftige Welt! Und er weiß es. Jetzt auf alle Fälle!
Manchmal wird sogar ein Paar von den Prendergasts zugelassen – oder sogar drei; sie sind letztlich doch nicht so übel; sie haben, man sollte es nicht glauben, die Vorzüge ihrer Macken.
Aber sehr oft kommen die alten geliebten Schatten mit ihren Keschern, mit ihrer Ausgelassenheit und ihrem klingenden Anglo-Französisch – Charlie, Alfred und Madge und die anderen, und der grinsende, bellende, kreiselnde Médor, der nach Steinen taucht.
O, wie gut tut es meinem Herzen, sie zu sehen und zu hören!
Ich fühle mich durch sie wie ein Großvater. Sogar Monsieur le Major ist jünger als ich – sein Schnurrbart weniger weiß als meiner. Er reicht mir nur bis zum Kinn; aber ich sehe immer noch zu ihm auf und liebe und verehre ihn, als wäre ich noch ein Kind.
Und Dr. Seraskier! Ich platziere mich zwischen ihm und dem, was er gerade anschaut, so dass er mich unmittelbar anzusehen scheint; aber mit einem sehr abwesenden Blick seiner Augen, wie es nur natürlich ist. Irgendwas belustigt ihn im Moment, er lächelt, seine Augen kräuseln sich hinauf, wie es die seiner Tochter taten, als sie eine Frau war, und sein erhabenes Gesicht wird zu dem eines Engels wie ihres.
L’ange du sourire! (Der Engel des Lächelns)
Und mein fröhlicher, junger, unbeschwerter Vater mit seiner Lebhaftigkeit, seinem ausgelassenen Lachen und seiner immer guten Laune! Er kommt mir jetzt wie ein Junge vor, le beau Pasquier! Er hat eine neue Schleuder selbst erfunden; er zieht sie aus seiner Tasche und schleudert Steine hoch über die Baumwipfel und weit außer Sichtweite – zu seiner und aller Freude – und sorgt sich nicht groß darum, wo sie herunterkommen.
Meine Mutter ist jetzt jung genug, um meine Tochter zu sein; und wie eine Tochter, eine süße, freundliche, liebliche Tochter liebe ich sie jetzt, eine glücklich mit einem großen hübschen Ehemann verheiratete Tochter, der göttlich jodelt und Steine schleudert und mich mit einem Enkel beschenkt hat – beau comme le jour – denn wer immer Peter Ibbetson in jener Zeit gewesen sein mag, die einzigartige Anmut des kleinen Gogo Pasquier ist unbestreitbar.
Und Mimsey ist einfach ein Engelkind! Monsieur le Major ist unfehlbar.
„Elle a toutes les intelligences de la tête et du cœur! Vous verrez un jour, quand ça ira mieux; vour verrez!” (Sie hat alle Kopf- und Herzensklugheit! Ihr werdet es sehen eines Tages, wenn es ihr besser geht; ihr werdet es sehen!)
Dieser Tag ist längst gekommen und schon wieder vergangen; es ist leicht, das jetzt alles zu sehen – die Augen von Monsieur le Major zu haben.
Ach, arme kleine Mimsey, mit ihrem kurz geschorenen Kopf, ihrem blassen gesicht, den langen dünnen Armen und Beinen und den ernsten, freundlichen, leuchtenden Augen, die das Lächeln noch nicht gelernt haben! Wieviel bedeutet sie mir!!!
Und Madame Seraskier in all der jugendlichen Blüte und Pracht ihrer heiligen Schönheit! Eine auserwählte Lilie unter den Frauen – Marys Mutter!
Sie sitzt auf der alten Bank bei der Weide nah bei den Handschuhen ihrer Tochter. Manchmal (ein banales und fast komisches Detail) scheint sie zu meinem momentanen Leidwesen auf ihnen zu sitzen, aber wenn sie weggeht, sind sie noch da, kein bisschen plattgedrückt – weiter die kostbare Gussform jener schönen, selbstlosen Hände, denen ich alles verdanke, jetzt und immerdar.
*****
Ich war nicht wieder in meinem alten Zuhause. Ich fürchte den Anblick der Straße. Ich kann „Parva sed apta“ nicht standhalten.
*****
Aber ich habe Mary wiedergesehen – siebenmal.
Und jedes Mal, wenn sie kommt, hat sie ein Buch dabei, mit Goldschnitt und in grünes Maroquin gebunden wie der Byron, den wir lasen, als wir Kinder waren, oder in rotes Maroquin wie die Elegant Extracts, aus dem wir Grays „Elegie“ ins Französische brachten, und die „Schlacht von Hohenlinden“, und Cunninghams „Pastoralen“.
Was für Ideen sie hat!
Aber inhaltlich sind diese Bücher ganz anders. Sie sind in Geheimschrift gedruckt, in einer Schrift und in einer Sprache, die ich nur im Traum verstehen kann. Nichts was ich oder wer auch immer in irgendeinem wirklichen Buch gelesen hat, reicht an Bedeutung und Wichtigkeit an das heran, was ich in diesen lese. Es gibt sieben davon.
Wenn ich sie lese, sage ich zu mir selbst: Es ist vielleicht letztlich gut, dass ich mich nicht daran erinnere, wenn ich wach bin!
Denn ich könnte indiskret oder ungerecht sein, und entweder zu viel sagen oder nicht genug; und die Welt könnte zum Stillstand kommen, alles durch mich. Denn wer würde sinnlose Lasten tragen, wie Mary sagte! Nein! Die Welt muss sich damit zufrieden geben, auf den großen Rater zu warten!
Deshalb sind meine Lippen versiegelt.
Alles, was ich weiß, ist dies: Alles wird gut für uns sein und von einer Art, dass wir alle, die wir nicht nach dem Mond seufzen, gut zufrieden sein werden.
*****
Auf diese Weise habe ich mich nach besten Kräften bemüht, Rechenschaft abzulegen von unserer beider Leben, meinem und Marys. Wir haben drei Leben miteinander gelebt – drei Leben in einem.
Es war eine angenehme Aufgabe, auch wenn ich sie nur mangelhaft ausgeführt habe, aber auch die Bedingungen ihrer Ausführung waren einzigartig angenehm.
Eine Zelle in einem Asyl für kriminelle Geisteskranke! Das klingt nicht nach einer Gartenlaube in den eleusinischen Gefilden! Aber es ist – und war eine – für mich.
Außer der Sonne, die mein inneres und äußeres Leben wärmt, bin ich mit einer Freundlichkeit, Sympathie und Rücksichtnahme von allen hier, vom Direktor abwärts, behandelt worden, die mich mit unsagbarer Dankbarkeit erfüllt.
Besonders dankbar bin ich meinen guten Freunden, dem Arzt, dem Kaplan und dem Priester – die besten und freundlichsten aller Menschen – jeder von ihnen hat sich seine Gedanken über alles im Himmel, auf der Erde und darunter gemacht, und jeder in einem völlig anderen Sinn als die beiden anderen!
Nur über eines ist keiner von ihnen sich ganz sicher, und das ist, ob ich verrückt oder bei gesundem Verstand bin.
Und es gibt eine Sache – die einzige, über die sie sich einig sind; nämlich dass ich, verrückt oder nicht, ein großes unentdecktes Genie bin!
Meine kleinen Skizzen, schwarzweiß oder farbig, erfüllen sie mit Bewunderung und verzücken sie. Solche Kühnheit und Leichtigkeit der Ausführung, solche eine überwältigende Fruchtbarkeit in der Wahl der Themen, solch ein einzigartiger Realismus in der Konzeption und Darstellung des Vergangenen, ob nun historisch oder nicht, solch eine erstaunliche Kenntnis von Architektur, Charakteren, Kostümen und was nicht allem; dann das Lokalkolorit – gerade als ob ich wirklich dagewesen und es gesehen hätte!
Ich habe die allergrößte Schwierigkeit zu verhindern, dass mein Ruhm sich über die Mauern des Asyls hinaus verbreitet. Meine Bescheidenheit ist nicht kleiner als mein Talent!
Nein, ich möchte nicht, dass dieses große Genie jetzt schon entdeckt wird. Es muss die Arbeit eines sehr viel größeren Genius unterstützen, illustrieren und ausschmücken, dem es alle Inspiration verdankt, die es je hatte.
Eine glanzvolle, eine herrliche Aufgabe liegt vor mir: Marys umfangreiche und hastig aufgezeichneten Erinnerungen, alle in einer Geheimschrift notiert, die wir in unseren Träumen entwickelt haben, zu transkribieren, zu übersetzen und zu ordnen; eine sehr luzide Geheimschrift, sobald man den Schlüssel einmal gefunden hat!
Fünf Jahre werde ich dafür wenigstens benötigen, und ich hoffe, dass es nicht vermessen ist, wenn ich darauf zähle, gesund und aktiv, wie ich mich fühle, und noch weit vom Alter des Psalmisten entfernt.
Zuerst möchte ich
*****
Schlusswort
Hier enden die Erinnerungen meines armen Cousins. Er wurde tot aufgefunden, Todesursache war eine Hirnblutung. Er hielt den Federhalter noch in der Hand, und sein Kopf war über das unfertige Manuskript geneigt, auf dessen Rand er gerade einen kleinen Jungen gezeichnet hatte, der einen Kinderschubkarren voller Steine von einer offenen Tür zu einer anderen vor sich her rollt. Auf der einen Tür steht Passé, auf der anderen Avenir.
Nach einem langen Auslandsaufenthalt kam ich nach England zum Zeitpunkt seines Todes, aber zu spät, um ihn noch lebend anzutreffen. Ich hörte viel über ihn und über seine letzten Tage. Alle, die auf Grund ihrer Pflichten mit ihm Kontakt hatten, schienen einen Respekt vor ihm empfunden zu haben, der an Verehrung grenzte.
Ich hatte die traurige Befriedigung, ihn tot in seinem Sarg liegen zu sehen. Ich hatte ihn seit seinem zwölften Lebensjahr nicht mehr gesehen.
Wie er da lag in seiner ruhigen Länge und Breite, kam er mir riesig vor – das großartigste Menschenwesen, das ich je sah; und das Leuchten seines Totengesichts wird meine Erinnerung heimsuchen, bis ich sterbe. MADGE PLUNKET]
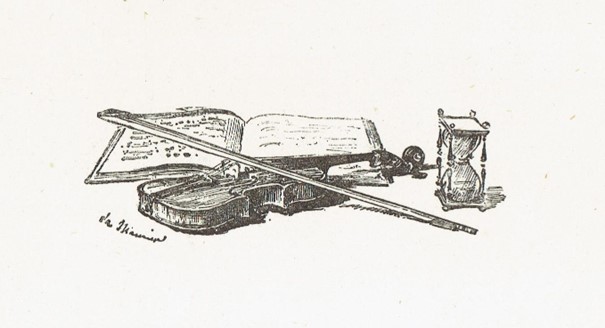
Anmerkungen
[1] Ich habe hier einige Seiten mit detaillierten Beschreibungen vom Leben meines Cousins in der Schule von Bluefriars weggelassen; ebenso die (nicht immer schmeichelhaften) Porträts seiner Lehrer und Klassenkameraden, von denen viele noch leben und zu Ansehen gelangt sind; aber diese Skizzen sind wertlos, wenn die Namen nicht genannt werden, und das wäre aus verschiedenen Gründen nicht ratsam. Darüber hinaus ist bei dem, was ich weggelassen habe, nicht viel, was für sein späteres Leben oder die Entwicklung seines Charakters von irgendwelcher Bedeutung wäre.
[2] Ich habe es vorgezogen, den Bericht meines Cousins über seine kurze Karriere als Rekrut komplett wegzulassen. Er besteht in erster Linie aus Personenbeschreibungen, die nicht alle unvoreingenommen sind; er scheint Autoritätspersonen, die ihm übergeordnet waren, nie gemocht zu haben – weder in der Schule, noch beim Militär. Aber ein intimer Freund meines Ehemanns, General – , der zur Zeit meines armen Cousins Kornett bei den Life Guards war, schreibt mir, dass er sich gut an ihn erinnere als den „bei weitem größten und hübschesten Burschen des ganzen Regiments, von großer Körperkraft, untadliger Führung und ein Gentleman durch und durch und von Kopf bis Fuß.“
[3] Mit großem Bedauern komme ich jetzt zu der Stelle, an der mein Cousin die beklagenswerten Meinungen auflistet, die er in jener Periode seines Lebens über den wichtigsten Gegenstand hatte, der den Geist eines Mannes beschäftigen kann.
Ich habe Vieles weggelassen, fühle aber, dass ich seine traurige Geschichte, ließe ich alles weg, jeglicher moralischer Bedeutung berauben würde; denn es besteht kein Zweifel daran, dass der größte Teil seiner Schwermut auf die mangelhafte religiöse Übung seiner Kindheit zurückzuführen ist und dass seine Eltern (obgleich sie die besten und freundlichsten Leute waren, die ich je kannte) eine schwere Verantwortung auf sich nahmen, als sie ihn „unbefangen“ ließen, wie er es nennt, in jenem zarten, empfänglichen Alter, in dem der Geist „formbares Wachs und bewahrender Marmor“ zugleich ist.
[4] Einige dieser Briefe befinden sich in meinem Besitz.
Nachbemerkung des Übersetzers
Was ist das für ein Mann, der vor der Venus von Milo kniet und anbetend die Hände zu ihr hebt; der mit gefalteten Händen vor dem Erinnerungsbild seiner Mutter kniet; der vor der Geliebten kniet und ihre Hände umfasst, um sie an die Lippen zu führen; der kniend die gefalteten Hände der wieder auferstandenen Geliebten umfasst? Der Titelheld von George du Mauriers Roman „Peter Ibbetson“ hat offenbar ein ganz spezielles Verhältnis zum weiblichen Geschlecht; er betet es im wörtlichsten Sinne an, überträgt die zärtliche Verehrung für die Mutter auf die Geliebte, liebt auch den hochmusikalischen Vater, der freilich stirbt, als Peter noch ein Kind ist; an seine Stelle tritt ein Ziehvater, und als dieser behauptet, sein wirklicher Vater zu sein, bleibt Peter nichts weiter übrig, als den Verleumder seiner Mutter mit einem bleigefüllten Stock brutal zu erschlagen. Ein ödipales Drama, das es verdient gehabt hätte, von Sigmund Freud analysiert zu werden, der sich, als der Roman in London erschien, in Wien zu seinen genialen Eingebungen noch durchrang.
Dass es zu den Techniken der Liebe gehört, ihr Objekt auf einen Sockel zu stellen und idolatrisch zu verehren, ist ein uraltes Märchen- und Sagenmotiv und hat im Minnesang seine überzeugendste Form gefunden. Du Maurier treibt dieses Motiv nun zum Äußersten; er konstruiert ein gemeinsames Träumen von Liebendem und Geliebter und damit eine surreale Vereinigung der Liebenden in einer zweiten, man möchte beinah sagen virtuellen Wirklichkeit. André Breton jubelte, als der Film von Henry Hathaway (mit Gary Cooper als Peter Ibbetson) 1935 herauskam: „Ein Triumph des Surrealismus“. Freilich war dem Stoff bei seiner Umwandlung in ein Drehbuch ein Giftzahn gezogen worden. Im Film tötet Peter Ibbetson nicht seinen Ziehvater, sondern den trunksüchtigen Ehemann seiner Geliebten. Eine einleuchtende Vereinfachung des Plots, ganz und gar hollywoodgemäß – und doch eine Verfälschung und Entschärfung; denn George du Maurier stellt Peter Ibbetsons Ziehvater, das spätere Mordopfer, mit folgenden Worten vor:
Colonel Ibbetson – oder Onkel Ibbetson, wie ich ihn zu nennen pflegte – war der erste Cousin meiner Mutter (…) Aber seine Mutter war einziges Kind und Erbin eines immens reichen Pfandleihers namens Mendoza, eines portugiesischen Juden mit, nebenbei, einem Spritzer farbigen Blutes in seinen Adern, so hieß es jedenfalls; und tatsächlich zeigte sich diese entfernte afrikanische Belastung noch an Onkel Ibbetsons dicken Lippen, den weit offenen Nüstern und großen schwarzen Augen mit gelblichem Weiß, besonders aber in seinen langen, gespreizten, spitzhackigen Füßen, die sowohl ihm selbst als auch den besten Schuhmachern von London viele Probleme machten.
Bereits George Orwell hat 1946 beim Wiederlesen von George du Mauriers sehr viel berühmterem zweiten Roman „Trilby“ (1896) dessen Antisemitismus gerügt.
http://www.orwelltoday.com/orwellsemitismtrilby.shtml
Er hatte hervorgehoben, dass du Mauriers Antisemitismus nicht der der Nazis sei, insbesondere weil Juden zugestanden wurde, dass sie genial zu sein vermochten – aber er hatte darauf bestanden, dass man nach Hitler dieses Buch kritischer lesen müsse, und das lässt sich auch auf die Lektüre des Vorläufers von „Trilby“ übertragen. Die jüdisch-afrikanische Herkunft von Colonel Ibbetson verschärft indirekt den Hass des Neffen, als er erfährt, dass sein Onkel ihn als seinen leiblichen Sohn ausgegeben – und ihm damit afrojüdische Herkunft angedichtet hat. Du Maurier ist auf eine Weise Antisemit, wie es um die Wende vom 19. zum 20 Jahrhundert verbreitet war. Hat sich sein Werk damit erledigt?
Ich kann diese Frage nicht verbindlich beantworten – man lese und urteile selbst! Die afrojüdische Herkunft des Mordopfers lässt sich m.E. aus dem Roman herausoperieren, ohne dass man, wie Hathaway es bei seiner Verfilmung getan hat, den Plot ändern muss. Was übrig bleibt, ist erstaunlich genug! Fritz Güttinger hat im Nachwort seiner Übersetzung des Romans für Manesse hervorgehoben, dass du Maurier in „Peter Ibbetson“ den Kinematographen vorwegnimmt. Insbesondere in der Darstellung der Traumreisen, die Peter Ibbetson und seine Geliebte von ihrem gemeinsamen Studio aus antreten, wird nicht nur der Filmschnitt, es wird auch der Flugverkehr unserer Zeit gleichsam vorausgeahnt, durch den Erdteile zusammenrücken, du Maurier rüttelt energisch an der physischen Beengtheit seiner Zeit, die allein durch Bahnverkehr, Telegraphie und Tonaufzeichnung erste ansatzweise Weiterungen erfuhr.
Meine Übersetzung entstand 2014 in dem Glauben, ich hätte diesen Roman für die deutsche Sprache entdeckt; erst als ich fertig war, fand ich heraus, dass Fritz Güttinger, kein Niemand in der Übersetzerszene, 1963 eine Übersetzung des Romans bei Manesse herausgebracht und mit einem geistvollen Nachwort versehen hatte, das freilich stark fokussiert war auf Güttingers zweite große Leidenschaft neben dem Übersetzen aus dem Englischen: den Stummfilm. Du Maurier publizierte den „Peter Ibbetson“ 1891, als die Technik der Tonaufzeichnung bereits erfunden war, aber kurz vor der Erfindung des bewegten Bildes, des (Kino)Films. Ausführlich beschreibt er, wie stark seine Helden von der Laterna Magica beeindruckt sind, und wenn sie sich zu Geistreisen in ihre Traumkammer zurückziehen und zwischen Amerika, Russland und Italien blitzartig wechseln, ist es in der Tat, als sähen sie fern und du Maurier hätte Filmschnitt und Programmwechsel vorweggeahnt. Güttingers diesbezügliche Ausführungen sind nach wie vor lesenswert; der Versuchung, einige seiner genialischen Übersetzereinfälle zu übernehmen, habe ich tapfer wiederstanden, weil ich mit Manesse (Random House) nicht in Konflikt geraten will. Aber ist eine Neuübersetzung überhaupt notwendig? Ja, aus zwei Gründen:
Du Maurier war ein guter Karikaturist, hat lange für den „Punch“ gearbeitet und kam zum Schreiben erst auf Grund der Ermutigung durch seinen Freund Henry James und weil sein Augenlicht nachließ. Er stattete den „Peter Ibbetson“ mit über hundert Graphiken aus und schuf so ein grafisch-literarisches Gesamtkunstwerk, das nicht ohne Schaden verkürzt wird. Die Manesseausgabe freilich enthält nicht einmal die Hälfte dieser Zeichnungen und viele davon auf Grund des bekannten Manesse-Formats so stark verkleinert, dass man sie kaum erkennt.
Beweist schon dies einen nicht gerade überwältigenden Respekt vor dem Werk, so scheint Güttinger die Eingangsformulierung des Autors, er sei nur ein „poor scribe“, nicht etwa als bloßes „fishing for compliments“, sondern als blanke Tatsachenaussage aufgefasst zu haben. Denn so überzeugend er einen Großteil des Textes übersetzt, so selbstherrlich verkürzt und vereinfacht er ihn an vielen Stellen. Meine Übersetzung ist also, wenn auch vielleicht nicht besser, so doch vollständiger.