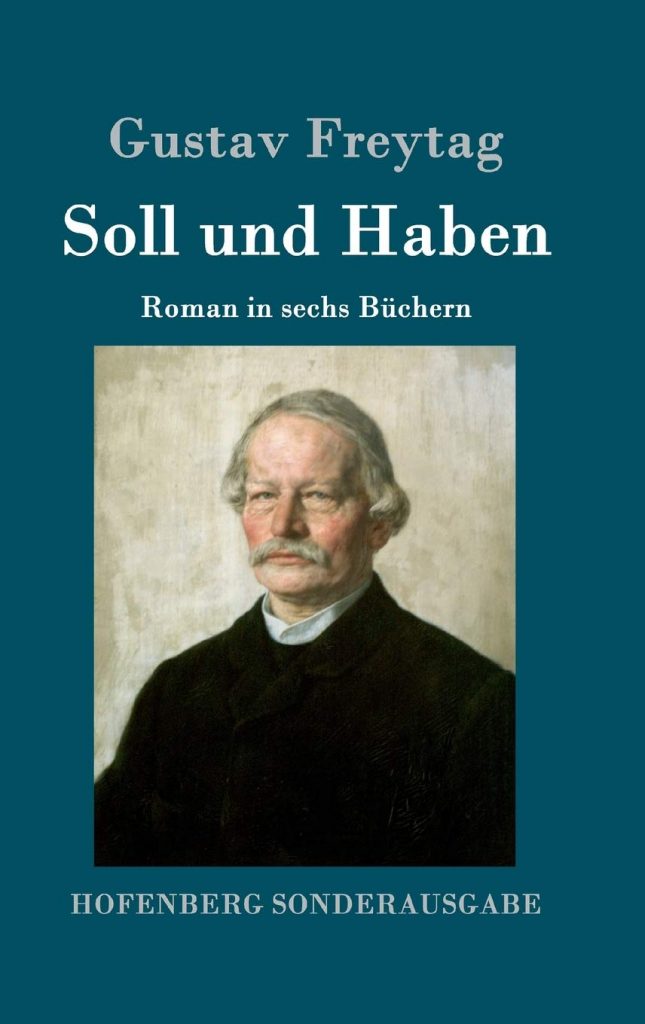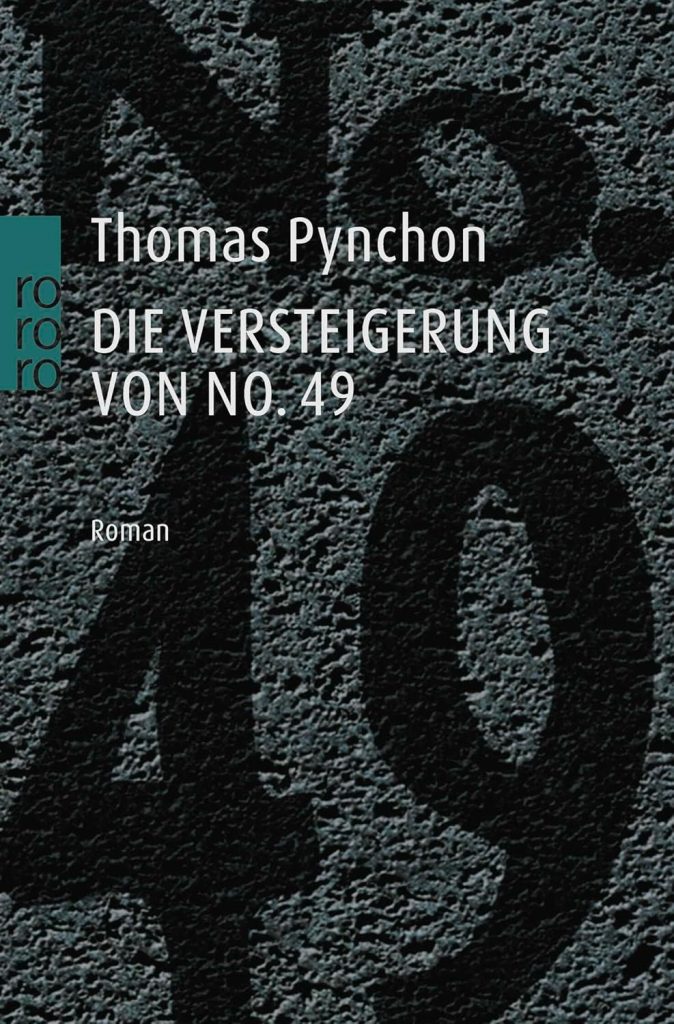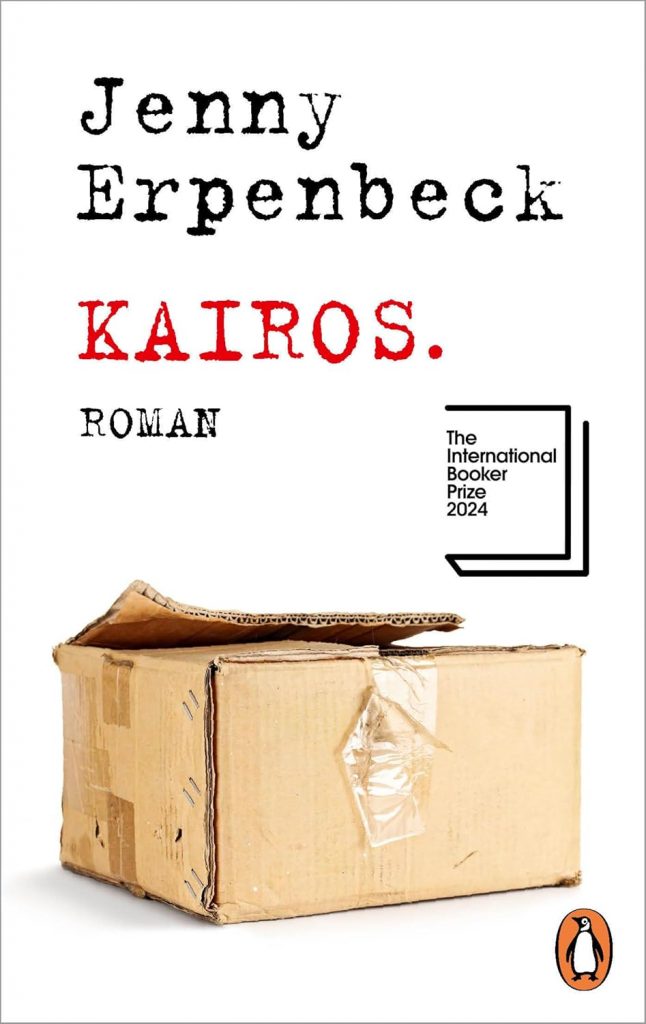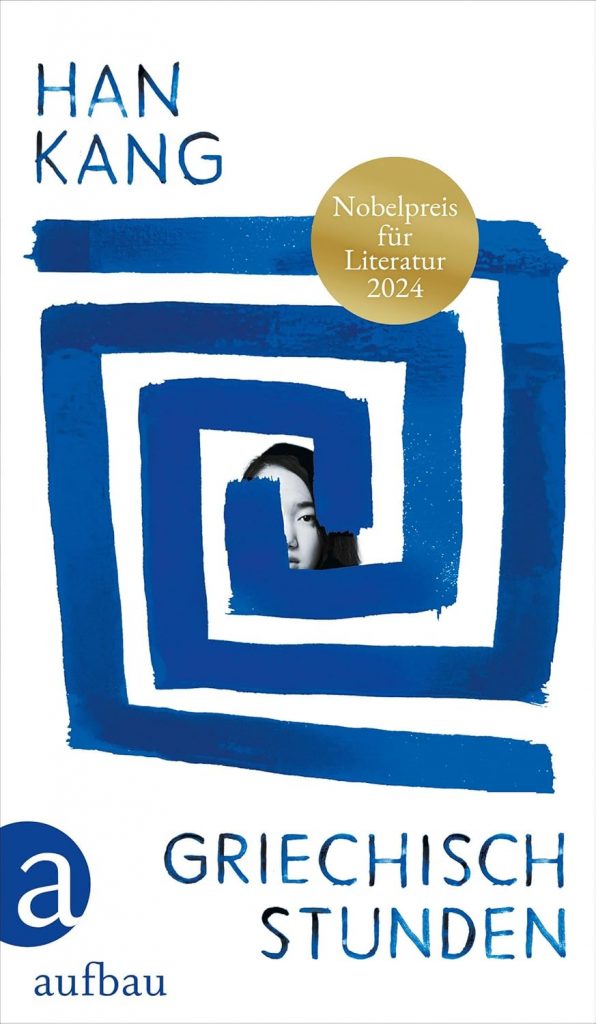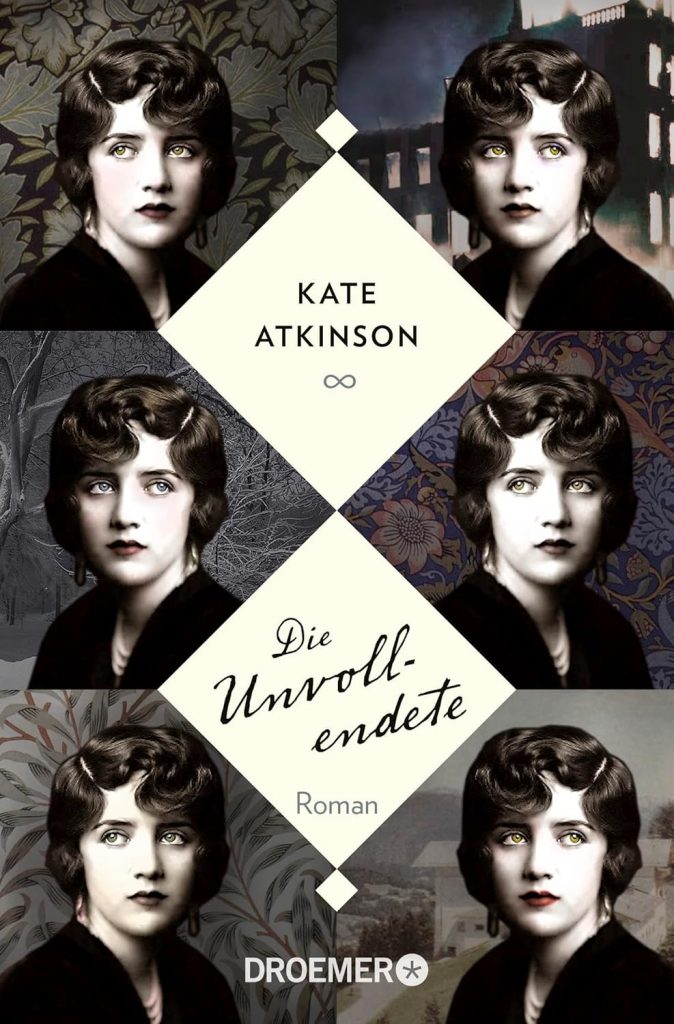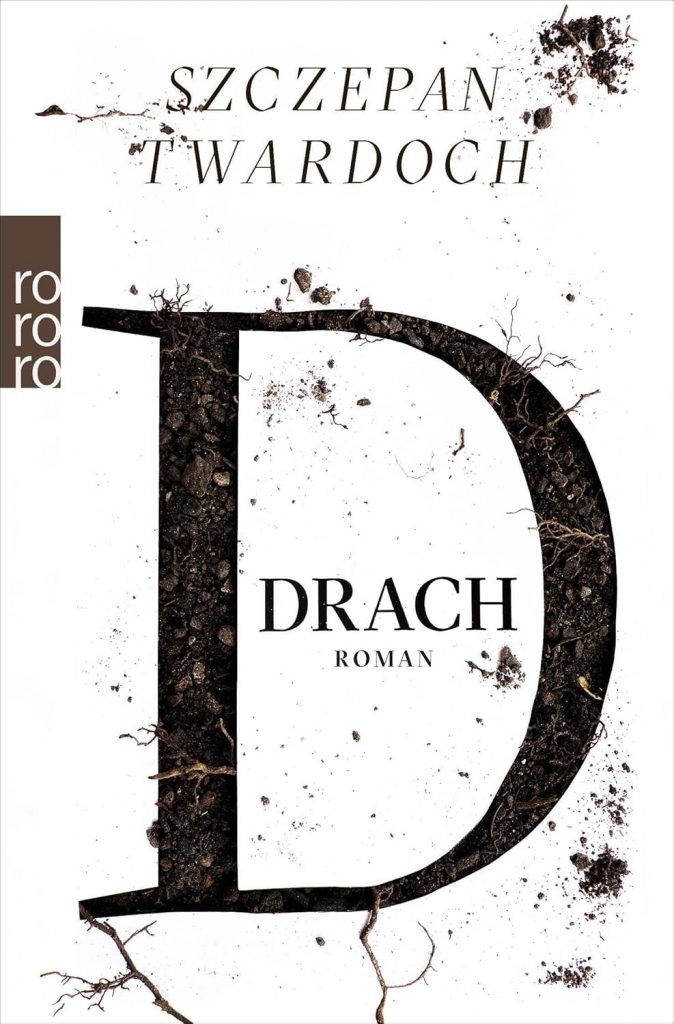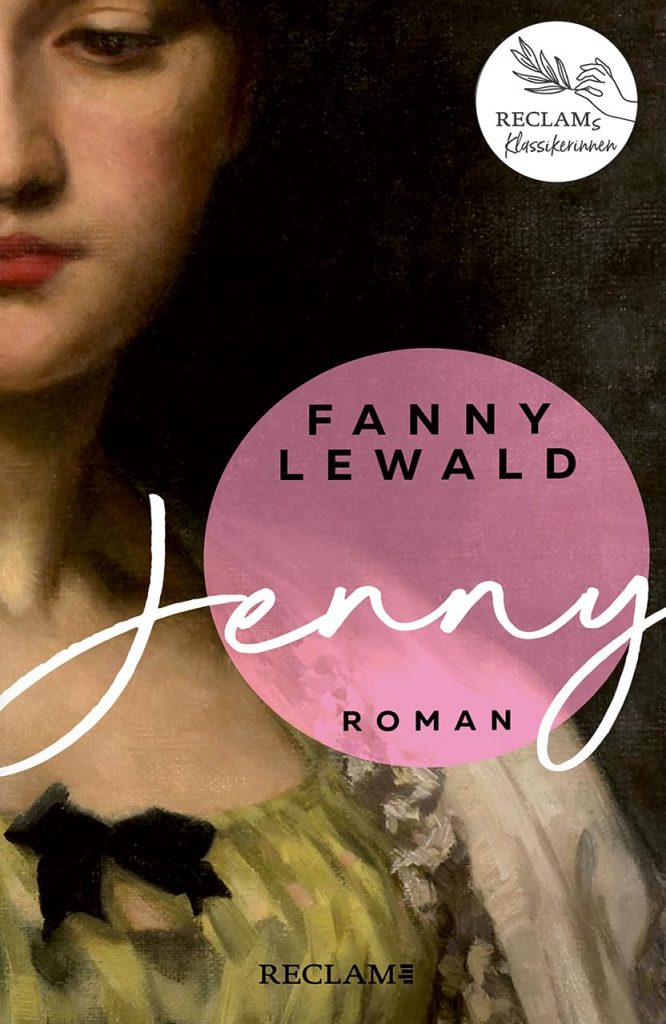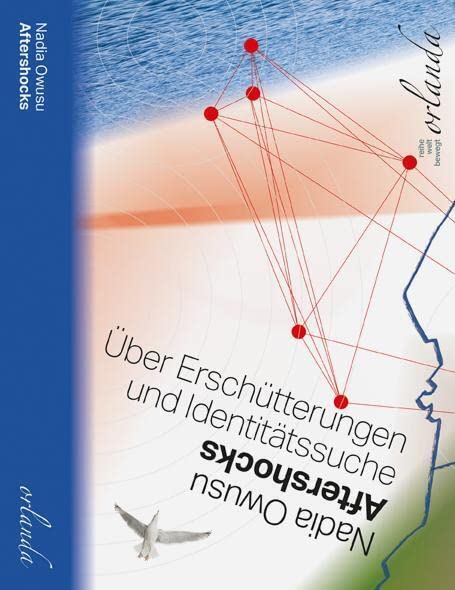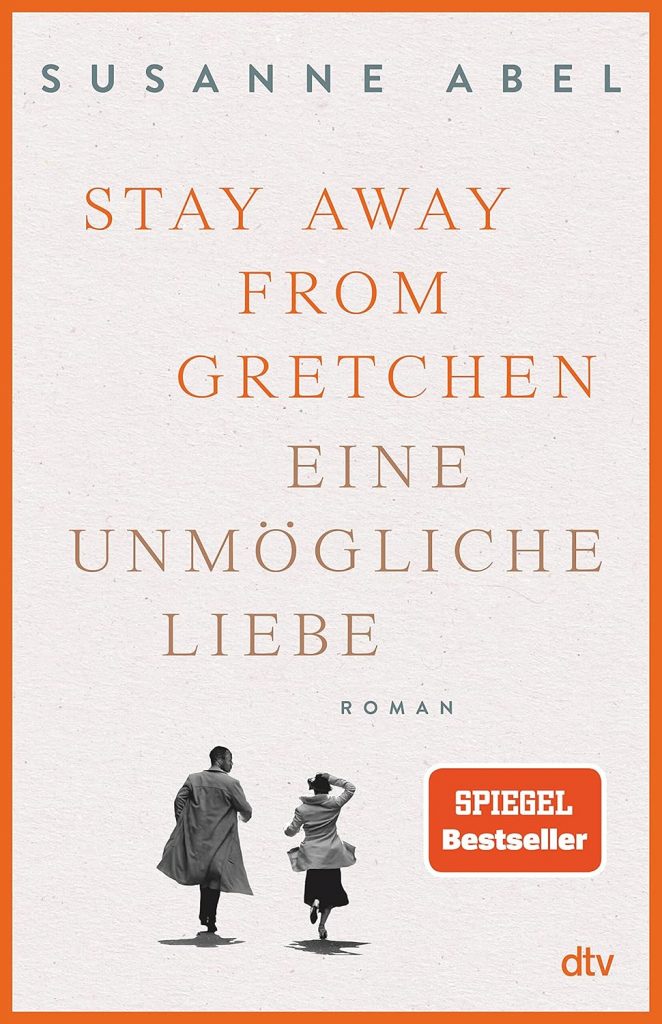Vorbemerkung
Es waren die Insel-Dünndruckbände in der Bibliothek meiner Eltern, die mich zuerst in die Welt der Literatur ein- und entführten; den „Don Quixote“ las ich mit 14, Stendhals „Rot und Schwarz“ wenig später, in Dantes Göttliche Komödie steckte ich die Nase, blieb aber mehr an den imposanten Illustrationen von Doré hängen … Und dann war da ein Roman, auf Zeitungspapier von Rowohlt in Rotationsdruck gedruckt, eben rororo: „Der Frühling des Lebens“ von Marjorie Kinnan Rawlings., in dem ich zum ersten Mal von Süßkartoffeln las. Habe ich gar keine Kinderbücher geliebt? O ja, die schmalen Hefte aus dem Cecilie-Dressler-Verlag: „Heidi“, „Pu der Bär“, „Tom Sawyer“ – und vorher die „Häschenschule“, „Die Wurzelkinder“ und, natürlich, „Struwwelpeter“ – etwas später „Max und Moritz“, und in „Nils Holgerrsons Reise mit den Wildgänsen“ vergrub ich mich regelrecht und kannte die Provinzen Schwedens – Dalarna! – bald besser als die Länder Deutschlands, das zudem ja auch noch gespalten war. Und dann lief mir über den Weg, was meine Eltern als Schund bezeichneten: Hefte über den Zirkus- und Lassoartisten Billy Jenkins, ein Band Karl May mit dem Titel „Im Lande des Mahdi Teil II“ – und schließlich die ersten Micky-Maus-Hefte, monatlich eins für 75 Pfennig, gelegentlich ein heiß begehrtes Sonderheft – und alle enthielten die hinreißenden Geschichten von Donald, seinen drei Neffen, Gustav Gans, Onkel Dagobert und, nicht zu vergessen, die gern mal errötende Daisy, verfasst und gezeichnet von einem Künstler namens Karl Barks und übersetzt von Dr. Erika Fuchs, deren „Ächz!“, „Keuch!“, „Stöhn“ als Erikativ in die deutsche Grammatik vorgedrungen ist. Karl Barks und nicht seinem Fastnamensvetter Karl Marx verdanke ich die erste Einsicht ins Wesen des Kapitalismus: Onkel Dagobert muss Geld loswerden, weil seine Speicher platzen, und wer wäre dafür geeigneter als Donald! Mit vollen Händen verteilt er es unter Pfadfinder, Indianer, superteure Hotels und Spitzenrstaurants, kauft ständig ein neues Auto – und was geschieht, als sie zu Dagobert nach Hause kommen? Der Zaster kommt säckeweise wieder herein, Grund: „Da ist irgendein Idiot durchs Land gefahren und hat in Ihren Restaurants teuer gespeist, in Ihren Hotels genächtigt, Ihre Auto- und Schuhfabriken mussten Sonderschichten einlegen …“ Wer reich ist, kann seinem Reichtum nicht entkommen, im Gegenteil, er kann nur immer noch reicher werden! Und dann enteckte ich im Regal meines Vaters „Die Räuber vom Liang-Schan-Moor“ und „Kin Pin Meh“, in der Bibliothek meiner Mutter die „Chinesische Flöte“, Nachdichtungen chinesischer Lyrik von Hans Bethge – und von da war es nicht mehr weit zum ersten noch lebenden Zeitgenossen, zu Hermann Hesses „Demian“, dem schwerverständlichen, aber gerade darum fesselnden „Glasperlenspiel“ und zu „Narziss und Goldmund“ … Die Drehbucharbeit lehrte mich Robert (nicht Martin!) Walser kennen … Die Begegnung mit Büchern war von da an weitgehend zufällig, gern las ich, was mir zufällig jemand auf den Tisch legte – bis ich in höherem Alter die Notwendigkeit erkannte, mich mit bisher zu sehr vernachlässigten Bereichen auseinander zu setzen, insbesondere mit dem geheimnisvollen Argentinier Borges und seinen vielen Adepten, darunter dem wunderbaren Marquez. In verschiedenen Lesekreisen versuchten und versuchen wir, die Balance zu halten zwischen Neuerscheinungen und Klassikern, die wir gerne auch mal erneut lesen …
Rezensionen
Gustav Freytag: Soll und Haben
Roman
Inhalt: Anton Wohlfahrt, aus bescheidenen Verhältnissen in einer schlesischen Kleinstadt stammend, macht um 1830 Karriere beim Breslauer Großkaufmann Traugott Schröter und dessen Schwester Sabine. Durch seine Liebe zu Lenore, der Tochter des über seine Verhältnisse lebenden Freiherrn von Rothsattel, wird er beinahe aus der Bahn geworfen, als er Schröter verlässt, um das polnische Gut Rosmin, die letzte Zuflucht des von Wucherern zugrunde gerichteten Freiherrn, vor der Wut aufständischer Polen zu retten. Doch als sein Freund Fritz von Finck schwerreich aus Amerika zurückkehrt und ihm Lenore abspenstig macht, kehrt er zu Schröter und der ihn liebenden Sabine in Breslau zurück und wird dessen Compagnon und Schwager.
Rezension: Wer von Haus aus den Anspruch an das Leben macht, zu genießen und seiner Vorfahren wegen eine bevorzugte Stellung einzunehmen, der wird sehr häufig nicht die volle Kraft behalten, sich eine solche Stellung zu verdienen. Sehr viele unserer alten angesessenen Familien sind dem Untergange verfallen, und es wird kein Unglück für den Staat sein, wenn sie untergehen. Ihre Familienerinnerungen machen sie hochmütig ohne Berechtigung, beschränken ihren Gesichtskreis, verwirren ihr Urteil.“
Mit diesen – und noch härteren – Worten lehnt der Großkaufmann Schröter das Ansinnen seines Korrespondenten Anton Wohlfahrt ab, dem in Schulden geratenen Freiherrn von Rothsattel zu helfen. Er übt vernichtende Kritik an einem Adel, der, wenn er aus wirtschaftlichen Gründen zugrunde geht, mit Recht zugrunde geht, weil er nicht bereit oder unfähig ist, sich an Goethes Wort zu halten: „Was du ererbt von Deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“ Arbeit ist dem Adel fremd, und dass der Roman „Soll und Haben“ rund 100 Jahre lang ein bevorzugtes Geschenk an 14Jährige war, liegt sicher auch daran, dass dieses Buch ein Hohelied auf Fleiß und Arbeit ist.
Seit Fontanes Kritik ist viel geredet worden über den Antisemitismus in Freytags Roman „Soll und Haben“ von 1855, insbesondere im Zusammenhang mit Rainer Werner Fassbinders Plan, aus dem Roman eine mehrteilige Fernsehserie zu machen. Dieser Plan ist bekanntlich gescheitert, und das sicherlich auch, weil Fassbinder in seinem Theaterstück „Der Müll, die Stadt und der Tod“ gezeigt hatte, dass er sich nicht scheute, mit antisemitischen Klischees zu hantieren. Nachdem das „Nie wieder!“ zum Holocaust zur Staatsraison der Bundesrepublik geworden war, konnte der WDR es sich 1977 nicht leisten, auch nur einen Hauch von Antisemitismus aus einem Werk der Vergangenheit zu übernehmen.
Ein zweites Problem des Romans ist die Selbstverständlichkeit, mit der er die preußisch-österreichische Vorherrschaft über das geteilte Polen aus kulturell zivilisatorischer Überlegenheit rechtfertigt und die deutsche Kolonisation Richtung Osten verherrlicht. Auch die Slawen waren von den Nazis als „Untermenschen“ behandelt worden, auch hier fürchtete der WDR mit Recht, sich auf vermintes Gelände zu begeben.
Aber der Roman hat eine dritte Stoßrichtung, die so gut wie unbeachtet blieb: Die oben angetönte vernichtende Kritik an der vielfach regelrecht parasitären Lebensform des Adels. Das blieb unbeachtet, weil seit dem ersten Weltkrieg der Adel seine Privilegien weitestgehend verloren hatte, das Problem schien erledigt zu sein. Aber der Adel litt und leidet sehr unter dieser Zurücksetzung und war und ist dankbar dafür, dass es Freiherrn und Grafen nicht nur im Offiziersstand der Wehrmacht, sondern auch im Widerstand gegen Hitler gegeben hatte. Da konnte die Verfilmung eines Romans, in dem der Freiherr von Rothsattel, ein im Versuch wirtschaftlichen Denkens sich hoffnungslos verheddernder Lebemann, eine wichtige Rolle spielt, nicht besonders hilfreich sein. Auch das mag bei der Ablehnung von Fassbinders Projekt nicht unwirksam gewesen sein; denn der, der es verwarf, der damalige Intendant des WDR, war Friedrich Wilhelm Freiherr von Sell, und Rat mag er sich bei seinem Vorgänger als WDR-Intendant geholt haben, Klaus von Bismarck, Erbherr auf Jarchlin und Kniephof in Pommern, Urgroßneffe von Otto von Bismarck, dem „Eisernen Kanzler“, den der erzliberale Freytag als „dämonischen, unberechenbaren Gewaltmenschen“ publizistisch bekämpft hatte.
Fassbinder und sein Dramaturg Peter Märthesheimer hatten ein Ideologiepapier zur Umgestaltung von Hirsch Ehrental und Veitel Itzig, der Shylocks in Freytags Roman, verfasst, sie wollten sie ihrerseits auch als Opfer gesellschaftlicher Zwänge darstellen, und sicherlich hätten sie auch hervorgehoben, dass der Lehrmeister des kriminellen Itzig der deutsche Winkeladvokat Hippus ist. Ein Drehbuchentwurf lag bereits vor. Aber Freiherr von Sell lehnte das Projekt ab, ohne Ideologiepapier und Drehbuchentwurf auch nur gelesen zu haben … Er rechtfertigte das so: „Der Roman von Gustav Freytag ist in weiten Bereichen Inkarnation und Ausformung antisemitischer und antislawischer Ressentiments und Unmenschlichkeiten.“ Auf diese Weise ist Fassbinders wohl ehrgeizigster Plan gescheitert, und es ist durchaus möglich, dass daraus eine der wichtigsten Fernsehserien der noch jungen Bundesrepublik geworden wäre, die bis heute zwischen Anti-Antisemitismus und Zweifeln an israelischer Machtpolitik mühselig ihren Weg sucht. In dem Aufsatz „Gehabtes Sollen – gesolltes Haben“ hat Fassbinder sich bitterlich über die Grenzen beklagt, die das Fernsehen der Kunstfreiheit setzt.
“Soll und Haben“ ist auch heute noch, 170 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung, ein spannend und unterhaltsam zu lesender Roman voller nostalgischer Details aus dem Kaufmannswesen, denen wieder zu begegnen mir großen Spaß macht – zugleich aber auch ist es bedrückend, Überzeugungen darin eindrucksvoll, fast mitreißend geschildert zu finden, die den Werdegang Deutschlands nur allzu fatal mitbestimmt haben.
Ernst Jünger: Auf den Marmorklippen
Roman
„Die Dorfstraße (des Dorfes Puisieux) war mit dem Kriegsschutt des zum Stillstand gekommenen Vormarsches besäumt. Zerschossene Wagen, weggeworfene Munition, Nahkampfmittel und die Umrisse halbverwester Pferde, von blitzenden Fliegenwolken umbraust, verkündeten die Nichtigkeit aller Dinge im Kampfe ums Leben. Die auf dem höchsten Punkt ragende Kirche bestand nur noch aus einem wüsten Steinhaufen. Während ich einen Strauß wundervoller verwilderter Rosen pflückte, mahnten mich einschlagende Granaten zur Vorsicht auf diesem Tanzplatz des Todes.“ Das schreibt Ernst Jünger in der Zusammenfassung seiner Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg („In Stahlgewittern“).
Als der (Zweite Welt)Krieg, in den ihr Mann gezogen war, erst in Polen, dann in Frankreich, dann in Russland, andauerte, hängte meine Mutter Reproduktionen von Dürerbildern an die Wand: Erst die Eichhörnchen und den Hasen, dann auch das Rasenstück … Daran musste ich denken, als ich jetzt „Auf den Marmorklippen“ von Ernst Jünger wieder las, das, 1939 in Deutschland erschienen, durch die Netze der Zensur schlüpfte, obgleich es mit der Schilderung einer „Schinderhütte“ nahe an das gekommen war, was sich in Deutschland abspielte und, sich verschlimmernd, noch abspielen sollte: „Das sind die Keller, auf denen die stolzen Schlösser der Tyrannis sich erheben und über denen man die Wohlgerüche ihrer Feste sich kräuseln sieht: Stankhöhlen grauenhafter Sorte, darinnen auf alle Ewigkeit verworfenes Gelichter sich an der Schändung der Menschenwürde und Menschenfreiheit schauerlich ergötzt.“ Und womit befassen sich die beiden im Mittelpunkt des Roman stehenden Brüder? Sie kehren botanisierend zurück auf die Lichtung mit der Schinderhütte, um eine seltene kleine Blume, das Waldvögelein (Cephalantera rubra), auszugraben und zu vermessen …

Die Wissenschaft habe sie angesichts des Entsetzlichen oft bestärkt, schreibt Jünger: „Es liegt im Blick des Auges, der sich erkennend und ohne niedere Blendung auf die Dinge richtet, eine große Kraft. Er nährt sich von der Schöpfung auf besondere Weise, und hierin liegt allein die Macht der Wissenschaft. So fühlten wir, wie selbst das schwache Blümlein in seiner Form und Bildung, die unverwelklich sind, uns stärkte, dem Hauche der Verwesung zu widerstehen.“ Als Jünger 1982 der Goethepreis der Stadt Frankfurt verliehen wurde, gab es viel Protest. Aber hatte nicht Goethe seine berühmte „Metamorphose der Pflanze“ 1790 angesichts des Ausbruchs der Französischen Revolution geschrieben? Ja, er war frisch verliebt in Christiane Vulpius, aber er flüchtete nicht nur in ihre, sondern auch in die Arme der Wissenschaft, wenn auch nicht in die Linnés, sondern in die seiner eigenen ganzheitlichen Betrachtungsweise.
Sicherlich gehörte Jünger in den zwanziger Jahren zu den Wegbereitern des Nationalsozialismus in der „konservativen Revolution“, und eben dies mag ihm auch zur Duldung durch die Zensur verholfen haben, aber den Krieg verherrlicht hat er nicht, sondern hat ihn mit einer Drastik geschildert, die für mich über Barbusses „Le feu“ und „Im Westen nichts Neues“ von Remarque hinausgeht. Und ist es uns zu verdenken, wenn wir angesichts stattfindender Kriegsgräuel auf philosophische, historische, astronomische oder esoterische Betrachtungsweisen zurückgreifen und z.B. wie Graeculus darüber nachdenken, ob nicht bereits der homerische Krieg um Helena uns viel über den Zusammenhang zwischen Krieg und menschlicher Natur gelehrt hat? Gibt es eine ewige Dialektik zwischen Krieg und Frieden – oder kann sie durchbrochen werden? Und ist die bloße Abwesenheit von Krieg schon Frieden? Ist ein Friede, in dem die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer werden, nicht eine glühende Waffenschmiede? Ein Blick auf die Phasen der Venus, auf die Ringe des Saturn und die Monde des Jupiter ist für mich und meinen Bruder unglaublich beruhigend. Und in diesem Sinne hat Herrenmensch Jünger uns m.E. mit seiner Bügelfaltenliteratur noch was zu sagen in seinem Roman, der unübersehbare Parallelen zu „Der Herr der Ringe“ von einem anderen Veteranen des Ersten Weltkriegs aufweist: J.R.R. Tolkien – ist Jüngers Oberförster nicht Tolkiens Sauron und entspricht das Waldgelichter des Oberförsters nicht Saurons Orks?
Julius Langbehn: Rembrandt als Erzieher
Ein Buch zum Gruseln – das aber den Zeitgeist um 1900 und die Wertewelt derer, die in den ersten Weltkrieg zogen und sich später für den Nationalsozialismus begeisterten, perfekt widerspiegelt.
Heranwachsenden Jungen (warum eigentlich nur denen?) wurde früher, wenn sie 14 oder konfirmiert wurden, ein Buch geschenkt, das ihnen Orientierung für den späteren Lebensweg geben sollte.
Mein Großvater z.B. (geboren 1880) bekam den Konfirmationsklassiker „Hinter Pflug und Schraubstock“ von Max Eyth, einem fröhlich fortschrittsgläubigen Ingenieur des 19. Jahrhunderts, der sich für den Einsatz wuchtiger dampfgetriebener Lokomobile in der Landwirtschaft eingesetzt hatte. Er starb zu früh, um noch den Triumph des „Dieselrosses“ zu erleben, Lokomobile gibt es heute nur noch in Museen. Meinem Großvater sollte wohl der Glaube an den technischen Fortschritt eingeimpft werden; er wurde Hotelier und starb zum Ende des Ersten Weltkriegs an der Spanischen Grippe.
Ich bekam noch in den 50er Jahren ein bereits 100 Jahre altes Werk geschenkt: „Soll und Haben“ von Gustav Freytag. Ich finde es auch heute noch lesenswert, Freytag ist ein guter Stilist, baut schöne Handlungsbögen, und charakterisiert markant, Fassbinder hat den Roman verfilmen wollen, ist aber an den Bedenken des WDR gescheitert. Denn in dem Buch werden Juden mit einer Unbefangenheit geschildert, die wir uns nach den Verbrechen der Nazis nicht mehr leisten können. Freytag war ein bekennender Gegner des Antisemitismus, aber allein seine Namensgebungen – Veitel Itzig und Hirsch Ehrental – wirken heute rassistisch karikierend. „Üb immer Treu und Redlichkeit!“ Dafür sollte mich dieses im Milieu der Kauf- und Geschäftsleute spielende Buch wohl motivieren.
Ein Verschenkbuch von außerordentlicher Beliebtheit soll bis in die Nazizeit hinein „Rembrandt als Erzieher“ gewesen sein, ein Buch, auf das ich indirekt stieß, als ich mich mit Edgar Selges Erinnerungen „Hast Du uns endlich gefunden“ befasste. Der 10jährige Edgar beobachtet um 1960 seinen Vater durchs Schlüsselloch: „Er geht zu seinem Lieblingsgemälde, Rembrandts Mann mit dem Goldhelm. Sieht fast so aus, als ob er mit dem Bild redet.“ Ich erinnerte mich, dass auch bei uns etwas von Rembrandt an der Wand hing: Die Skizze eines schlafenden Löwen, und dass meine Mutter „Rembrandt als Erzieher“ erwähnte und sich wunderte, dass ich das Buch nicht kannte. Den Autor konnte sie nicht benennen – ich habe ihn erst aus dem Internet erfahren: Julius Langbehn aus Kiel, ein Verehrer Nietzsches, zum Katholizismus übergetreten, massiver Einfluss auf die Jugendbewegung. Man kann es sich kostenlos auf den Kindle laden – und es ist eine hochinteressante und gruselige Lektüre, ein Hybrid aus Zarathustra und „Mein Kampf“, eine Lektüre, die einerseits abstoßend ist auf Grund des anmaßenden Bescheidwissens und Wegweiser-Seinwollens des Autors, andererseits aufklärend, weil man versteht, wie unsere Vorfahren sich dem Rassismus und Nationalismus über differenzierende Vorstufen allmählich und unmerklich annähern konnten.
Es sind wohl Passagen wie diese, die das Buch als Geschenkbuch für heranwachsende Jungen geeignet sein ließen:
„Wehrhaftigkeit und Wahrhaftigkeit sind sich sachlich wie sprachlich verwandt; die eine ist die oberste Pflicht des Kriegers wie die andere die oberste Pflicht des Künstlers. Beide gehören zu den obersten Pflichten des Menschen, weil sie seiner tiefsten Charakteranlage entsprechen. Deutsche Menschen sind ehrliche Menschen; deutsche Menschen sind tapfere Menschen.“
„Im innersten Winkel von Niederdeutschland, zwischen Weser und Elbe findet man nicht selten Leute, denen dieser Gedanke aufs und ins Gesicht geschrieben ist: rötlich strahlende Wangen, in denen das Blut feurig kreist, werden von einem hoch- und goldblonden Barte umrahmt. Es ist der apollinische Typ ins Niederdeutsche übersetzt; und also ein Typus der der deutschen Jugend, und also ein Typus der deutschen Zukunft. Zugleich aber ist es auch der Typus der deutschen Vergangenheit in ihrer größten und schönsten Form; es ist der geistige Typus Shakespeares und Rembrandts; in jenem überwiegte der helle Schein des Goldes, in diesem die dunkle Kraft des Blutes. Aus Blut und Gold endlich ist die Morgenröte in ihrer verheißungsvollen Schönheit gemischt; auch eine Morgenröte des deutschen Geistes, wenn sie wieder bevorsteht, kann nur aus diesen Elementen gemischt sein. Aurora musis amica.“
Die Vereinnahmung Shakespeares und Rembrandts in ein niederdeutsches Volkstum ist aus heutiger Sicht eine Frechheit. Aber die Nazis dachten ähnlich und wollten diese Länder ihrer Herrschaft unterwerfen. Und das folgende Zitat bringt es auf den Punkt: „Wie in der Politik, so muss auch in der Kunst die Gesundheit sich mit der Fäulnis auseinandersetzen. Der schlecht jüdische Charakter, welcher so gern mit Zola sympathisiert, ist wie dieser dem rein deutschen Wesen eines Walther v.d. Vogelweide, Dürer, Mozart völlig entgegengesetzt.“ Es gibt freilich auch gute Juden: „Um jedes Volk streiten sich Gott und der Teufel; so auch um das Volk der Juden. Ein echter und altgläubiger Jude hat unverkennbar etwas Vornehmes an sich; er gehört zu jener uralten, sittlichen und geistigen Aristokratie, von der die meisten modernen Juden abgewichen sind.“ Und hier noch deutlicher: „Es ist ein weiter Weg von Abraham, Hiob, Jesajas, dem Psalmisten bis zu den heutigen Börsenjobbern, so weit wie der vom Edlen bis zum Gemeinen.“ Unsere Bewertung könnte eher entgegengesetzt ausfallen.
Ich möchte für dieses in seinem Pathos schon bei Erscheinen 1890 verspottete Buch hier in keiner Weise Reklame machen, aber wer sich an die Archäologie der Wertwelt unserer Eltern herantraut, wird darin Manches, vielleicht sogar Vieles oder allzu Vieles finden, das ihm bekannt vorkommt.
Was könnte man heute einer/einem Vierzehnjährigen auf den Lebensweg mitgeben? Mir fällt im Augenblick nur eins ein: „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ von Yuval Noah Harari. Es ist ein Hohelied auf die Evolutionslehre Darwins, sehr süffig geschrieben – aber wie alle Populärwissenschaft nicht unumstritten.
Thomas Pynchon: Die Versteigerung von No. 49
Roman, aus dem Englischen von Wulf Teichmann. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt), 2015
Erinnert sich noch jemand an die Begeisterung in den 60er Jahren, als mit dem Strukturalismus ein ganz neues Denken sich ausbreitete, das in den Strukturen der Sprache, des Sprechens, des Zusammenlebens, der Kommunikation den eigentlichen Sinn suchte, in der Synchronie, im Gleichzeitigen, und die Diachronie, das Geschichtliche, beiseite schob und damit auch das Politische (weshalb die Marxisten vom Strukturalismus auch nichts wissen wollten)?
Ich begegnete dem Strukturalismus erstmals in Claude Lévi-Strauss‘ „Traurigen Tropen“, in denen er die Verwandtschaftsverhältnisse sog. „kalter“ Völker, z.B. der Aborigines Australiens, untersuchte und eine Komplexität von Matri- und Patrilinearität, von Heiratsregeln und Totems feststellte, die an höhere Mathematik grenzte. Hieran fühlte ich mich erinnert, als ich jetzt Thomas Pynchons „Die Versteigerung von No. 49“ wiederlas, das ich bei meiner ersten Lektüre in den 70er Jahren nur als wirr und absurd wahrgenommen hatte. Warum sollte ich mich für eine Verschwörung namens Tristero interessieren, die sich seit dem 17. Jahrhundert gegen das Postmonopol derer von Thurn und Taxis richtete und die angeblich auf die USA übergegriffen hatte, so dass die Heldin des Buches, Oedipa Maas, noch heute an Toilettenwänden und Briefkästen auf das gestopfte Posthorn, Symbol dieser Bewegung, stößt, die sich W.A.S.T.E. nennt?
Jetzt aber lese ich, wie im Kopf Oedipas zweierlei mit einander verschmilzt: Die Erinnerung an den Schaltplan eines Transistorradios und der Anblick der (fiktiven) Stadt San Narciso in Südkalifornien: „Von ihrem erhöhten Beobachtungspunkt aus sprang ihr jetzt dieser wohlgeordnete, von Straßen durchzogene Häuserhaufen mit derselben und unerwarteten und erstaunlichen Klarheit in die Augen wie damals der Schaltplan … In beiden Fällen war in den Mustern, die nach außen hin sichtbar wurden, ein hieroglyphisch verschlüsselter, aber unzweifelhaft vorhandener Sinn zu erkennen, eine feste Entschlossenheit zur Kommunikation … Und so kam es, dass sie gleich in ihrer ersten Minute in San Narciso wie ein Blitz aus heiterem Himmel eine Erkenntnis traf.“ Pynchon benennt dies als „religiösen Augenblick“, später spricht er von einer „Hierophanie“ – und genau das empfand ich auch, als ich Claude Lévy-Strauss las: Der Sinn liegt nicht in den Dingen, den Ideen, den Inhalten, sondern ausschließlich in ihren Zusammenhängen, in ihrer totalen Interdependenz.
Pynchons Roman verdanke ich außerdem die Bekanntschaft mit einer Malerin, die ich für beunruhigend halte, obgleich ich noch nie ein Original von ihr gesehen habe. Ihre surrealistischen Bilder ziehen mich in Bann – ganz anders als die Bilder Dalis, denen das Effekthascherische immer an die Stirn geschrieben steht. Die Gemälde dieser Künstlerin – ich betone, dass es sich um eine Frau handelt – hängen in vielen mexikanischen Museen, und auf eines stößt die Heldin von Pynchons Buch, Oedipa Maas, in Begleitung ihres Liebhabers Pierce Inverarity, und Pynchon beschreibt das so: „In Mexiko City gerieten sie irgendwie in eine Ausstellung von Gemälden des schönen Exilspaniers (korrekt, sehr geehrter Herr Teichmann, wäre gewesen: der schönen Exilspanierin) Remedios Varo: Auf dem Mittelstück eines Triptychons mit dem Titel Bordando el Manto Terrestre (Den Mantel der Erde stickend) sah man eine Anzahl zerbrechlicher Mädchen mit herzförmigen Gesichtern, riesigen Augen, Haaren aus gesponnenem Gold, die im obersten Raum eines runden Turms offenbar gefangen gehalten wurden, wo sie an einer Art Tapisserie stickten, die sich breiten Bändern durch die schlitzschmalen Fenster in eine Leere ergoss, die so ungeheuerlich war, dass jeder Versuch, sie zu füllen, hoffnungslos scheitern musste; denn alle anderen Bauwerke und Geschöpfe, alle Wellen und Schiffe und Wälder der Welt waren in dieser Tapisserie enthalten, und umgekehrt, die Tapisserie war die Welt. Oedipa hatte in perversem Staunen vor dem Bild gestanden und geweint.“
Und eine Tapisserie dieser Art macht sich nun Pynchon daran, nicht zu sticken, sondern schriftlich zusammen zu weben, indem er seine Heldin Oedipa Maas in Kalifornien auf die Reise schickt, weil sie von ihrem verstorbenen Liebhaber zur Testamentsvollstreckerin ernannt wurde. Doch ihr Auftrag wird ihr, je länger der Roman voranschreitet, immer gleichgültiger, durch die fiktive Rachetragödie The Courier’s Tragedy von dem ebenfalls fiktiven Richard Wharfinger kommt sie auf die Spur von Tristero, dem Rätselhaften, der dem Post- und Kommunikationsmonopol von Thurn und Taxis und schließlich auch dem us-amerikanischen Postsystem ein Netzwerk entgegenstellt, dessen Symbol, das gestopfte Posthorn, Oedipa auf Toiletten und an Briefkästen antrifft, dem Symbol des Netzwerks W.A.S.T.E.: We Await Silent Tristero’s Empire. „Dein Reich komme“ klingt da an.
Der Schaltplan des Transistorradios, die ihm verwandte Stadtstruktur, der Mantel der Erde – lauter Symbole einer inhalts- und dogmenfreien Religiosität des bloßen Zusammenhangs, der Leere. Gegen Ende erscheint es Oedipa immer noch am erträglichsten, „geisteskrank zu sein und Schluss. An diesem Abend saß sie stundenlang da, sogar zum Trinken zu benommen, und übte sich darin, in einem Vakuum zu atmen. Denn dies, o Gott, dies war die Leere. Es gab keinen, der ihr helfen konnte. Keinen Menschen auf der Welt. Die waren alle auf irgendeinem anderen Trip, wahnsinnig, feindselig oder tot.“ Ein in seiner Konsequenz furchtbares Buch über Amerika – bei dessen Lektüre man auf die Unterstützung von Thomas Pynchon Wiki | The Crying of Lot 49 nicht verzichten sollte.
Siehe auch die Besprechung von Gavin Armour!
DIE VERSTEIGERUNG VON NO. 49/THE CRYING OF LOT 49 | Lost In Facts And Fiction: Begegnungen mit BüchernJenny Erpenbeck: KAIROS
KAIROS von Jenny Erpenbeck ist ein Roman, der mir eher wie der Entwurf eines düsteren Comics vorkommt, in dem die untergegangene Welt der DDR-Intelligenzija in all ihrem Bildungshochmut und ihrer Brutalität noch einmal heraufbeschworen wird rings um eine zwanzigjährige Naive mit Namen Katharina, die sich 1986 in den über dreißig Jahre älteren verheirateten Roman- und Rundfunkschriftsteller Hans W. verliebt und ihm auf durchaus pittoreske Art hörig wird: Er geilt sich daran auf, ihr mit einer Reitgerte, bis es wehtut, den nackten Hintern zu versohlen. Wenn sie sich, weißhäutig wie sie ist und mit einem Gesicht aus Biscuit-Porzellan, mit ihm im Wäldchen verabredet, trägt sie natürlich nichts unter ihrem kurzen Rock, und als sie ihm mit einem netten und zärtlichen Kollegen einmal untreu wird, muss sie dafür büßen, indem sie sich fünf oder sechs von ihm mit strafenden und vorwurfsvollen Worten überladene Kassetten nacheinander anhört und der Fülle von Herabsetzungen, ja, Beschimpfungen schriftlich erwehren muss. Das in der DDR übliche Ritual der Selbstkritik nach begangener Verfehlung lebt darin in seiner ganzen Doppelmoral fort, denn der anklagende Hans ist ja selbst ein Ehebrecher.
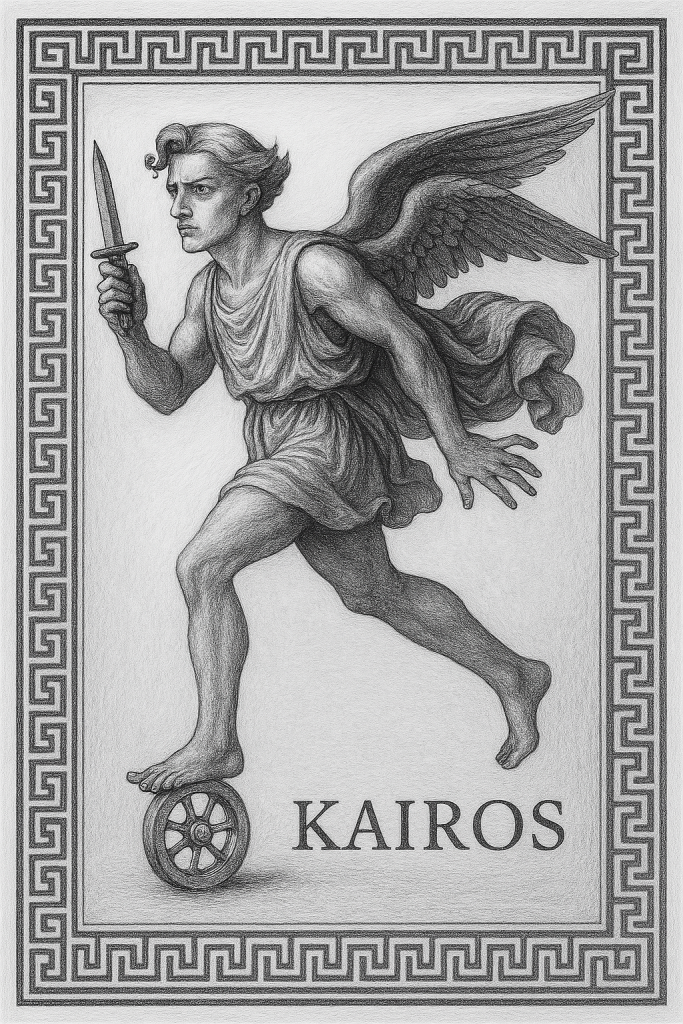
Und am deprimierendsten ist es, dass Katharina das alles aus Liebe mitmacht. Ist es nicht unumstritten, dass die Frauen in der DDR selbstbewusster und trennungs- bzw. scheidungsbereiter waren als in Westdeutschland? Davon keine Spur in Erpenbecks Roman, der ein unterwerfungssüchtiges Naivchen ohne jede Selbstachtung zu seiner Heldin macht. Gegen Ende findet sie in der Liebe einer Rosa ein vorübergehend Entspannung und holt sich das Kind, das Hans zu zeugen offenbar nicht imstande ist, bei einem Studenten. Sie sagt Hans, das Kind sei nicht von ihm, er will es nicht wahrhaben, aber sie verliert es vorzeitig, und dann, endlich, kommt es zur Trennung.
Und im Epilog der Autorin erfahren wir, was vorher schon ahnbar war aus seinem Verhalten: Er war zweitweise unter dem Namen Galilei IM der Stasi, um die vielen ihm bekannten Kulturschaffenden „abzuschöpfen“ und zur „Bearbeitung weiblicher Personen“ eingesetzt zu werden. Als er Katharina kennenlernte, hatte die Stasi seine Akte wegen Unergiebigkeit bereits geschlossen. Und mir persönlich fällt es schwer, ihn dafür zu bedauern, dass er arbeitslos wird, weil der im Volk verhasste und verachtete Rundfunk abgewickelt wird.
Dass es sich um eine Schattenbeschwörung handelt, wird zum Schluss deutlich, wenn Katharina sich vorstellt, zwischen den Tatzen der Sphinx zu liegen und von dem zerstückelten Osiris zu träumen, dessen Stücke Isis, seine Schwester, zusammensetzt – wie sie in diesem Roman versucht hat, die ihr bekannten, von ihr durchlebten Stücke der DDR zu einem düster-nostalgischen Panorama zu verleimen. Schon Uwe Tellkamp hat in seinem Roman „Der Turm“ dem Bildungsbürgertum der DDR ein Denkmal gesetzt, einem Schlüsselroman, in dem Hermann Kant, Stefan Heym u.a. deutlich zu erkennen sind. Jenny Erpenbeck ist anders vorgegangen. In Hans W., dem anmaßenden Liebhaber Katharinas, fließen verschiedene Autoren zusammen: Heiner Müller (der ebenfalls IM war) und Peter Hacks (der wie Hans W. aus der Bundesrepublik in die DDR gezogen ist).

Hacks‘ Freund André Müller sen. habe ich in Köln kennengelernt und seine exquisiten Kochkünste bewundert und genossen. Kam er von einem Besuch bei Peter Hacks aus der DDR zurück, hatte er den Kofferraum voller Fasane, und es gab Fasanenpastete, dazu natürlich den besten Côtes du Rhône … „Wir Sozialisten müssen die Welt vor der McDonaldisierung retten!“, war sein Slogan. Aber als die Kölner Linken sich für Wolf Biermann stark machen wollten, war er es, der ihnen den Geldhahn abzudrehen drohte, und schon waren sie wieder auf Linie. Die „Resolution der Dreizehn“ gegen Biermanns Ausbürgerung hätte Hans W., Katharinas Liebhaber, damals „beinahe“ unterschrieben. Von einer DDR, wie sie in dem Beitrag „Subkultur“ unserer Autorin Diestelzie geschildert wird: bei Erpenbeck keine Spur. Ihr ist es wichtiger, den ersten Liebesakt ihres Protagonistenpaares mit Texten aus Mozarts Requiem anzureichern, das gleichzeitig im Hintergrund auf dem Plattenspieler abgespielt wird. Wird da nicht Effekt auf Effekt gehäuft und nähert sich einer Art von dialektischem Bildungskitsch?
Auch in Christoph Heins Roman „Frau Paula Trousseau“ (2008) kämpft sich eine DDR-Künstlerin mühselig genug im Kunstpatriarchat empor. Auch dieser Roman spielt in der Intelligenzija der DDR, aber er verliert sich nicht ins Klagen um das Verlorene und es geht in ihm um Menschen und nicht nur um Konstrukte einer Träumenden zwischen den Tatzen der Sphinx.
Han Kang: Griechischstunden
Deutsch von Ki-Hyang Lee
Lange nicht ein so schwer einzuordnendes Buch gelesen: Ein Roman? Ein dramatisches Werk? Ein lyrisches Gedicht? Von allem etwas! Auf ganz filmische Weise beginnt es mit zwei Personen, die einander nicht kennen oder fernstehen: Einer Mutter, die das Sorgerecht für ihren neunjährigen Sohn verloren und darunter sowie unter dem ebenfalls schon zurückliegenden Tod ihre Mutter so sehr leidet, dass sie in Aphasie verfallen ist, in eine Unfähigkeit zu sprechen. Und einem Lehrer für Altgriechisch, der eine sehr starke Brille trägt und sein Augenlicht verliert. Auch er hat ein Trauma erlitten durch den Selbstmord seines besten Freundes Joachim Grundel, an dem er sich mitschuldig fühlt. Denn dieser Freund hat sich in ihn, den Platonkenner und Altgriechischlehrer, verliebt und erotisch die Initiative ergriffen, aber das hat er nicht nur abgewiesen, er ist aus Deutschland geflohen, wo sich das zutrug, und Deutschland war einmal seine zweite Heimat, er ist in Mainz aufgewachsen.
In seine Kurse geht nun diese in ihren Gefühlen so verletzte Mutter in der Hoffnung, durch das Altgriechische ihr Sprechfähigkeit zurückzugewinnen. Ausdrücklich heißt es, es hätte auch eine andere Sprache sein können. Von der Frau und Mutter erzählt Han Kang in der dritten Person, abwechselnd mit Kapiteln, in denen der Altgriechischlehrer sein Erleben in der Ichform preisgibt. Hat man das erst einmal begriffen (ich erlag zunächst dem Irrtum, Han Kang berichte über dieselbe Person mal in der dritten, mal in der ersten Person), ergibt sich eine recht durchsichtige und vertraute Struktur: Zwei von einander getrennte Personen verschiedenen Geschlechts müssen und werden einander begegnen und lieben. Die Hindernisse sind groß, doch sie sind nur dazu da, um überwunden zu werden.

Auf etwas triviale Weise ist es eine Meise, die sich ins Schulgebäude verflogen hat und die zuerst sie, dann er nach draußen zu scheuchen versucht, dabei verliert er seine Brille, zertritt sie versehentlich und kann nun gar nichts mehr sehen. Aber zum Glück kommt sie zurück, rettet ihn aus seiner Not, bringt ihn zu einem Optiker für eine neue Brille … Die beiden erinnern ein wenig an das Gedicht von Gellert: Der Lahme und der Blinde … Das Schlusskapitel „Der Wald des abgrundtiefen Meeres“ ist eine lyrisch-poetische Überhöhung ihres Zusammenfindens, in der dem Mund der Frau zum ersten Mal wieder ein Laut entschlüpft … Das schönste erotische Gedicht, das ich kenne. Han Kang, Nobelpreisträgerin des vorigen Jahres, hat als Lyrikerin begonnen.
„Blank lag das Schwert zwischen uns.“ An dieses Wort des alten, erblindenden Borges erinnert sich der Altgriechischlehrer im ersten Kapitel. Borges ist wie er ein Entwurzelter zwischen den Kulturen. Und entsprechend deutet er das Schwert als das Trennende.
Wussten Sie schon, dass Sokrates bei Platon andeutet, dass Leiden (pathein) und Erkennen (mathein) miteinander zu tun haben? Paul Tillich drückt das so aus: Die Tiefe des Leidens ist die einzige Tür zur Tiefe der Wahrheit. Auch ein wenig Philosophie und das Höhlengleichnis spielen eine Rolle. Was für ein reiches, tiefes und schönes Buch!
Ernst Wiechert: Das einfache Leben
veröffentlicht am 31.12.24
Wie kann man trotz massiver äußerer Beschränkung und Verfolgung kreativ bleiben und sich anderen mitteilen oder für sie sogar zu einem Trost werden? In einer solchen Situation sind wir m.E. momentan (noch) nicht, aber für viele ist sie gefühlt bereits da, und gerade in deren Namen könnte sie für alle auf uns zu kommen. Darüber nachdenkend, habe ich mich an meinen Deutschlehrer erinnert, der einen Roman über alles liebte, der ihm in den Jahren, als er gegen Ende des zweiten Weltkriegs zum zweiten Mal Soldat werden musste, Halt und Hilfe gegeben hat: „Das einfache Leben“ von Ernst Wiechert. Er wurde gerade neu aufgelegt, ich erwarb ihn – und bereue nicht, ihn gelesen zu haben. „Er ist das stärkste Buch, das die innere Emigration hervorgebracht hat,“ sagte mein Deutschlehrer, der der Bekennenden Kirche angehört hatte. Und Wiechert hatte durch die Nazis gleichsam den Ritterschlag erhalten, indem sie ihn für zwei Monate in Buchenwald einbuchteten. Er hielt 1945 die berühmte Rede an die deutsche Jugend (von Thomas Hettche in „Herzfaden“ eindrucksvoll zitiert), in der er gnadenlos mit den Nazis abrechnete – aber das war wohl etwas zu deutlich. So absolut wollten die Deutschen ihre Vergangenheit nicht verdammt sehen. Die Intellektuellen und Autoren fanden in Sartre, Hemingway und Faulkner neue Idole, wandten sich von Wiechert ab, der in die Schweiz zog und dort verstarb.

Der Protagonist des Romans, ein ehemaliger Marineoffizier, ist durch das Erleben des massenhaften Sterbens im Ersten Weltkrieg so ver- und zerstört, dass er seine gesellschaftlich ambitionierte Frau und seinen Sohn verlässt, nach Masuren fährt, und dort auf einem Inselchen in einem der zahlreichen Seen sich mit einer Blockhütte ein neues Zuhause aufbaut (wie David Henry Thoreau in „Walden“) und dort zusammen mit seinem ehemaligen Burschen Bildermann vom Fischen und Holzmachen lebt. Das Inselchen gehört einem altgedienten knorrigen General, mit dem Thomas von Orla in dessen naheliegendem Herrensitz Kontakt aufnimmt. In der zweiten Hälfte des Buchs, nachdem seine Frau gestorben ist, wird er zum Erzieher und Vorbild der Enkelin des Alten; zwischen ihr und ihm wird aus Zuneigung Liebe, aber es wächst auch die Kraft zum Verzicht allein auf Grund des großen Altersunterschieds. In einer Nebenhandlung nimmt Thomas Anteil am Leben eines anderen Einsiedlers, des Grafen Pernein, der auf seinem Gut lebt und experimentiert als einsamer Alchimist. Als er stirbt und Thomas zum Erben einsetzt, beginnt dieser im Labor des Verstorbenen mit dem Mikroskop und in Büchern zu forschen. Georg Lukács hat Wiecherts „altpreußischen Pietismus“ bemängelt. Ich kann den in dem folgenden Absatz nicht finden, sondern eher einen Panentheismus, wie ihn Hartmut Rosenau in seinem Buch „Die Theodizee“ umreißt:
„Langsam, von der Peripherie aus, begann er das Wunder der Schöpfung zu erkennen. Er nannte es mit diesem Namen, und der Name gewann einen immer höheren Klang für ihn. Aber er vermischte ihn nicht mit den Namen, die der Mensch dem Wunder gegeben hatte. Keine Dämonen und keine Götter drangen in den hellen Kreis, über dem die Linse stand. Er deutete das Unbegreifliche nicht, er benannte es nicht einmal, er verehrte es nur. Er lernte langsam, was ihm das Größte erschien: die Natur, ja, den Makrokosmos als etwas Zweckloses zu betrachten. Zwecke trübten das Licht und verwirrten die Linien. Auch so stand hinter allem noch immer das letzte Gesicht, aber es trug weder menschliche noch göttliche Züge. Es besaß weder Raum noch Zeit, noch gar eine sittliche Verklärung. Es war anders als der Erdgeist, und es ließ sich auch nicht beschwören. Das Beschworene würde wahrscheinlich mit Vernichtung strafen. Ein tiefes und ganz ruhiges Glück begann ihn langsam zu erfüllen …“
Ganz am Anfang berichtet ein Gefängnispfarrer dem Protagonisten, der Rat bei ihm sucht, wie ein zum Tode Verurteilter ihm die Worte entgegenschleuderte: „Ein Segen, dass es drüben keine Pfarrer geben wird.“
Und gegen Ende zieht Thomas das Fazit: „Ein Größeres stand über allem, ein Unerkennbares, eben `Das Ganze‘. Sein Anblick machte fromm, aber es gab weder Kirche noch Altar für die Frömmigkeit. Kein Bildnis, kein Gleichnis, nicht einmal einen Namen. Denn nicht einmal die Sterne waren das Letzte, nicht einmal die Nebel sich gebärender Sterne, wieviel weniger also der Mensch oder Gott, um dessen Bild er haderte und den er benannte, wie er selbst gern gewesen wäre: wissend, mächtig und gut.“
Der verstorbene Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat im Gespräch mit Günter Gaus 1966 bekannt: „Unsere Idealvorstellung war – damals gab es ein Buch von Ernst Wiechert, ‚Das einfache Leben‘; ich weiß, dass viele Leute damals ähnlich empfunden haben wie wir auch; dies wäre unser Ideal gewesen, ganz zurückgezogen zu leben von dem Getriebe der Welt.“
Das ist ein belletristischer Text, seine Begrifflichkeit ist nicht abgeklopft und erprobt. Mir erscheint es als Versuch, den Schöpfungsglauben (das letzte Gesicht) angesichts einer zweckfreien, also zufälligen, evolutionären Natur und einer katastrophalen Weltlage zu behaupten. Und ich könnte mir denken, dass Wiechert in Kriegs- und Katastrophenzeiten eine Chance hat, wieder an Ansehen zu gewinnen. Ist nicht sogar der Klimawandel nur ein berechtigtes Zurückschlagen der vom Menschen ausgebeuteten und missachteten Natur?
Kate Atkinson: Die Unvollendete
Roman, aus dem Englischen von Anette Grube
veröffentlicht am 15.08.22
„Sollte der Krieg nicht aus allen Frauen Pazifistinnen machen?“ Diese Frage stellt sich Sylvie, Mutter von Ursula Todd, der Heldin dieses 2013 erschienenen Romans, als sie die Begeisterung beim Kriegsbeginn 1914 auf einem Londoner Bahnhof erlebt. Soviel ich sehe, hat ihn nur die Frankfurter Rundschau von den überregionalen Blättern (als „meisterhaft“) rezensiert, dafür aber überschlagen sich regionale Zeitungen und auch die Rezensionen bei amazon (kann man ihnen trauen?) vor Begeisterung. Ursula Todd, einer gutbürgerlichen Bankangestelltenfamilie entstammend, muss immer wieder geboren werden, um den Risiken des furchtbaren 20. Jahrhunderts zu entgehen: der Spanischen Grippe und den Bombardements des zweiten Weltkriegs (sowohl auf deutscher wie auf englischer Seite), aber auch dem Ertrinken beim Baden im Meer, einer brutalen Abtreibung, einer Kohlenmonoxid-Vergiftung in der Nachkriegszeit. Aber sie lernt aus Fehlverhalten, zieht Schlüsse, hat „déjà-vu“, wird von Dr. Kellet belehrt, dass es ein Wiedergeborenwerden gibt, oder wird ganz einfach durch eine zufällig hinzukommende Person gerettet. Kate Atkinson beschreibt in „Life after Life“ (deutscher Titel: „Die Unvollendete“ – ein durchschaubares Marketingmanöver, um die berühmte Sinfonie Schuberts zu nutzen) die vor allem England, aber auch Deutschland betreffenden Katastrophen konsequent aus der Sicht der Frauen, die zuhause bleiben, für die Helden im Felde stricken, um sie dann als Ruinen oder gar nicht wieder zurückzuerhalten, die als zivile Hilfskräfte tätig werden im so brutal in der deutschen Literatur m.W. nirgends geschilderten Bombenkrieg, und in einer Lebensvariante Ursulas gerät sie 1930 als Freundin Eva Brauns in den engeren Kreis Hitlers und schießt auf ihn – eine andere und fürs britische Bewusstsein weniger beschämende Unity Valkyrie Mitford …
Warum ist dieses Buch in der überregionalen Presse so wenig beachtet worden? Weil es von einer erfolgreichen Krimiautorin stammt? Vielleicht. Weil es so vermessen ist, mit einem furchtbaren halben Jahrhundert abrechnen zu wollen? Keine Ahnung. Vielleicht aber auch, weil es mit Sterben und Tod ein unterhaltsames Spiel treibt, das der epischen Erzählweise zu widerstreben scheint – und tatsächlich ist es ein Buch aus dramatischem Geist, Computerspielen verwandt, in denen man, wenn man scheitert und stirbt, noch einmal vor vorn beginnen kann, aber auch dem Drama ganz allgemein ähnlich, in dem die Toten sich zum Schluss vorm Publikum verneigen. Und von ferne grüßt Harold Ramis‘ „Groundhog Day“ mit seinen Zeitschleifen …
Wie es Kate Atkinson gelingt, ein zugleich unterhaltsames und tiefes Buch zu schreiben, voller literarischer Anspielungen, skurriler Charaktere und amüsanter Dialoge, das lässt sich nur durch Selberlesen erkunden. Eins ihrer Stilmittel ist die Parenthese, durch die alles an Doppelbödigkeit gewinnt, Beispiel: „Es war wieder nicht Liebe, sondern sie empfand für Ralph die gleichen Gefühle, die sie für ihren Lieblingshund empfinden würde (und, nein, das hätte sie ihm nie gesagt. Manche Leute, viele Leute waren nicht in der Lage zu verstehen, wie sehr man einen Hund ins Herz schließen konnte).“ Gut übersetzt von Anette Grube. 585 Seiten aus dem Land und der Denkschule des Bard of Avon: Die Tiefe an der Oberfläche verstecken, Geschichte und Fiktion auf klärende Weise amalgamieren. Es ist ein Buch der Begegnungen mit uns selbst – und mit unseren (Groß)Eltern, die die unfassbare Zeit von 1910 bis 1967 durchlebten.
Szczepan Twardoch: Drach
Roman, übersetzt von Olaf Kühn
veröffentlicht am 22.09.23
Pindur schweigt. Pindur ist mir nah. Er packt Josef am Handgelenk, fest, als wollte er ihm etwas Wichtiges sagen, etwas von großer Bedeutung, sagt aber nichts, denn nichts hat Bedeutung.
Ich müsste erläutern, wer Pindur ist. Wer oder was da „mir“ sagt. Aber ich erläutere nur, dass Josef Magnor der Protagonist eines polnischen Romans ist mit dem Titel „Drach“, der wie ein Unwetter über den Leser hereinbricht. Der im Präsens erzählt ist, egal, ob es um Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft geht. Es gibt nur Gegenwart, über der ein Hauch von Ewigkeit liegt, in diesem Buch, obgleich über den einzelnen Kapiteln jeweils bis zu 29 Jahreszahlen stehen, in denen die Erzählerin sich bewegt. Eine Frau? Ist der Autor Szczepan Twardoch denn nicht ein Mann? Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Aber er wählt sich eine fiktive Erzählerin: die Erde. Und zwar weniger den Planeten (obgleich ein wenig auch den), mehr aber die Erdkruste, in der wir unsere Toten begraben, in der wir Schutz suchen in Schützengräben und in die der Bergbau seine Schächte und Stollen treibt, in denen „Menschenwürmer die schwarze Sonne aus meinem Leib kratzen“, d.h. Steinkohle schürfen. Und alle Männer in diesem Buch (bis auf wenige Ausnahmen) sind Bergleute. Und das seit Generationen. Bergleute im Bergbaugebiet von Oberschlesien, in dem die einen Deutsch, die anderen Polnisch sprechen, aber manche Polnisch Sprechende sind Deutsche und manche Deutsch Sprechende Polen. Und manche sprechen ein Pidgin-Deutsch oder Pidgin-Polnisch, und das wird Släsch oder Slaski oder Wasserpolnisch genannt (der Übersetzer Olaf Kühn hat Kostproben davon dankenswerter Weise ins besser verständliche Niederschlesisch übertragen). Und nach dem Ersten Weltkrieg, an dem Josef Magnor im Schützengraben vor Verdun teilnimmt, sollen Teile von Oberschlesien laut Versailler Vertrag an Polen abgetreten werden. Es kommt zu Erhebungen der Polen, die nicht benachteiligt werden wollen, zu Morden und Gewalttaten.
Ich will nicht versuchen, den Inhalt von „Drach“ (vier Generationen der Familien Magnor und Gemander) wiederzugeben, und den Roman zu bewerten. Seit sieben Jahren ist seine deutsche Ausgabe auf dem Markt, er wurde als meisterlich gelobt und auch viel über den Inhalt gesagt. Ich wollte herausbekommen, wie es dem Autor gelungen ist, seine Setzung, dass nicht er, sondern die Erde erzählt, glaubwürdig zu machen, und habe dafür die Suchfunktion meines E-Readers zur Hilfe genommen. Mit ihrer Hilfe habe ich festgestellt, dass die oben zitierte Figur, etwas sei von Bedeutung, zugleich aber ohne jede Bedeutung, sich an die 30mal in dem Buch findet. Eine andere Erdformel: sie sagt: „Zur gleichen Zeit“, fährt aber dann fort: „nur dreiundneunzig Jahre früher“ oder „fünfunddreißig Jahre später“. Diese Formel verwendet die Erde 50 mal und erzeugt so ein Gefühl von Zeit jenseits der Chronologie, berechtigt, wenn man bedenkt, wie winzig die Zeitabschnitte sind, in denen wir verkehren, vergleicht man sie mit dem Alter des Planeten. Und das auf dem Hintergrund der Botschaft des alten Pindur, dass Baum und Mensch und Stein und Tier dasselbige sind und dass die verwesenden Leichen als Saft in den Bäumen wieder aufsteigen, deren Blätter und Rinde die Rehe fressen, die dann ihrerseits sterben, wenn sie nicht geschossen und verzehrt und zu Ausscheidung werden, die wiederum der Erde zugutekommt, in Verbindung mit diesem ewigen Stoffwechsel von Werden und Vergehen, dessen Vermittlerin die erzählende Erde ist, verliert alles Bedeutsame wirklich jede Bedeutung, aller Tod ist nur ein Übergang wie auch alles Leben, und den Generationen von Bergleuten stehen Generationen von Rehen und Bäumen gegenüber. Es gelingt diesem Roman, ein Gefühl von tiefer, staunender Naturhörigkeit zu erzeugen. Nicht ohne Grund wird die Botschaft Pindurs als Evangelium bezeichnet, aber zugleich hervorgehoben, dass dieses Evangelium aus einer Zeit stammt, als noch keine Christen im Land waren, und das Kriegskapitel wird eingeleitet von der Schilderung des ungeheuerlichen Behemoth im Buch Hiob. Es ist ein ebenso beunruhigendes wie tröstliches Buch, eine aufwühlende Summe des 20. Jahrhunderts im Spiegel der polnisch-deutschen Welt Oberschlesiens, in der ein Ort bald Gliwice heißt, bald Gleiwitz – ein bedeutsamer Unterschied – und dennoch ohne jede Bedeutung.
Fanny Lewald: Jenny
Roman
veröffentlicht am 05.01.24
Eduard Meier, ein jüdischer Arzt im Jahr 1832, hat sich in ein christliches Mädchen verliebt und denkt darüber nach, ob er Christ werden sollte, um es heiraten zu können: „Warum sollte er nicht, wie tausend andere, einem Glauben entsagen, dessen Form allein ihn von der übrigen Menschheit trennte? Was band ihn an Moses und seine Gesetze? Es sträubte sich bei diesen ebenso viel gegen seine Vernunft als bei den Lehren Jesu. Warum nicht einen Aberglauben gegen den andern vertauschen …?“ Nur weil er sich dem jüdischen Volk unauflöslich verbunden fühlt, verwirft er diesen Gedanken anders als seine Schwester Jenny, die sich taufen lässt, um den geliebten protestantischen Theologen Reinhard zu heiraten. Aber zur Trauung kommt es nicht, weil sie kurz vor dem ersten gemeinsamen Abendmahl Glaubenszweifel befallen, die der künftige Pfarrer nicht akzeptieren kann.
Dieser 1843 erschienene Roman der Jüdin Fanny Lewald wurde bei Reclams Klassikerinnen neu herausgebracht – ein erstaunliches Buch – dramatisch, zwischen Zweifel und Glauben fein nuancierend, versucht es zwei Herausforderungen zugleich zu meistern: Die Emanzipation der Juden und die Emanzipation der Frau. Dies freilich unter materiell gesicherten bis teilweise luxuriösen Bedingungen: Eduards und Jennys Vater ist ein erfolgreicher Bankier, eins der Hauptprobleme Jennys ihrem künftigen Ehemann gegenüber ist es, sich ein Leben in der „humble abode“ (Jane Austen) eines evangelischen Pastors vorzustellen: Ohne Dienerschaft, ohne Equipage. Bedenkt man, dass Moses Mendelssohn sich noch außerstande sah, am aufgeklärten Montagsclub in Berlin teilzunehmen, weil bei ihren obligatorischen Essen die jüdischen Speiseregeln nicht eingehalten wurden, verwundert es nicht, dass Fanny Lewald dieses und andere praktische Probleme aus ihrem Buch völlig ausklammert, nur einmal macht sie deutlich, dass im Lebensumkreis der Familie Meier die Sabbatvorschriften zwar ein- aber nicht für zwingend verbindlich gehalten werden. Die Aufklärung hat tiefe Spuren im geschilderten Milieu hinterlassen, der Wechsel ins Christentum wird kaum in Frage gestellt, wenn Gefühle und materieller Vorteil dafür sprechen. Als Jenny ihre Religiosität einmal darstellt, warnt sie der künftige Pfarrer, der dann doch nicht ihr Ehemann wird, vor einem Abgleiten in den Pantheismus.
Die tiefgründige theologische und philosophische Erörterung von Glauben und Zweifel auf ethischer und ästhetischer Ebene mag ein Grund dafür sein, dass dieses zugleich sehr spannende und in Teilen hochemotional geschriebene Buch, das Fanny Lewald den Durchbruch als Autorin brachte, bis heute nicht verfilmt wurde – im Gegensatz etwa zu „Daniel Deronda“ von George Eliot, zweimal verfilmt, einmal als BBC-Serie – das sich ebenfalls sympathisierend mit der Emanzipation der Juden im 19. Jahrhundert befasst. Einer der Gründe mag der geistige Tiefgang von „Jenny“ sein, ein anderer der, dass Erich Pommer, in den 20er und 30er Jahren Deutschlands bedeutendster Filmproduzent, jüdisch war und sich gerade deshalb scheute, in einer antisemitisch aufgeladenen Atmosphäre dieses klar projüdische Buch zu verfilmen – obgleich es mit seinem tragischen Duellschluss eine ebenso gute Vorlage wäre wie die ebenfalls mehrfach verfilmte „Effi Briest“ Theodor Fontanes – der Fanny Lewald in seinen „Wanderungen“ mehrfach respektvoll erwähnt.
Als Eduard von der geliebten Clara erfährt, dass sie ihm entsagen muss, weil er sich nicht taufen lassen will, drängt sich ihm unwillkürlich die Frage auf, „ob in der Frauen-Natur wirklich eine höhere Leidensfähigkeit liege als in der des Mannes … Weil das Weib besser liebt, weil es nur an den Schmerz des Geliebten, nicht an sich selbst denkt und sich in dem Glück des andern vollkommen vergessen kann, schilt man es kalt und tröstet sich über den Gram, den man verursacht, mit dem alten Gemeinplatz, das Weib sei leidensfähiger als der Mann. Die Schmach fühlt man gar nicht mehr, den Frauen, dem sogenannten schwachen Geschlecht, eine Stellung im Leben angewiesen zu haben, die sie von Jugend auf an Leiden und Entsagungen gewöhnt …“ Das ist Feminismus at its best: Zwischen Selbstgerechtigkeit und berechtigter Empörung.
Die Nazis stellten 1933 nur wieder her, was vor 100 Jahren die Regel war, fügten Darwinismus und Rassismus hinzu – obgleich der Begriff Rasse auch bei Fanny Lewald schon auftaucht.
Hätten die Deutschen und Österreicher ihrem Antisemitismus schon damals abgeschworen, es hätte keinen Zionismus, keinen Holocaust, wahrscheinlich kein Israel und auch die heutigen unsäglichen Spannungen im Nahen Osten nicht gegeben.
Gut, dieses Buch aus der Versenkung hervorzuholen. Absolut lesenswert.
Anmerkung: Es gibt das Buch in billigeren antiquarischen Ausgaben, dann allerdings ohne das Nachwort von Mirna Funk.
Daniela Krien: Der Brand
Roman
veröffentlicht am 19.02.24
Das Coverbild von Brasilier, das zwei ferne Berittene mit vier Pferden vor rötlich brennendem Himmel zeigt, ließ mich an einen Text wie „Budjonnys Reiterarmee“ von Isaac Babel denken. Aber es kommt nur ein einziges Pferd in dem Buch vor, die 23jährige Stute Baila, und die wird von Peter Wunderlich, einem depressiven 55jährigen Literaturprofessor, am Halfter geführt, der in ihr seinen ganzen Trost findet, nachdem er den Liebeshalt an seiner Frau, der Psychologin Rahel, verloren hat. Aber warum? Sie ist ihm in einer Sache „in den Rücken gefallen“, die ihn zutiefst aufgewühlt hat. Er lehrt deutsche Literaturgeschichte an der TH Dresden, und bei der Ankündigung eines Seminars über „Geschlechterrollen in der Literatur des 19. Jahrhunderts“ kam es zum Aufstand einiger Student:innen: Das sei eine Fragestellung, die auf die üblichen binären Klischees hinauslaufe, und als er sich damit rechtfertigt, auch in Klischees stecke oft was Wahres, z.B. sei reines Machtstreben Frauen im Gegensatz zu Männern oft zuwider, wird er als Chauvinist beschimpft, weil er Frauen für fehlenden Machthunger lobe, statt sie darin zu bestärken, nach mehr Macht zu streben. Besonders hervor tut sich dabei Olivia P., die Wunderlich weiter als Frau anredet, weil sie als Frau in seiner Liste steht, sie/er aber besteht darauf, nicht binär zu sein und will sich als Frau nicht anreden lassen. Als Wunderlich das seiner Frau erzählt, hätte sie ihn fast einen Krümelkacker genannt, sagt dann aber: „Wer weiß, was die arme Person für eine Leidensgeschichte hinter sich hat. Nenn sie doch einfach so, wie sie will.“ Das war der Moment, in dem sie ihm in den Rücken fiel. Er sah sie mit „fremden“ Augen an, ging hinaus. Von da an „wurde es still zwischen ihnen.“
Der Presse entnimmt Rahel, dass Olivia P. einen wahren Shitstorm in den sozialen Medien gegen ihren Mann ausgelöst hat. Die Presse benutzt den Streit für eine Abrechnung mit dem Osten: „Die ehemals Indoktrinierten hätten das offene und freie Denken immer noch nicht gelernt … Der ganze entsetzliche Mist, den sie alle nicht mehr hören konnten.“ Und in diesem Konflikt fällt seine Frau ihm in den Rücken; er schläft nicht mehr mit ihr, und als sich nun die Möglichkeit anbietet, auf einem verlassenen Bauernhof in der Uckermark Ferien zu machen (das gebuchte Ferienhaus in Oberbayern ist abgebrannt), übernehmen sie es, den Hof und seine Tiere zu hüten, solange Ruth, eine alte Freundin Rahels, ihren Mann Victor, der einen Schlaganfall erlitten hat, in der Reha betreut.
Ohne den auslösenden Konflikt zwischen Genderism und Konvention weiter zu verfolgen, beschreibt die Autorin die langsame und zögernde Wiederannäherung zwischen den Ehepartnern über gemeinsame Essensplanung, Zusammenarbeit in der Küche, gemeinsames Schwimmengehen. Rahel erinnert sich daran, was sie an Peter einst geliebt hat: Seine Klugheit, seine Attraktivität, seine Verlässlichkeit, seinen Humor. „Nichts davon hat er verloren. Und darum will sie ihn nicht verlieren.“ Außer mit der Stute Baila freundet er sich mit einem fluglahmen Weißstorch an, mit einer einohrigen Katze und den Hühnern. Die Pandemie wittert im Hintergrund, sie hat Peter weitgehend von seinen Lehrpflichten befreit. Rahel würde sich des Gedankens gern erwehren, alles werde immer schlimmer: „Doch es ist nicht wegzudiskutieren – die Wälder sterben, das Eis schmilzt, die Menschen werden nicht klüger. Und weil es so viele Menschen gibt, mehr als je zuvor gegeben hat und sie immer noch mehr werden, wächst der Schaden, den sie anrichten, ins Unermessliche. Die Idee, dass die Seuche nichts anderes sei als ein längst fälliges Korrektiv, ist ihnen schon im Frühjahr gekommen.“ Offenbar setzt gemeinsames Nachdenken und Miteinanderreden wieder ein, ein paar Flaschen Rotwein helfen nach – und Nähe wird wieder möglich, befördert auch durch das Miterleben von Scheidungsabsichten in der nächsten Generation.
Neben der Wiederbelebung ihrer Ehe wird Rahel Wunderlich durch häufige Besuche im Atelier des Bildhauers Victor auch zur Suche nach ihrer Identität angeregt, denn dort findet sie viele Zeichnungen Victors, die ihre Mutter Edith und sie selbst als Kind darstellen. Rahel weiß nicht, wer ihr Vater ist, Edith behauptet, dass alles Suchen nach dem attraktiven Studenten, der eine Nacht mit ihr verbrachte und dann verschwand, vergeblich gewesen sei. Für Rahel wird es immer wahrscheinlicher, dass Victor ihr Vater ist, und als Victor beim Baden in der Ostsee ertrinkt, teilt Ruth ihr mit, sie habe diesen Gedanken auch gehabt, habe Victor einmal direkt gefragt, aber er habe es bestritten, doch er habe immer gewollt, dass Rahel den Hof Dorotheenfelde in der Uckermark bekommt.
Und noch auf einer anderen, ideologischen Ebene geht es Rahel – und Peter – um ihre Identität: Sie haben die „Beutemacher“ aus dem Westen erlebt, die Eltern des Schwiegersohns waren „Wendeverlierer“ („Das Übliche: Betrieb geschlossen, Job weg, Anschluss verpasst, Krankheit, Depression usw.“), und nicht nur nach dem Shitstorm gegen Peter erleben sie eine Presse, die nicht von Tatsachen berichtet, sondern ihnen „Konstrukte“ aufschwatzt, mit denen sie nichts anfangen können. Für viele von uns im Westen bedeutet „Nie wieder!“: „Nie wieder Faschismus!“, für Peter ist das zentrale Trauma die Bombardierung Dresdens, was an der Empörung deutlich wird, mit der er den Spruch „Bomber Harris do it again!“ auf einem Studenten-T-Shirt wahrnimmt. Peter wundert sich, dass sein Sohn als Bundeswehrsoldat seinen Kopf hinhalten soll „für diesen Staat! Mit seinen Verboten, Geboten und Verordnungen bis in die tausendste Verästelung, der von echter Freiheit überhaupt nichts hält.“ Passend dazu hat Peter sich den Essay „Der Waldgang“ von Ernst Jünger mit in die Ferien genommen, in dem Jünger, noch geprägt durch die Erfahrung der von ihm selbst mit herbeigeführten Nazizeit, alle Staatlichkeit, auch die der jungen Bundesrepublik, verdächtigt, die individuelle Freiheit zu vernichten, und dass man sich dem nur durch das In-den-Wald-Gehen, durch intensivste Besinnung auf sich selbst, also durch eine Art innerer Emigration entziehen kann. Ist das uckermärkische Idyll, in dem Rahel und Peter ihre Ferien verbringen, nicht ein solcher Rückzugsort? Ein anderes Ferienbuch Peters sind Pasolinis Freibeuterschriften. „Pasolini nennt den Konsum den neuen Faschismus,“ sagt er, und Rahel bewundert ihn für seine „Leidenschaft des Denkens.“ Rahel und Peter sind keine Wendeverlierer, er hat eine Professur, sie hat eine offenbar gutgehende psychotherapeutische Praxis – aber sie fremdeln noch mit dem ihnen übergestülpten System, das ihre Eltern in Verkennung seiner Brutalität so naiv waren herbei zu demonstrieren.
Nicht völlig bruchlos hat die Autorin die beiden Motive Identitätssuche und Wiederbelebung einer in die Jahre gekommenen Ehe miteinander verschmolzen und auch noch den Besuch der Tochter Selma mit ihren beiden ungezogenen Söhnen wie ein Scherzo eingearbeitet. Ein lesenswerter Roman, gedankenreich, erfahrungsgesättigt – und spannend ohne Verbrechen!
Nadia Owusu: Aftershocks
Über Erschütterungen und Identitätssuche, Übersetzung: Lisa Kögeböhn
veröffentlicht am 10.05.24
Nadia Owusu ist Tochter einer Armenierin und eines Ghanaers. Die zwei in ihr vereinten Identitäten sind extrem weit voneinander entfernt. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf meinen Beitrag Der Mulatte (im Buch woke verfremdet zu M*latte). Ihre Mutter verließ sie, als sie zwei Jahre alt war. Das war der erste Schock. Sie wuchs bei ihrem Vater an ständig wechselnden Orten, in ständig wechselnden Schulen auf, denn ihr Vater arbeitete für die UN. Als sie 13 war, verlor sie ihn und damit ihren einzigen Halt. Das war der zweite Schock. Dann teilte ihre Tante ihr mit, dass ihr Vater nicht an einem Hirngeschwür, sondern an AIDS gestorben war; sie hatte geglaubt, ihn zu kennen, und merkt jetzt, dass das nicht stimmt. Das ist der dritte Schock. In ihrer Autobiografie „Aftershocks“ (Nachbeben) zieht sie sich in einen blauen Sessel vom Trödel zurück, den sie in ihre Wohnung wuchtet, um, in ihn gekuschelt, herauszufinden, wer sie ist, wohin sie gehört. Ich konnte dies Buch nicht lesen, ohne selbst in eine Identitätskrise zu verfallen. Ich las im Netz, dass der Ötzi nicht, wie man bisher angenommen hat, weiß war, sondern braun. Auch ich fühle mich braun, seit ich „Aftershocks“ gelesen habe. Ähnlich wie Christmas, der Protagonist in Faulkners Roman „Licht im August“ weiß ich nicht mehr, wohin ich gehöre. Nadia Owusu schreibt:
„Ich habe in Katastrophen gelebt und Katastrophen haben in mir gelebt. Mein Anteil an Naturkatastrophen war nebensächlich, mein Anteil am Krieg abstrakt. Während der Terroranschläge in Manhattan war ich wie betäubt, trotzdem trugen mich meine Beine. Fast immer fand ich eine Hand, die ich halten konnte.
Wenn ich mir ein Erdbeben vorstelle, sehe ich ein Erdbeben vor mir. Und ich sehe den Rücken meiner Mutter vor mir, als sie geht. Ich sehe den Tumor meines Vaters vor mir und Flugzeuge, die in Wolkenkratzer fliegen. Wenn ich mir ein Erdbeben vorstelle, sehe ich Waisen in Armenien und Kindersoldat*innen vor mir. Ich sehe mich selbst, sicher hinter bewachten Mauern. Ich sehe eine Abwesenheit. Ich höre Donner und Stille. Ein Erdbeben birgt Trauma und Verletzbarkeit: für die Erde, für mich und dich.
Ein Erdbeben ist Erde, die bricht, und ein Herz, das bricht. Es ist Reibungskraft und literarisches Werkzeug. Eine Verwerfung ist ein Schwachstelle. Der Körper einer Frau ist eine Schwachstelle. Eine Wunde ist eine Schwachstelle, die ich einfach nicht in Ruhe lassen kann. Manche Wunden heilen nie.“ (S. 297)
Nadia Owusu vermittelt auf fast jeder Seite Erkenntnis und Verständnis. Wie sie in Addis-Abeba ein behütetes Diplomatenkind-Dasein führt, während hinter den Mauern der Bürgerkrieg tobt. Wie sie bestätigt, dass ihre schwarze Schulkameradin Agatha stinkt, nur um als höherstehend in der Farbhierarchie anerkannt zu werden. Wie sie lernt, dass sie aus einer ghanaischen Familie stammt, die sich am Sklavenhandel bereichert hat. Wie sie sich rennend und flüchtend aus dem Staub der zusammenbrechenden Twin Towers rettet …
Rutger Bregman: Im Grunde gut
Eine neue Geschichte der Menschheit, aus dem Niederländischen von Ulrich Faure
veröffentlicht am 05.06.24
Als sich um 1900 Darwins Lehre von der Evolution nicht nur bei Gelehrten, sondern auch bei einfachen Menschen durchsetzte und sogleich in sozialdarwinistischer Weise gedeutet und missbraucht wurde, erschien das Buch „Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt.“ Sein Autor: Ein gefeierter russischer Geograf, Fürst Pjotr Kropotkin, der nichts für überflüssiger hielt als den Staat und deshalb als Anarchist bezeichnet werden darf, obgleich er einer der sanftesten Menschen war. Der Anthropologe Ashley Montagu nennt Kropotkins Schrift „eines der Welt größten Bücher“, Gustav Landauer hat es ins Deutsche übersetzt und Henning Ritter 1976 neu herausgegeben. Dieses leidenschaftlich für die sozialen und guten Eigenschaften des Menschen eintretende Buch hat einen nicht weniger leidenschaftlichen Nachfolger gefunden: „Im Grunde gut“ lautet der deutsche Titel der Schrift des Niederländers Rutger Bregman (ins Deutsche übersetzt von Ulrich Faure und Gerd Busse), und hat den Untertitel „Eine neue Geschichte der Menschheit“ in Anspielung auf Yuval Noah Hararis „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ – und eben dieser Harari hat gesagt: „‘Im Grunde gut‘ hat mich dazu bewegt, die Menschheit aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Ich kann es nur empfehlen.“
In Kapitel 10 denkt Bregman über Empathie nach und kommt zu dem Schluss: „Der Mechanismus ist immer derselbe: Wir setzen unsere Lieben ins rechte Licht und werden blind für die Perspektive unserer Gegner, die außerhalb unseres Blickfeldes stehen“. Dieser Mechanismus hat uns „in die netteste und grausamste Spezies auf dem Planeten verwandelt. Es ist eine unbequeme Wahrheit: Empathie und Fremdenfeindlichkeit sind zwei Seiten derselben Medaille.“ Ist es wirklich eine unbequeme oder nur eine banale Wahrheit? Empathie gegenüber Kindern und Tieren zu zeigen, ist geradezu ein Klischee im Verhalten von Autoritären, man denke nur an Hitlers Hunde und Geert Wilders‘ Katzen. Ist es auch eine unbequeme Wahrheit, dass Soldaten nicht gern das Bajonett benutzen und sogar das Schießen mit dem Gewehr vermeiden, weshalb die Kriegsführung die Distanz und Anonymität des Tötens immer weiter vergrößert? Steckt dahinter eine angeborene Scheu vorm Töten, die nur in Hollywoodfilmen ständig ignoriert wird, als gäbe es sie nicht? Ist das berühmte und vielfach im Unterricht verwendete Buch „Der Herr der Fliegen“ von William Golding eine realistische Fiktion oder beruht sie auf dem Vorurteil, der Mensch sei von Natur aus schlecht und die Zivilisation sei nur eine dünne Schicht, die das zudecke, aber im Moment der Katastrophe bräche das Böse im Menschen mit Urgewalt hervor? So hat Hobbes es dargestellt in seinem „Leviathan“, der nur allzu gut in das christliche Weltbild von der Erbsünde passte – und erst Jean Jacques Rousseau hat die Kühnheit besessen, zu behaupten, der Mensch sei von Natur aus gut, nur die Zivilisation habe ihn verdorben.
Ein aufregendes und sogar unterhaltsam zu lesendes Buch ist Rutger Bregman gelungen, ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen, als ich einmal damit angefangen hatte, eine wirklich gute und notwendige Ergänzung zu Yuval Noah Hararis „Kurzer Geschichte der Menschheit“. Freilich muss ich den optimistischen Schluss mit den Worten in Frage stellen, mit denen Henning Ritter Kropotkins „Gegenseitige Hilfe“ kritisiert: Ist es ein „Optimismus, der sich selbst die Gründe vorgibt?“
Aufmerksam geworden bin ich auf das Buch durch eine Veranstaltung über Kenia in der Zukunftsstiftung Entwicklung bei der GLS-Bank in Bochum, dort wurde es mehrfach zitiert. Absolut lesenswert in einer Zeit, in der „Gutmensch“ zu einem Schimpfwort geworden ist.
Ulrich Friedrich Opfermann: „Stets korrekt und human“
Der Umgang der westdeutschen Justiz mit dem NS-Völkermord an den Sinti und Roma
veröffentlicht am 10.07.23
„Und diesem System des organisierten Rassismus hat mein Vater gedient“ – ging es mir immer wieder durch den Kopf, als ich in diesem Buch las. Der Autor hat ihm einen Text von Brecht vorangestellt:
So endet die Geschichte einer Reise,
Ihr habt gehört und ihr habt gesehen.
Ihr saht das Übliche, das immerfort Vorkommende.
Wir bitten euch aber:
Was nicht fremd ist, findet befremdlich!
Was gewöhnlich ist, findet unerklärlich!
Was da üblich ist, das soll euch erstaunen.
Was die Regel ist, das erkennt als Missbrauch
Und wo ihr den Missbrauch erkannt habt,
Da schafft Abhilfe!
Das Buch lässt mich verstört zurück; denn es konfrontiert mich nicht nur mit dem rassistischen Unrecht an den Sinti und Roma in der Nazizeit, sondern auch mit der Unfähigkeit und dem Widerwillen, mit dem die Justiz der 50er und 60er Jahre sich nahezu weigert, es rechtlich aufzuarbeiten. Tausende Sinti und Roma sind von deutschen Behörden sterilisiert und ins „Zigeunerlager“ Auschwitz deportiert worden, aber zu seiner/ihrer Verantwortung bekannt hat sich niemand, ja, über Eva Justin, eine der Hauptverantwortlichen, wurde im Sammelverfahren zum „Zigeunerkomplex“ (1958-1970) von Zeugen gesagt, sie sei ein „sehr gebildetes, charakterlich einwandfreies Fräulein“ gewesen, das „von diesen andersartigen Menschen“ „mit großer Liebe“ gesprochen habe. Sie sei „wegen ihrer Zigeunerliebe“ geradezu belächelt worden. Sie habe sich „stets korrekt und human“ verhalten. Dass auch Eichmann ein gebildeter und charakterlich einwandfreier Beamter war, wissen wir, Hannah Arendt hat uns gelehrt, dass das Böse nicht die Zähne fletschen muss, sondern ganz banal, brav und angepasst auftreten kann, und so dürfte es überwiegend aufgetreten sein seitens der Rassenhygienischen und bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle (RHF), die zum Reichsgesundheitsamt gehörte und von Robert Ritter und seiner Stellvertreterin Eva Justin geleitet wurde. Beide setzten ihre Karrieren nach dem Krieg in Frankfurt fort, „reinigten“ dafür ihre Lebensläufe, die auf Fritz Bauers Initiative eingeleiteten Ermittlungen gegen Eva Justin wurden eingestellt, weil die Sterilisationen verjährt waren und die Kenntnis der mörderischen Folgen ihrer Deportationsverfügungen ihr nicht nachgewiesen werden konnten.
Um das Zentrum des Sammelverfahrens herum hat Opfermann eine Fülle von Anläufen der Justiz zusammengetragen, das den Sinti und Roma angetane Unrecht zu sühnen, aber in sehr vielen Fällen wurde bereits das Vorverfahren eingestellt oder es kam zu Freisprüchen wegen Beweismangels, und viele zu Freiheitsstrafe Verurteilte wurden vorzeitig entlassen. Zugleich hat der Autor in Umrissen eine Mentalitätsgeschichte der verdrängerischen 50er Jahre versucht, in denen eine so halbbittere Komödie wie Staudtes „Rosen für den Staatsanwalt“ mit ihrem Hinweis auf die Nazivergangenheit des Protagonisten bereits eine Sensation war. Die romantische Konnotation von „Zigeunern“ mit Erotik, virtuoser Musik und Tanz ist uns allen vertraut und wird uns immer wieder durch Bühnenwerke wie „Carmen“ und „Der Zigeunerbaron“ eingeimpft, und umso grauenhafter ist es dann zu lesen, wie eine deutsche Vergeltungseinheit in ein russisches Dorf kommt, in dem mehreren Roma-Familien Kontakte zu Partisanen vorgeworfen wurden:
Bei minus 30 Grad Frost wurden sämtliche Roma halbbekleidet aus ihren Häusern getrieben und auf eine Brücke am Dorfeingang gestellt. Die Familien wurden gezwungen, vor den Augen des versammelten Dorfes zu tanzen, ehe sie aus drei Maschinengewehren erschossen wurden. Nach der Erschießung mussten die Dorfbewohnen die Leichen begraben. Ein zehnjähriger Junge, der bei der ‚Aktion‘ lediglich an der Hand verwundet worden war, versuchte vergeblich, mit Hilfe der Dorfbewohner zu fliehen. Er wurde gefangen und lebendig begraben.
Kann man der Forderung des Tacitus an den Historiker, sine ira et studio zu berichten, angesichts einer solchen Szene treu bleiben? Opfermann kommentiert: „Dass eine Mordaktion von den Tätern als groteskes Schauspiel mit Opfern in einer Art von Clownsrollen und mit Zuschauern wie bei einer öffentlichen Veranstaltung inszeniert wurde, begegnet in den Quellen zum deutschbesetzten Osten immer wieder. Die deutschen Täter pervertierten dabei Zigeunerbilder aus dem mitteleuropäischen romantischen Repertoire. Sie denunzierten ihre Opfer auf die brutalstmögliche Weise, bevor sie sie umbrachten. Sie zeigten sich in solchen Situationen eher als Lust-, denn als Hassmörder.“
Kann man da Carmen ohne Erschauern noch singen hören:
Die Liebe von Zigeunern stammt,
fragt nach Recht nicht, Gesetz und Macht.
Das Buch ist von Heidelberg University Publishing (Heiup) dauerhaft ins Netz gestellt worden.
Besonders passend heute am 2. August: Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma.
Und der Geburtstag meiner lieben allzu früh verstorbenen Tochter Julia.
Charlotte Link: Sechs Jahre
Der Abschied von meiner Schwester
Veröffentlicht am 14.03.25
„Ich habe dir, als du noch hier warst, viel zu selten gesagt, wie sehr ich dich bewundere. Vor allem für die Tapferkeit, mit der du deinen Weg gegangen bist. Selbst als es niemanden mehr gab, der dir noch Hoffnung machte, als dir ein Tod bevorstand, der Ersticken hieß, bist du aufrecht geblieben. Du hast so selten geklagt oder geweint. Du hast dein Schicksal mit größter Würde und unglaublicher innerer Stärke angenommen.“
Mit diesen Worten verabschiedet sich Charlotte Link in ihrem Buch „Sechs Jahre“ von ihrer an Krebs und Lungenfibrose 2012 verstorbenen Schwester Franziska. Ich kann ihn wortgleich auch auf meine Tochter Julia beziehen, die an einem Sarkom mit Lungenmetastasen 2024 starb. Der Leidensweg Franziskas zog sich über sechs Jahre hin; der meiner Tochter über sechs Monate; ich frage mich, was grausamer war. Furchtbar das Erleiden der grässlichen Nebenwirkungen von Chemotherapien, die sich dann als wirkungslos erweisen. Furchtbar die (zum Glück seltene) Begegnung mit Ärzten und Pflegepersonal ohne jede Empathie, furchtbar die Angst, in die Erinnerungsfähigkeit der erst zweijährigen Tochter nicht mehr vorzudringen.
Erstaunlich aber das Zusammenwachsen der Angehörigen zu einer Kampfgemeinschaft – wie auch Charlotte Link es beschreibt. Sie ist eine gewiefte Krimiautorin, und ihr handwerkliches Geschick schimmert auch in diesem ihrem einzigen autobiografischen Werk durch. Obgleich man als Leser von Anfang an weiß, dass es auf den Tod der über alles geliebten Schwester hinausläuft, ist es spannend von Anfang bis Ende – wie eine Tragödie von Shakespeare, der wir auch gebannt folgen, obgleich wir das Ende voraussehen.
Wie oft haben wir uns gefragt: Sollten wir es nicht mit einer alternativen Therapie versuchen, versucht haben? Hätte ihr das nicht die allzu nebenwirkungsreichen Qualen der Schulmedizin erspart? Auch darauf gibt Charlotte Link eine Antwort: Sie und ihre Familie haben es nämlich versucht und sind an einen (namentlich nicht genannten) Mediziner geraten, der Hyperthermie und Misteltherapie im Verbund praktizierte – und nur hinter dem Geld her war. Diese zynische Bereitschaft, aus der Angst und Sorge von Kranken und ihren Angehörigen ordentlich Geld herauszuschlagen, dürfte im Bereich der alternativen Therapien besonders häufig anzutreffen sein. Und Gutes bewirkt hat auch dieser Ausflug in die Alternativmedizin offenbar nichts. Ja, die Frage stellt sich: Darf Lebensverlängerung, wenn sie nur Leidensverlängerung ist, das oberste Ziel sein?
Wir haben, zwölf Jahre nach Franziskas Tod, große Hoffnungen auf Neuerungen der Krebstherapie gesetzt, insbesondere auf Immun- und Antikörpertherapie, wir glaubten der Krebs ließe sich „bändigen“ und dauerhaft in Schach halten. Solche Fälle gibt es – aber Julias Krebs triumphierte. Ein Loblied singen müssen wir auf die ambulante Palliativ-Versorgung am Schluss – Julia konnte bis kurz vor ihrem Tod zu Hause bei Mann und Töchterchen sein und starb dann, umgeben von ihren Liebsten im Mildred-Scheel-Haus der UKK.
Ich kann dieses Buch Angehörigen und Hinterbliebenen von Schwerkranken nur empfehlen. Charlotte-Link-Fans, die sich blutrünstige Verwicklungen in englischen Hochmooren erhoffen, rate ich ab. Dies Buch beruht nicht auf Fiktion, sondern auf der erbarmungslosen Wirklichkeit selbst.
Hermann Broch: Die Schlafwandler
Die Trilogie schildert am Beispiel ihrer jeweiligen Helden drei fragwürdige, letztlich scheiternde Karrieren in den Jahren 1888, 1903 und 1918. Sie sind nur lose mit einander verbunden und können unabhängig von einander gelesen werden.
Als ich mit 12 Jahren ins Schaufenster unseres Buchhändlers guckte, faszinierte mich ein ausgestellter Titel: „Verlust der Mitte“ von dem Kunsthistoriker Hans Sedlmayr. Als ich das Buch dieses Titels später las, war ich enttäuscht. Ich hatte in Pariser Galerien den Tachismus (Wols) kennen und schätzen gelernt, und fand es ungerecht und voreilig, wenn nicht gar leichtsinnig und reaktionär, der modernen Kunst die Legitimation so abzusprechen, wie Sedlmayr es tat. War die Mitte, also der christliche Glauben als Zentrum und Bezugspunkt aller europäischen Kunst wirklich verloren? War er nicht bewusst aufgegeben und abgestreift worden wie eine lästige Fessel? Hermann Brochs Romantrilogie „Die Schlafwandler“, 1930 erschienen, stellt nun ebenfalls einen „Zerfall der Werte“ fest und analysiert ihn in mehreren glänzenden Essays im 3. Teil: „Huguenau oder die Sachlichkeit“. Aber im Gegensatz zu Sedlmayr beklagt Broch dies nicht als Verlust, sondern beobachtet es nur und sieht, wie die moderne Kunst daraus z.B. im Stil der „Neuen Sachlichkeit“ ihre Lehren zieht, ja, er zieht sie selbst, indem er in „Huguenau oder die Sachlichkeit“ mit konventioneller Erzähltradition bricht und ein so komplexes Romangebilde verfasst, dass nur der Basler Rhein Verlag, der auch die Übersetzung von James Joyces „Ulysses“ veröffentlichte, sich an das Manuskript herantraut. Und sogleich muss ich mich der Frage stellen, ob ich diesem Monster von einem Roman als Rezensent gewachsen bin. Nein, bin ich nicht, und deshalb beschränke ich mich auf den zweiten Teil: „Esch oder die Anarchie“, der im Jahr 1903 spielt und nur locker mit dem ersten Teil („Pasenow oder die Romantik“ 1888) verknüpft ist, so dass man ihn als selbständigen Roman lesen kann.
Aber bevor ich verrate, warum ich dieses Buch mag, möchte ich warnen. Wer zusammenzuckt, wenn eine schwarze Frau Negerin genannt wird, wer den Ausdruck „warmer Bruder“ für einen Schwulen unerträglich findet, wer eine Liebesszene, in der der Held die Heldin so massiv bedrängt, dass sie später „me too!“ ausrufen könnte, der nehme dieses Buch nicht zur Hand. Ich erinnere mich an meinen 1909 geborenen schwulen Onkel, der mir, als ich ihn auf seine Eleganz ansprach, mal kichernd gestand: „Ich bin eben ein warmer Bruder!“ Er schien diesen Begriff für einen Ehrentitel zu halten.
„Esch oder die Anarchie“ spielt in der Zeit Ravachols und Bakunins, berühmter Anarchisten und zahlreicher Attentate auf führende Politiker; und sein Held kann sich in der Tat über nichts so sehr empören, wie über eine Polizei im Dienst des Kapitals und des Staates, die einen tüchtigen und alles andere als staatsfeindlichen Gewerkschafter wie Martin Geyring verhaftet und einbuchtet.
Zentral ist die Liebesgeschichte zwischen dem gefeuerten Buchhalter August Esch und der verwitweten Wirtin einer Kölner Rheinschifferkneipe, Gertrud Hentjen, die von ihren Stammgästen nur liebevoll „Mutter Hentjen“ genannt wird, obgleich sie keine Kinder hat. „Wenn dann Mutter Hentjen abends ihren Platz am Büfett eingenommen hatte, pflegte sie sich manchmal umzuwenden und die blonde Frisur, die wie ein kleiner steifer Zuckerhut auf dem runden, schweren Schädel saß, vor dem Spiegel abzutasten.“ Vormittags wird sie so geschildert: „Sie war noch in morgendlicher Arbeitskleidung, hatte eine große blaue Kattunschürze dem Rock vorgebunden und auch das abendliche Mieder hatte sie noch nicht angelegt, so dass ihre Brüste wie zwei Säcke in der breitkarierten Barchentbluse lagen.“ Sie wird als banaler Alltagsmensch mit Alltagssorgen geschildert, und auch Esch, der sich um sie bemüht, ist alles andere als ein Beau, achtmal (Suchfunktion kindle) ist im Gesamtroman von seinem „Pferdegebiss“ die Rede, das er lachend, im Zorn oder aus Ekel entblößt oder „in die fleischige Achsel“ seiner Geliebten schlägt. Mit dem Scharfblick, aber auch der Grausamkeit des akademisch gebildeten Exunternehmers schildert Broch hier den Alltag der unteren Mittel- oder oberen Unterschicht.
Der Gewerkschafter Geyring gibt Esch den Tipp sich in Mannheim bei der Mittelrheinischen Reederei zu bewerben. Das klappt, Esch wird in Mannheim das, was man im Hamburger Hafen Tallyman nennt, Kontrolleur der Schiffsbe- und Entladung, macht Bekanntschaft mit dem Jongleur und Messerwerfer Teltscher, Künstlername Teltini, und seiner ungarischen Assistentin Ilona, die kaum Deutsch spricht. Als Geyring bei einem Streik wegen aufrührerischer Reden eines anderen, die er nicht unterbunden hat, verhaftet und eingebuchtet wird, ist Esch so sauer auf die mittelrheinische Reederei und ihren schwulen Chef Eduard von Bertrand, dass er hinschmeißt und mit dem Plan, eine Variéténummer mit Ringerinnen, zu denen auch eine Negerin gehören soll, aufzubauen, nach Köln und zu Mutter Hentjen zurückkehrt. „In jener außerordentlichen Bedrängnis, die jedem Menschen auferlegt ist, wenn er, der Kindheit entwachsen, zu ahnen beginnt, dass er einsam und brückenlos seinem einstigen Tode entgegenzugehen hat, in dieser außerordentlichen Bedrängnis, die eigentlich schon eine göttliche Furcht zu nennen ist, sucht der Mensch nach einem Genossen, damit er mit ihm Hand in Hand dem dunklen Tore zuschreite, und wenn er die Erfahrung gemacht hat, wie lustvoll es unleugbar ist, mit einem anderen Wesen im Bette zu liegen, so meint er, dass diese sehr innige Vereinigung der Haut hindauern könne bis zum Sarge.“ Esch überredet Mutter Hentjen, mit ihm zu einer Weinauktion nach St. Goar zu fahren, und wie auf dieser Reise mit Bahn und Schiff die Männerverachtung der Witwe im Konflikt mit ihrer Liebessehnsucht zur Lähmung ihres Ich führt, das ist ein Lesebuchbeispiel für den Kampf zwischen Es und Überich, ich könnte es seitenweise zitieren: „Dem Versuch, sie an sich zu ziehen, leistete ihr breiter Körper in dem Fischbeingehäuse steifen Widerstand und die Hutnadeln auf ihrem wackelnden Kopf bedrohten sein Gesicht. Kurz entschlossen schob er ihren Hut zurück, der mitsamt der Frisur nach hinten rutschend ihr das Aussehen einer Betrunkenen verlieh. (…) Dann küsste er die Wange, die an seinem Mund vorbeiglitt, und schließlich nahm er den runden schweren Kopf in die Hand und drehte ihn zu sich. Sie erwiderte den Kuss mit trockenen dicken Lippen, etwa wie ein Tier, das seine Rüsselschnauze gegen eine Glasscheibe drückt.“
Des Weiteren ist Esch von dem Plan besessen, mit seinen Ringerinnen per Ozeandampfer in die USA zu reisen, angeregt von Arthur Holitschers Sachbuch: „Amerika heute und morgen“, aus dem auch Franz Kafka, als er seinen Roman „Amerika“ schrieb, Anregungen bezog. Unheimlich die Passagen, in denen sich der homophobe Esch ins Milieu der Homosexuellen begibt und nach Badenweiler reist, um den verhassten Großkapitalisten Bertrand, diesen „feinen warmen Bruder“, erpresserisch zu zwingen, sich für die Freilassung des inhaftierten Freundes Geyring einzusetzen. Dem entzieht sich Bertrand durch Suizid, die Amerikapläne von Esch und Mutter Hentjen lösen sich in Luft auf, Mutter Hentjen renoviert ihre Kneipe, sie heiraten und Esch findet wieder eine Stelle als Buchhalter – ein Schluss, lustig, traurig und resigniert wie der von Voltaires „Candide“.
Und sind nicht auch wir Schlafwandler? Wir gießen neuen Wein in alte Schläuche, wälzen uns in romantischen Naturgefühlen, wollen nicht zur Kenntnis nehmen, dass die Natur von uns längst so heruntergewirtschaftet wurde, dass sie unsere Dichtung hohnlachend zurückweist? Oder wir sind zu Zynikern geworden und amüsieren uns nach dem Motto „Jetzt gerade“ über eine zugrunde gehende Welt, indem wir im Kokon unserer Träume verharren …
Daniel Speck: Jaffa Road
Der deutsche Soldat Moritz wird Ende des Zweiten Weltkriegs in Norafrika fahnenflüchtig, rettet sich mit seiner jüdischen Geliebten Yasmina nach Palästina, wird dort in den Konflikt zwischen jüdischen Neubürgern und Palästinensern verwickelt. Als er tot in seiner Garage gefunden wird, stellt sich die Frage: War es Mord oder Selbstmord? seine Berliner Enkelin Nina versucht das aufzuklären, was nicht einfach ist, weil er dreimal eine Familie gegründet hat: in Berlin, in Haifa und in Palermo.
Der Roman ist dritter Band einer Trilogie, kann aber völlig unabhängig von den beiden vorausgehenden Bänden gelesen werden.
Kürzlich gab es um einen Plan des Goethe-Instituts und der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv große Aufregung: Unter dem Titel „Holocaust, Nakba und deutsche Erinnerungskultur“ sollte ausgerechnet am 9. November eine öffentliche Diskussion stattfinden, in der durch den Titel die von den Palästinensern „Nakba“ (Katastrophe) genannte Vertreibung aus ihren Wohnsitzen 1948 neben die Judenvernichtung durch die Nazis gestellt wird. „Holocaustverharmlosung!“ war das Kernwort der Kritik, die Veranstaltung wurde m.W. auf ein anderes Datum verschoben.
Dass die Vertreibung von Hunderttausenden von Palästinensern durch die Soldaten des blutjungen Staates Israel etwas Schreckliches war, kann man in dem Roman „Jaffa Road“ von Daniel Speck an Hand einer konkreten fiktiven, aber sehr einfühlsam geschilderten Familiengeschichte nachvollziehen. Aber nicht minder einfühlsam beschreibt Speck, Sohn einer Deutschen und eines Tunesiers, auch die Verzweiflung der jüdischen Ansiedlungswilligen, die von den Engländern zuerst mal in einem Lager auf Zypern untergebracht werden und es nicht fassen können, den Lagern glücklich entflohen zu sein, nur um wieder in Lagern zu landen – und dann in Haifa in einen jüdisch-palästinensischen Bürgerkrieg zu geraten. Achse dieses Wechselspiels zwischen Juden und Arabern ist am Ende des Zweiten Weltkriegs ein fahnenflüchtiger deutscher Soldat (Moritz Reincke) in Nordafrika, der einem Juden (Victor) das Leben rettet, sich in dessen jüdische Adoptivschwester (Yasmina) verliebt und mit ihr und ihrer Tochter (Joelle) als scheinbarer Jude mit falschem Pass (Maurice Sarfati) nach Israel einwandert. Man merkt, dass der Autor ein erfahrener Drehbuchautor ist, der es versteht, unterhaltsam und spannend zu erzählen.
„Der Schlüssel zum Leben eines Mannes sind seine Frauen,“ heißt es einmal im Buch. Im Leben von Moritz sind es drei: Fanny Zimmermann in Berlin, deren Enkelin Nina zur Erzählerin des Buchs wird, Yasmina Sarfati in Tunis und Haifa, die die Tochter Joelle in die Ehe mitbringt, und Amal Bishara, die von einem PLO-Kämpfer den Sohn Elias hat, sich in Moritz verliebt, der inzwischen für den Mossad arbeitet, und als sie 1985 in Tunis bei der „Operation Wooden Leg“ umkommt, adoptiert Moritz den etwa 9jährigen Jungen und zieht mit ihm nach Palermo. Als Moritz tot aufgefunden wird, wird der inzwischen erwachsene Elias verdächtigt, seinen Ziehvater erschossen zu haben, weil dieser ihm seine Tätigkeit für den Mossad und damit seine Mitschuld am Tod Amals gestanden hat.
Ich habe die Palästinenser immer bedauert, zweitweise auch ein Arafattuch um den Hals getragen – aber zur Empörung über ihre Leiden hat es angesichts dessen, was die Nazis (mein Vater war einer) den Juden angetan haben, nie gereicht. Dies Buch hat mich näher an die Empörung herangebracht, zugleich muss ich aber auch dem Kollegen Recht geben, der bei uns schreibt: „Liebes Publikum, sehen Sie auf der Weltbühne den Kampf der GUTEN gegen die GUTEN“(https://keinverlag.de/461736.text). Ich finde eine Veranstaltung wie die in Tel Aviv geplante durchaus gerechtfertigt und hätte sie gerne besucht: https://www.tagesspiegel.de/politik/emporung-in-israel-uber-goethe-stiftung-inakzeptabel-und-respektlos-8859721.html
Geschrieben vor Ausbruch des Gaza-Kriegs
„Jaffa Road“ hat meine Einstellung zu einem zentralen weltpolitischen Konflikt verändert – und ist zudem noch spannend und wartet mit zahlreichen überraschenden Wendungen auf. Eine ebenso lehrreiche wie unterhaltsame Lektüre, absolut lesenswert!
Susanne Abel: Stay away from Gretchen
Grete Monderath in Köln wird dement, und in der Demenz dämmert eine Vergangenheit herauf, die sie eisern verdrängt hatte: Als Mädchen aus Ostpreußen nach Heidelberg geflohen, verliebt sie sich dort in den schwarzen GI Bob und bekommt von ihm ein Kind, das das Jugendamt ihr wegnimmt und in die USA gelangen lässt. Gretas Sohn Tom, Anchorman der Nachrichtensendung bei einem großen Kölner Sender, macht sich mit Hilfe seiner findigen Kollegin Jenny auf die Suche …
Auf meiner Schule gab es keine zu Schülern herangewachsenen „brown babies“, obgleich die ältesten von ihnen nur vier Jahre jünger gewesen wären als ich. Das liegt u.a. daran, dass meine Schule in der britischen Besatzungszone lag und nicht in der amerikanischen, wo es viele afroamerikanische Besatzungssoldaten gab, die es genossen, in einem Land zu sein, in dem sie – scheinbar – gleichberechtigt und -geachtet waren, in Lokalen, Bars und Läden wie normale Kunden bedient wurden und sogar mal mit einem weißen Mädchen anbandeln konnten. Die Miniserie „Ein Hauch von Amerika“ (kann gestreamt werden) hat uns vor zwei Jahren diese Welt näher zu bringen versucht. Etwa gleichzeitig erschien der Roman von Susanne Abel, der den Wortlaut zu seinem Titel machte, mit dem amerikanische Soldaten, sowohl weiße wie schwarze, vor deutschen Frauen gewarnt wurden: „Stay away from Gretchen“. Und dessen fiktive Hauptperson heißt dann auch Grete, und sie bekommt von dem hilfreichen Robert (Bob) Cooper in Heidelberg, wohin sie aus Ostpreußen geflohen ist, ein kleines Mädchen, das sie Marie oder Mariele nennt. Dieses Kind wird ihr vom Jugendamt weggenommen und verschwindet spurlos. Wer auch verschwindet, ist der Vater, weil er nach seiner Rückkehr in die USA im Korea-Krieg eingesetzt wird.
Die Suche nach diesem verschwundenen Kind ist der Inhalt des Buchs – und sie ist ähnlich spannend wie die Suche nach Miss Froy in „A Lady Vanishes“ von Hitchcock – und es würde mich nicht wundern, wenn aus dem Bestseller von Susanne Abel ein Film würde. An die Stelle der Erkennungsmelodie bei Hitchcock würde dann das Voodoo-Püppchen treten, an dem Marie sich lebenslang festklammert. Freilich müssten die Rollen von Grete (als junges Mädchen und junge Mutter – und als 85jährige demente Greisin) und von Bob Cooper (als 21jähriger GI und als 87jähriger Veteran) sowie auch die von Marie (kleines Kind – und 67jährige Mutter und Großmutter) doppelt besetzt werden, denn die zwei Zeitebenen des Romans liegen gut 65 Jahre auseinander – Nachkriegszeit und die Zeit der Flüchtlingskrise 2015.
Die Suche wird ausgelöst durch die Demenz der alten Grete, die ihre Vergangenheit als Mutter eines brown baby quasi unter Beton versteckt hat, dieser Beton beginnt in der Demenz zu bröckeln, und ihr Sohn aus der späteren Ehe mit einem Arzt ist Anchorman der Nachrichtensendung des FFD geworden (leicht zu erkennen: Gemeint ist der WDR in Köln, denn auch Anne Will ist dort beschäftigt). Tom Monderath ist ein vitaler, lebenslustiger Journalist geworden, dem weiblichen Geschlecht nicht abgeneigt, dessen Leidenschaft das Recherchieren ist, und dabei wird er unterstützt von der reizlosen und mittels Samenbank schwangeren Jenny, in die und deren Baby er sich aber verliebt, weil sie so findig ist und nicht nur den Aufenthaltsort von Bob herausbekommt, sondern auch … Nun, ich will hier nicht zu viel erzählen, gebe aber zu, dass ich am Schluss des Buches geheult habe.
Susanne Abel ist vielleicht keine große Schriftstellerin, aber eine Superjournalistin und -dramaturgin. Sie hat Doku-Soaps produziert, und eine Doku-Soap ist auch ihr Roman: Rund um die fiktive und sehr glaubwürdig gebaute und berührende Handlung vermittelt sie eine Fülle von Wissen (z.B. dass eine schwarze Panzereinheit nicht eingesetzt wurde, weil es keine schwarzen Helden geben durfte) und sehr drastische Kölner Kneipen- und Karnevalsszenen, die ich aber als absolut authentisch empfinde (ich habe acht Jahre in Köln gelebt und mit den Bläck Fööss in der Ringschenke Karneval gefeiert). Ein Roman, der unterhaltsam und spannend ist und zugleich eine Fundgrube des Wissens – wer kann das schon?
Für mich das berührendste Zitat: Bob wurde in den USA von weißen Jugendlichen zusammengeschlagen und wird gefragt, wie lange er im Krankenhaus gelegen habe: „Ganze acht Wochen. Ich heulte und hab mir jeden Tag gewünscht, Adolf Hitler hätte die Amerikaner besiegt.“
Leseempfehlung? „Sischer dat!“
_______________________________________________
Susanne Abel hat einen zweiten Band geschrieben: „Was ich nie gesagt habe: Gretchens Schicksalsfamilie“. Beginnt ebenfalls sehr amüsant: Tom Monderath empfängt seinen per DNA entdeckten holländischen Halbbruder in Köln – er sieht ihm sehr ähnlich – ist aber nicht ohne Grund gerade am Christopher-Street-Day nach Köln gekommen …
Marion Feldhausen: Der Himmel so rot
Im ständig witzelnden, ironisch bis zynisch sich gebenden Alltag eines Duisburger Kriminalkommissariats taucht wie ein schrecklicher Hai deutsche Nazi-Vergangenheit auf. Es fängt ganz harmlos an: Mit dem zufälligen Frauenleichenfund eines Sondengängers auf dem Duisburger Kaiserberg. Dann weiten sich die Kreise in Rockerchapter und den „deep state“ hinein: Altnazis und ihre Gehilfen, die sich gegenseitig decken, bis schließlich herauskommt: Hier geht es um die in Italien verurteilten, in Deutschland unbestraften Verantwortlichen für das Massaker in Sant‘Anna (di Stazzema) am 12. August 1944. Die Hauptkommissarin Sofia ist Halbitalienerin und kommuniziert deshalb problemlos mit dem italienischen Ermittler, sie und ihr Kollege Paul Scholten sind einschließlich vieler menschlicher Schwächen lebensnah und sympathisch geschildert, einzig Sofias Lebensgefährte, der Staatsanwalt Hecht, bleibt blass und im Hintergrund. Die Autorin hat den Balanceakt zwischen historischer Wirklichkeit und Fiktion gemeistert u.a. dadurch, dass sie den am Massaker Beteiligten andere Namen zulegte. Ein ungewöhnlicher, spannender und düsterer Krimi wie seine Vorgänger „Himmelskinder“ und „Friedensengel“.