
Malte Ossenblom
Erzählung
Prolog
Es war Malte Ossenblom nicht an der Wiege gesungen, dass er seine Lebenserinnerungen mal im Knast abfassen würde, insofern vergleichbar dem Siggi Jepsen in der „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz, aber auch dem Peter Ibbetson von George duMaurier. Aber während jenen ein Aufsatzthema nicht wieder losließ, das ihm im Deutschunterricht gestellt wurde, wurde mein lieber Cousin selbst Deutschlehrer für die vielen des Deutschen nicht mächtigen Knastologen, übte mit ihnen Uhrzeit und Datum und wann es „an die Wand“ und wann es „an der Wand“ heißt. Aber das füllte ihn nicht aus, und weil er von Journalisten, aber auch von mir, der Sozialarbeiterin, die ihn oft besuchte und beriet, gefragt wurde, wie es komme, dass er, studierter Mann aus gutem Hause, zum Mörder werden konnte, hat er sich, bereits im zehnten Jahr seiner Strafe, daran gemacht, seinen Werdegang zu Papier zu bringen, den ich hiermit der Öffentlichkeit übergebe. Susanne Wittig

Erstes Kapitel
Emil war als Krüppel aus dem Krieg zurückgekehrt, als Träger einer Unterschenkelprothese rechts. Bizarr war der Anblick der Regale des Prothesenmachers, dessen Weizen blühte durch den Krieg. Ich begleitete ihn dorthin und wagte die Augen kaum zu erheben zu den Bataillonen von stählernen Füßen, den Regimentern hölzerner Arme, und in einer Glasvitrine gab es auch eine Gruppe saffianlederner Zungen zu bewundern. „Für Männer mit Munddurchschuss,“ erklärte Emil, der meinen rätselnden Blick bemerkt hatte. Er war untersetzt, um nicht zu sagen pyknisch, hatte eine Stirnglatze mit einer Delle in der Mitte, die an die Zange erinnerte, die ihn einst „geholt“ hatte; diese Stirnglatze verstand er eindrucksvoll zu runzeln, was wohl mit seinem Beruf zusammenhing: Er war Staatsanwalt, und in diesem Beruf gibt es oft Anlass, nachdenklich oder – nach Bedarf – dräuend die Stirn zu runzeln.
Emils Prothese bestand aus einem Lederteil, das an den Oberschenkel geschnallt wurde, und einem hohlen hölzernen Unterschenkel, in dessen Schienbein ein kreisrundes, etwa fünfmarkstückgroßes Loch gebohrt war. Ein Metallscharnier verband das Lederteil mit dem Unterschenkel, an ihm war der mit einem schwarzen Lederschuh bekleidete Fuß befestigt, der bei Belastung nachgab, bei Entlastung sich wieder streckte. Jeden Morgen salbte Emil den Stumpf, insbesondere den funktionslos und deshalb schlaff gewordenen Wadenmuskel mit leise klatschenden Geräuschen, zog ihm einen beutelförmigen dicken Woll-, im Sommer Baumwollstrumpf über, der an seinem Ende eine wurstförmige Verlängerung hatte, versenkte dann den bestrumpften Stumpf im hölzernen Teil, fingerte das Strumpfende durch das Loch heraus und zog fest daran. Nun stak der Stumpf richtig fest, das Oberteil konnte festgeschnallt werden. Die Prothese erlaubte es ihm, auf den Gebrauch von Krücken zu verzichten, freilich bedurfte er eines Gehstocks in der linken Hand, mit dem er den rechten Fuß geringfügig entlastete, um so die Gefahr des Wundwerdens zu verringern.
An Tagen, an denen der Stumpf wundgelaufen war, musste er, wollte er nicht zu Hause bleiben, auf die Unterarmkrücken zurückgreifen, mit denen er aus dem Lazarett entlassen worden war. Vilma schlug dann das leer flatternde Hosenbein hoch und steckte es mit zwei Sicherheitsnadeln fest. Nachdem sich Emil zu Beginn seiner Behinderung zu Jähzornausbrüchen und Schreianfällen hatte hinreißen lassen, lernte er sie im Laufe der Jahre akzeptieren u.a. dadurch, dass sie mit seinem Alltag verschmolz, die Erinnerung an unbehinderte Beweglichkeit verblasste und andere Kriegsheimkehrer noch stärker beeinträchtigt waren, so der Tischler, der das altmodisch hohe Ehebett niedriger setzte: Er hatte beide Beine überm Knie verloren und war trotz seiner Oberschenkelprothesen ein beliebter Tänzer. Ein Trost freilich blieb diesen Männern vorenthalten: Sie konnten sich nicht wie die Veteranen der Siegerstaaten an einem Tag des Jahres stolz mit ihren Verstümmelungen und Orden in der Öffentlichkeit präsentieren. „Das liegt nicht daran, dass wir den Krieg verloren haben,“ antwortete Emil mir, als ich ihn fragte. „Kaiser Franz von Österreich hat fünf Kriege verloren und blieb doch ein Ehrenmann. Wir haben nicht nur den Krieg, wir haben die Ehre verloren.“ Warum die Ehre verloren gegangen war, erläuterte er nicht.
Vielleicht war die auf Kriegsverletzung beruhende Unsportlichkeit Emils der Grund für die Bewunderung, die ich einem Schüler entgegenbrachte, der drei Klassen über mir das Gymnasium besuchte. Harald Hirsebeck war gut zehn Zentimeter größer als ich, breitschultrig, sein Profil glich dem des Antinous im Lateinbuch, ein dunkles Vlies spross auf seiner Brust, und wenn er zum Sprint antrat, stampfte er mit seinem enormen Antritt alle Gegner in Grund und Boden. Unsere Schule war bizarrerweise stehen geblieben, als die Stadt in Staub und Asche sank. Sie hieß nach einem Patrioten, der sich im Genfer See erschossen und ertränkt hatte, Lornsen-Gymnasium und lag in der Nähe des Liliencronparks, in dem halbzahme Kanada-Gänse ihre schwarz bestrumpften Hälse reckten und Passanten um Brotbröckchen anschnatterten. Harald Hirsebecks Vater war Versicherungsagent, und um auf sich und das „konkurrenzlos günstige Angebot der LEMOVIA“ aufmerksam zu machen, ließ er in der Vorweihnachtszeit von Harald Firmenkalender an Kunden und solche, die es werden sollten, verteilen. Ich empfand es als Ehre, meinen großen Freund, den ich beim Rollschuhlaufen auf dem Exerzierplatz kennengelernt hatte, dabei begleiten und ihm die schwere Tasche mit den Kalendern tragen zu dürfen. Was mochte in meinem 13-jährigen Kopf vor sich gehen, dass ich nicht merkte, wie Harald mich ausnutzte? Ich konnte gar nicht genug beladen werden, und wenn ich abends nach Hause kam, erfüllte mich meine Erschöpfung mit dem befriedigenden Gefühl, einem Jungen gedient zu haben, den alle bewunderten, ja, wenn Klassenkameraden mich als „Kofferträger“ und „Kuli“ verspotteten, war ich sicher, dass sie nur ihren Neid verbergen wollten.
Lag ich dann im Bett und konnte noch nicht einschlafen, lauschte ich auf das regelmäßige Klacken von Damenschuhen auf dem Trottoir. Da ich gerade Einlagen bekommen hatte, die meine schwächlichen Plattfüße ein wenig hochstützen sollten, und da ich wegen Blutarmut vom Turnunterricht befreit war, war mir dann oft, als ob mein Ende nahe bevorstünde. Und wenn es so wäre, dachte ich mir, würde meine Mutter mich bestimmt fragen: Hast du noch einen Wunsch, den wir dir erfüllen können? Zögernd würde ich nicken und bekennen: Einmal noch wolle ich Harald Hirsebeck sehen. Harald würde kommen, an meinem Bettrand sitzen und würde bedauernd sagen: ‚Wer soll mir jetzt die Kalender tragen?’ ‚Du wirst schon jemand finden’, würde ich antworten. ‚Du bist so schön! So groß! So stark! Wer kann dem Zauber deiner dunklen Augen widerstehen?’ Verlegen würde Harald lachen – aber ich würde seine Hand ergreifen – sie küssen, diese kraftvolle, nervige, schwarz behaarte Hand – und sterben … Ich lag weinend im Bett. Die klackenden Damenschuhe kamen zurück – und ich schlief ein.
Aber ich lebte weiter, und noch ein weiteres, von Bomben weitgehende verschont gebliebenes Stadtviertel musste mit Kalendern versorgt werden. Da der Kalender nicht in den Briefkasten passte, klingelte Harald an der Tür einer Gründerzeitvilla mit Grotesken und einem verglasten hölzernen Wintergarten. Eine Dame im Morgenmantel und Lockenwicklern in den Haaren öffnete und bat uns herein. Ich wurde mit einer Himbeerbrause in den Wintergarten gesetzt, während die Dame mit Harald „etwas zu besprechen“ hatte und mit ihm im Innern der Wohnung verschwand. Ich schaute mir den Garten durch die Himbeerbrause an: Er war ins Schlanke und Hohe zusammengepresst und leuchtete rubinrot.
Harald entschuldigte sich, als wir weitergingen: „Tut mir leid,“ sagte er, „aber ich musste es mit ihr machen.“ Ich nickte. Dieses „Es“ war zwar ein weißer Fleck auf meiner inneren Landkarte, aber er war umgrenzt und lag an einer bestimmten Stelle. Seine Koordinaten hießen Erwachsenenwelt, Heimlichkeit, Fortpflanzung und Verbrechen. Mit anderen Worten: Dieses „Es“ tauchte nicht zum ersten Mal in Gesprächen auf. Aber Harald fühlte sich verpflichtet, mich aufzuklären, und fragte: „Soll ich dir sagen, wie’s war?“ Ich schüttelte energisch den Kopf, aber Harald drängte sich auf: „Weißt du, was sie unter ihrem Morgenmantel trug?“ Ich ahnte es, schwieg aber. „Nichts. Was soll man als Mann dann machen? Wenn ich gekniffen hätte, hätten es morgen die Spatzen von den Dächern gepfiffen: Harald Hirsebeck ist ein Schlappschwanz! Und einen Vertrag hab ich ihr auch noch aufgeschwatzt!“
Haralds Schilderungen wühlten mich auf. Ich wusste nicht, was mich mehr aufregte: Dass mein bewunderter Freund sich von einer ihm völlig fremden Frau benutzen ließ – oder dass er mit dieser ihm völlig fremden Frau Ehebruch beging und mit ihr auf eine Weise fleischlich verkehrte, die mich, von prüden Eltern zur Prüderie erzogen, anekelte.
Aber ich ließ den bewunderten Freund noch nicht fallen, sondern trug ihm weiter die schwere Tasche mit den Kalendern der LEMOVIA. Ich gewöhnte sich daran, beinahe bei jedem Nachmittagsgang einmal mit einer Brause irgendwohin gesetzt zu werden, während Harald mit der Frau des Hauses, manchmal aber auch mit dem Hilfsmädchen, in der Tiefe der Wohnung verschwand, „um etwas zu besprechen“. ‚Ob die Kalender extra so breit gemacht werden, dass sie in viele Briefkästen nicht passen?’, fragte ich mich.
Wenn ich jetzt abends erschöpft ins Bett sank, schämte ich mich meiner Freundschaft zu Harald. Ja, ich hatte mich in einen Unwürdigen verguckt! Und obgleich ich ihn immer noch an mein Bett sehnte, wollte ich nicht mehr sterben, sondern ihm eine Standpauke halten. ‚Wie kannst du dich so wegwerfen!’, wollte ich zu ihm sagen, ‚du bist ja nicht besser als ein Tier!’ Ich erinnerte mich an einen Menschenauflauf auf der Schlossstraße. Gebannt verfolgten die dicht bei dicht stehenden Erwachsenen ein Schauspiel, das ich, damals erst zehn, nicht sehen konnte, weil ich zu klein war. Ich drängte mich hindurch und sah es. Zwei Hunde kopulierten vor einem Friseurgeschäft und hingen aneinander. Um sie auseinander zu bringen, kam der Friseur mit einem Eimer heraus und schüttete Wasser über das auf sechs Beinen trippelnde Doppelwesen. Aber sie waren miteinander wie verwachsen. Widerwille hatte mich damals erfüllt und erfüllte mich noch, wenn ich daran dachte, dass sich in diesem Punkt Menschen von Tieren nicht nur nicht allzu weit, sondern letztlich überhaupt nicht unterscheiden.
Ihren Tiefpunkt erreichte die Freundschaft – und zerbrach – als Harald mich eines Vormittags in der Pause beiseite nahm, auf ein Mädchen zeigte und sagte: „Die will ich haben!“ Es war gar nichts Besonderes dran an diesem Mädchen, sie war lang aufgeschossen, trug das dunkelblonde Haar, wie es damals üblich war, zu einem Pferdeschwanz am Hinterkopf mit einem Gummi zusammengefasst, und von blauen Windjacken und braunen Cordröcken wimmelte es auf dem Schulhof, diese Kombination war fast eine Art nicht angeordneter Schuluniform. Ach ja, ihre oberen Schneidezähne standen etwas vor. Manche Leute mögen das, ich mochte es nicht, weil es mich an Eichhörnchen und Hasen erinnerte. Aber das war alles ganz gleichgültig, ich ergriff Partei für die Unbekannte nicht wegen ihrer Schönheit, sondern weil ich sie bedroht sah durch Harald, den ich Freund nie wieder nennen wollte. Ich war reif, mich zum weiblichen Geschlecht zu bekennen, und nicht ich traf diese Wahl, sondern sie war für mich getroffen worden und erhielt dadurch den Charakter eines Auftrags. Fragt denn der Ritter danach, ob die Prinzessin schön ist, die es zu beschützen oder zu erlösen gilt? Ist sie nicht oft genug schwarz oder unansehnlich? ‚Wie leicht ist es,’ dachte ich, ‚sich für eine Schönheit aufzuopfern! Aber die ganze Größe der Tat enthüllt sich erst, wenn sie einer Unschönen gilt! Niemals, niemals sollst du sie haben, du Gefräßiger!’ Erstmals betrachtete ich Harald mit den Augen des Hasses. ‚Wie würdest du mich auslachen, wenn ich, der unsportliche, plattfüßige, blutarme Malte, dir das jetzt sagen würde! Aber du wirst erkennen müssen, dass in mir – ein Riese steckt!’
Am Abend, als ich die Stiefel ausgezogen hatte, nahm ich die Einlagen heraus und warf sie in den Mülleimer. Ab sofort nahm ich am Sportunterricht teil – obgleich Vilma den Kopf schüttelte und behauptete, ich sei dafür „zu zart“. Ich kaufte mir ein Paar gusseiserne Hanteln, mit denen ich allabendlich jonglierte, bis ich sie emporwirbeln und wieder auffangen konnte, als wären sie aus Holz. Den Kontakt zu Harald mied ich, was ihm aber gar nicht auffiel; der Mohr hatte seine Schuldigkeit getan. Ich fand in dem bleichen, klugen und geheimnisvollen Henning von Testorff, der auf dem Land lebte, Weimaraner züchtete und für Sophia Loren schwärmte, einen Pausenkameraden, mit dem ich im entgegengesetzten Sinne wie die Unbekannte um das Rondell mit der Fahnenstange kreiste. Dann begegnete ich ihr pro Runde zwei-, pro Pause etwa zwanzigmal. Das war genug, um mich an ihr satt zu sehen; denn sie gefiel mir von Tag zu Tag besser: Ihr schmaler Kopf, die messerrückenscharfe Nase, der fast männlich entschlossene Mund, der zu einem erschütternden Lächeln schmelzen konnte – bis ich mir eingestehen musste, dass sie doch schön und dass meine geplante Aufopferung nicht ganz so heldenhaft und selbstlos war, wie ich sie mir ausgemalt hatte. Von Annäherung konnte jedoch keine Rede sein; je öfter ich sie von ferne angehimmelt hatte, desto unmöglicher war es, die sich verfestigende Distanz mit einem „Hallo“ oder „Guten Morgen“ oder gar einem „Kennen wir uns nicht?“ banal zu durchbrechen.
Einmal stand sie neben mir an dem Stahlrohrzaun, der das Rondell umgab; in der Mitte produzierte eine Equilibristentruppe ihre atemberaubenden Künste und fuhr mit dem Motorrad zum hohen Walmdach der Schule hinauf. Ich aber hatte nur Augen für die schlanke braune Mädchenhand, die auf dem Stahlrohr lag. In einem Moment des Erschreckens – ein junger Artist verhakte sich und fiel fast vom Seil – umklammerte sie das kalte Eisen fester, und als sie sich nun wieder streckte, bildeten sich Grübchen über den Fingergrundgelenken, ein Schauer der Zärtlichkeit überlief mich, und von diesem Moment an war alles anders. Bevor ich einschlief, träumte ich mir Helche an mein Bett, diesen Namen hatte ich aufgeschnappt, als jemand sie rief und sie sich umdrehte. Ihre Hand war es, der ich einen Kuss aufdrücken wollte voller Andacht und Schwärmerei, und bei der Erinnerung an die schwarz behaarte Pranke, die ich einstmals hatte küssen wollen, empfand ich Scham und Abscheu. Meine Fantasie inszenierte eine Feuersbrunst, aus der ich Helche, alle Gefahr missachtend, auf meinen Armen hinaustragen und, wenn sie sich dann später bedankte, allen Dank stolz zurückweisen und meiner Wege gehen wollte. Eine gute Tat verlor ihren Glanz, wenn sie belohnt wurde. Ich wollte ein Held sein und nichts empfangen als atemlose Bewunderung. Was aus meinen Fantastereien verschwunden war, war der Wunsch, zu sterben. Meinem Leben war ein neuer, kraftvoller Sinn eingehaucht worden, der sich mit der Unwiderstehlichkeit fließender Lava in mir ausbreitete. Manchmal wusste ich mir vor Begeisterung kaum zu helfen, boxte in die Luft, sprang in die Höhe und dirigierte ein unsichtbares Orchester. Mit den Hanteln jonglierte ich inzwischen so leicht, dass ich ein neues, schwereres Paar erwarb, um mich noch zu steigern.
Zweites Kapitel
Henning von Testorff war im Unterricht ein Schweiger, aber wenn er drangenommen wurde, brach der Damm, den er um seine Beredsamkeit errichtet hatte, und es ergoss sich ein Schwall kluger Worte über den ratlosen Lehrer, der sich vornahm, diesen Schüler besser in Zukunft nicht wieder zu Wort kommen zu lassen – denn er nahm alles vorweg, was doch die restliche Stunde noch füllen sollte – oder er sprach ein Schlusswort von so abrundender Exaktheit, dass dem Pädagogen nur blieb, die Klasse achselzuckend in die Pause zu entlassen. Hennings Lieblingslektüre waren die Werke eines Amerikaners, der die Manuskripte wäschekorbweise zum Verleger geschleppt und es dem Lektor überlassen hatte, daraus ein Buch zu formen: Thomas Wolfe. Ich ließ mich anstecken von dieser Begeisterung, las „Schau heimwärts, Engel!“ in der ekstatischen Übersetzung des Expressionisten Hans Schiebelhuth, tauchte ein in die Welt des Eugen Gant in dem Bergstädtchen Altamont – und empfand ein Getröstetsein, wie es mir Literatur noch nie geschenkt hatte. Ich hatte oft darunter gelitten, in einer unbedeutenden Provinz- und Garnisonsstadt heranzuwachsen – aber Altamont war noch kleiner gewesen! Und da Eugen die Klassiker las, las auch ich die Klassiker, insbesondere Shakespeare, dessen sonnets mich alsbald zur Nachahmung anregten. Als mir das erste, wie mir schien, gelungen war, folgte das zweite, das dritte – und ich empfand eine Schaffenslust bei der Versifikation, die mir die sichere Vorbotin einer Zukunft als Autor zu sein schien.
Ich zeigte Henning meine Sammlung von sonnets, Henning las sie mit amüsiertem Gesicht, gab sie mir zurück und fragte: „Wusstest du, dass Shakespeares sonnets – zumindest die meisten – nach einhelliger Überzeugung der Literaturgeschichtler einem Mann gegolten haben?“ Als ich ungläubig die Brauen zusammenzog, setzte Henning lachend hinzu: „Rate mal, wohin ich morgen fahre! Nach Hamburg! Und weißt du auch weshalb? Sophia Loren gibt eine Pressekonferenz im Vierjahreszeiten. Ich habe von meinem Onkel einen Presseausweis bekommen. Das lass ich mir nicht entgehen!“
Aber Hennings Frage stak wie ein Pfeil in meinem Herz. Hatte meine Verehrung für Harald mir jemals das Bedürfnis eingeflößt, sie in Worte zu fassen? Nein, und der Grund war: Ich hatte Harald nie geliebt! Aber war es nicht gleichgültig, wen man liebte, kam es nicht nur darauf an, dass dieses Gefühl inspirierend war? Mir wurde klar, dass die an Helche gerichteten Verse nicht länger in meiner Schreibtischschublade verstauben durften. Sie musste sie kennenlernen, koste es, was es wolle! Mit Herzklopfen bestieg ich den kleinen Schraubendampfer, der mich auf die andere Seite der Bucht übersetzte. Dort wohnte sie mit ihrem Vater in einem Haus für Sommergäste mit Namen Luv und Lee. „Dr. jur. Max Fohrmann“ stand auf dem Briefkasten. Ich steckte den Umschlag mit den drei sonnets hinein, wagte es nicht, den Blick zu den Fenstern zu erheben, aus Sorge, eine Bewegung der Gardinen oder sogar sie selbst zu sehen. „Furchtlos beginn ich den Streit. Er ende, wie mir die Norne bestimmt!“, zitierte ich innerlich aus dem Beowulf.
Henning kam enttäuscht aus Hamburg zurück. Er hatte sich Sophia Loren als amazonenhafte Heroine vorgestellt, aber sie war, wie er sagte, „zierlich, ja, winzig“ gewesen. „Wahrscheinlich wird sie immer aus Kniehöhe gefilmt und in Kussszenen auf einen Schemel gestellt!“ Aber er trauerte ihr nicht lange nach. In einer Sängerin, deren Ruhm gerade nach Deutschland drang, fand er sein neues Idol. Sie war Griechin und hatte eine Stimme, die wie ein Messer ins Herz schnitt. Henning lieh mir eine Aufnahme mit Ausschnitten aus Donizettis Lucia di Lammermoor. Ich musste weinen, als ich diese Stimme zum ersten Mal vernahm. Auf dem Schulhof suchte ich den Blick Helches, aber der glitt gleichgültig an mir ab. Ich hatte meinen Absender auf den Brief geschrieben. Aber wahrscheinlich konnte sie den Namen nicht zuordnen. Und selbst wenn sie es konnte, hatte sie vielleicht die allertriftigsten Gründe, es mich nicht merken zu lassen.
„Deine Unterlippe rundet sich stark. Gib acht, dass du nicht in Sinnlichkeit versinkst. Ein wenig Enthaltsamkeit, ja, Askese möchte dir gut tun!“ Diesen Rat gab Vilma mir mit auf den Weg, als ich gerade dabei war, mich in Helche zu verlieben. Wie Vilma darauf kam, dass gerundete Unterlippen Sinnlichkeit anzeigen, blieb ihr Geheimnis. Vielleicht wollte sie auch nur darauf aufmerksam machen, dass es in ihrem Leben an Sinnlichkeit immer gefehlt hatte; denn Emils Unterlippe war nur ein Strich. Er hatte als junger Jurist für die schmallippige Göttliche, für Greta Garbo, geschwärmt und keinen ihrer Filme versäumt. Er mochte Frauen, die größer waren als er, zugleich aber kränkte es ihn, wenn man darauf anspielte, dass er kleiner war als seine Frau. So hatte Vilma einmal ein Buch, nach dem er sich vergeblich gestreckt hatte, mühelos aus dem Regal gezogen. Er sprach drei Tage lang nicht mit ihr. Als Emil sich in Vilma verliebte, war sie als Gräfin Orloff verkleidet und trug ein pelzbesetztes Bustier, das ihre kraftvollen, ostseestrandgebräunten Oberarme mit den Impfnarben reizend zur Geltung brachte. „Er liebte meine Walkürenarme,“ erzählte Vilma, wenn sie auf die Anfangszeiten ihrer Ehe zu sprechen kam. „Und er hat mir im Romanischen Café auf Knien einen Antrag gemacht. Aber sprich nie davon – er will es heute nicht mehr wahrhaben.“
Ich fand meine Mutter sehr attraktiv und sah nicht weg, wenn er sie einmal beim Ankleiden vor dem Spiegel ihres Schleiflackschranks erblickte. Dieser Schleiflackschrank war das Einzige, was sie mit in die Ehe gebracht hatte – außer sich selbst und ihrem Beruf als Säuglingsschwester. Gelegentlich spürte ich ein Ziehen in meiner Unterlippe. ‚Jetzt verdickt sie sich’, dachte ich. ‚Werde ich in Sinnlichkeit versinken?’ In der Leihbücherei war ein Konvolut Bücher aus Amerika gelandet – Werke, die die vom Nationalsozialismus korrumpierten Deutschen mit der englischen Sprache, mit demokratischen Idealen und abendländischem Bürgerstolz vertraut machen sollten. Darunter waren auch Fotobände, in denen leicht oder gar nicht bekleidete kalifornische Strandschönheiten abgelichtet waren. Ich beschloss, Fotograf zu werden. ‚Dann brauche ich nur mit dem Finger zu schnippen, und die schönsten Frauen ziehen sich für mich aus! Was für ein herrlicher Beruf! Wie kläglich, sich auf dem Ehepfad mit der kargen Kost eines einzigen Weibes lebenslang begnügen zu müssen!’ Andererseits: Wenn dieses Weib Helche hieß – was blieb da noch zu wünschen übrig? War es nicht auch großartig, seine ganze Existenz in die Hand einer Einzigen und Einzigartigen zu geben?
Vilma war geborene Hanseatin, und das ließ sie ihre Mitbürger gern spüren. Hier wolle sie nicht begraben sein, war ihr erster Gedanke, als sie Emil, dem der Federstrich eines Justizbeamten eine Planstelle beschert hatte, in die Garnisonsstadt folgte. Alles, was ihr dort nicht gefiel, schob sie auf das geringere Niveau der Provinzler: Ihre Klatsch- und Großmannssucht (als ob Hanseaten nicht klatschten und sich nicht gern auch einmal übernähmen), ihre Neugier, ihre Schadenfreude … Ihr fiel auf, dass die vielen Menschen, die als Flüchtlinge aus dem Osten zugewandert waren, kaum eine Chance hatten, nach oben zu kommen. Sie beteiligte sich deshalb an einem Heim für Waisenkinder aus Flüchtlingsfamilien, spielte mit ihnen, fertigte Buntpapierarbeiten mit ihnen an, richtete den Mädchen Puppenstuben ein.
Das Schicksal eines Jungen berührte sie besonders; er war mit seiner Mutter und der kleinen Schwester im Winter 45 aus Ostpreußen geflohen, wo sein Vater Sattelmeister auf Trakehnen gewesen, aber nun gefallen war. Die Mutter hatte eine tote Krähe am Wegesrand gefunden, hatte dem Sohn das Schwesterchen zu halten gegeben, hatte aus Zweigen ein Feuer entfacht, das schwarze Suppenhuhn gerupft, ausgenommen und in einer Blechdose gekocht. Währenddessen kamen Soldaten, die die Mutter nicht verstand, aber sie musste mit ihnen beiseite gehen. Der Junge legte das Mädchen ab, trank die Brühe und nagte wolfshungrig an der mageren Karkasse des Vogels. Als die Mutter zurückkam, schwankte und zitterte sie. Sie hob das Kind aus dem Schnee. Es war steif gefroren. „Aber du bist wenigstens satt,“ sagte sie, nahm den Jungen bei der anderen Hand und ging mit ihm weiter.
„Stell dir nur vor, ich wäre diese Mutter, du wärest mein Sohn gewesen, Malte, und Emil wäre im Krieg nicht nur verwundet, sondern getötet worden! Es ist alles so zufällig, und die Schicksale liegen so nah aneinandergepresst, als ob nur Seidenpapier dazwischen wäre!“ Sie schauderte bei diesen Betrachtungen und versank in Schwermut. Nach einiger Zeit zog sie sich aus ihrer ehrenamtlichen Arbeit zurück. „Ich ertrage das alles nicht. Ich habe zu viel Armut und Elend in meiner Kindheit kennengelernt. Mein Vater trank ja, und Mutter, ach, sie war nervenleidend, und es war ein schlimmer Tag, als ich mit Papa dem geschlossenen Wagen folgte, der die Rasende in eine Heilanstalt brachte! Ich habe meine Portion des Jammervollen mitbekommen und muss mir nicht noch mehr aufladen.“
Gern wanderte sie mit mir an einem schönen Sommertag durch die Wiesen und Weiden des Umlands, und wenn sie dann über ein Gatter in ein Stück verwunschener Stille hineinschauten, umstanden von den Haselhecken der Knicks, die kaum einen Windhauch hindurchließen, blieb sie stehen, schaute auf dieses Stück begrünter Erdoberfläche und sagte: „Warum kann nicht überall so tiefer Friede herrschen? Ach, wenn ich mir hier eine Hütte bauen und darin leben dürfte, ich wollte wohl die glücklichste Frau auf Erden sein.“ Was sie geprägt hatte, wurde an einer Postkarte deutlich, die mit einer Reißzwecke über ihr Bett geheftet war. Sie zeigte den Umriss des Berliner Schlosses bei Nacht, groß und düster lag es da, aber in einem Fenster brannte Licht. „Deutschland, schlafe ruhig – dein Kaiser wacht!“, stand darunter.
„Aber dieser Kaiser war ein großmäuliger Esel,“ wagte ich einmal einzuwenden.
„Das wussten wir erst später. Als der Krieg verloren war und die Flintenweiber den Neuen Wall heraufmarschiert kamen. Was für ein Chaos! Lieber ungerechte Ordnung als gerechte Unordnung!“ Dieser Satz fasste ihr ganzes, von Angst zerfressenes Wesen zusammen. Sie war wie gemacht, um auf das inszenierte Pathos, die hohle Feierlichkeit und die dümmlich-brutale Anmaßung der Nationalsozialisten hereinzufallen. Sie füllten den Leerraum aus, den der Verlust des Kaisers in ihrem Herzen hinterlassen hatte, und wenn sie mit ihrem damaligen Verlobten, meinem nachmaligem Vater, im Volksparkstadion der einschmeichelnden Stimme des Propagandaministers lauschte, dann wollte sie nur noch eins: blind vertrauen und Geborgenheit finden.
Hatte sie je einen anderen als Emil geliebt? Emil spottete gelegentlich, wenn sie über einen Mann positiv sprach (z.B. über den Metzger, der immer so liebenswürdig war, ihr, der wenig küchenfesten Säuglingsschwester, Tipps für die Fleischzubereitung zu geben), er sehe wohl aus wie Italo Balbo. Wer das gewesen sei, wollte ich von Vilma wissen; und warum Emil sie mit ihm aufziehe. Trotzig erwiderte sie, Emil sei auf lächerliche Art und Weise eifersüchtig auf ihn. Balbo sei ein Pilot gewesen, der mit ganzen Geschwadern von Flugzeugen den Atlantik überquert habe, ein fabelhaft aussehender Mann. Mussolini habe ihn zu seinem Luftmarschall gemacht, und in der Uniform habe er blendend ausgesehen. Natürlich habe sie für ihn geschwärmt! Es habe damals wohl in ganz Mitteleuropa keine Frau gegeben, die das nicht getan habe. Balbo sei auch ein kluger Kopf gewesen, er habe eine Vorahnung des Unheils gehabt, das auf Italien zukommen würde, wenn es sich Deutschland anschlösse. Er habe das Bündnis mit Hitler bekämpft, weshalb Mussolini ihn habe abschießen lassen. Es sei ein Jammer gewesen um diesen großartigen Mann!
Ja, Vilma war eine an den Felsen gefesselte Andromeda, die ihres Retters auf seiner Savoia-Marchetti harrte! Harrte sie noch oder hatte sie aufgegeben? Ich betrachtete das Bild der legendären Königstochter, die einem Ungeheuer geopfert werden sollte. Ein flämischer Meister hatte die üppige Schönheit in Öl gemalt, ein Schleierzipfel war ihr einziges Kleidungsstück. Dicke Tränen entrollten den himmelwärts gewandten Augen. O, Perseus sein und auf dem Pegasus, dem Markenzeichen von Mobiloil, einfliegen und sie retten! Dem Ungeheuer, das gräulich wie Grendels Mutter im Wasser schwamm, die Lanze in den grausig geronnenes Blut aufstoßenden Schlund rammen! Und dann hinknien vor der Gefesselten und ihren Dank entgegennehmen!
Da sich der Kunstdruck mit dieser Szenerie in einem der Bücher Emils befand, lebte Malte sich in die Vermutung ein, hier zu lernen, was seinen Vater, der über Sexuelles nie sprach, zu fesseln vermochte: ‚Auch er hat schon weinende Frauen trösten und retten wollen! Ich bin in dieser Hinsicht nicht anders als er. Und hat er Vilma nicht, als sie mittellos und ohne Zukunft in immer ärmeren Spitälern arbeitete, gerettet? Dies herrlich gewölbte und gerundete Fleisch, die Gewalt dieser Knie, die Eleganz der gerungenen Hände, die wie ein Schmuck getragenen Ketten, die Wucht des in der Torsion der Qual verzogenen Nabels!’ Ich berauschte mich an dem Bild, nur um sogleich Scham und Reue zu spüren. War das Enthaltsamkeit? War das Askese? Nein, ich hatte versagt, kläglich versagt! Aber musste etwas so Schweres nicht durch häufiges Scheitern hindurch mühselig erlernt und antrainiert werden? Eine ganze Woche blieb ich standhaft. Aber dann kniete ich erneut nieder vor dem Fantasma der Bedrohten und zu Rettenden und machte sie, indem ich mich ihr ergab, zu meiner Beute.
Einmal gelang es mir, mich über zwei Wochen im Zaum zu halten. Aber dann war ich so unsinnig reizbar, dass das Schreiben einer Drei mir wie das Zeichnen von Brüsten erschien, und die unterdrückte Natur befreite sich selbst. Um den Fleck, der sich in meinem Schritt abzeichnete, zu verbergen, hielt ich die Beine krampfhaft geschlossen und improvisierte eine lächerlich x-beinige Gangart. Ein Schulkamerad starb am überreichlichen Genuss von Kopfschmerztabletten seiner Mutter, nachdem er ihr Bild auf seine Brust gestellt hatte. Henning hatte in Erfahrung gebracht, dass er in seinem Abschiedsbrief geschrieben hatte, er sei völlig verzweifelt und sehe keine Zukunft mehr. Er sei seit Monaten schwer krank, sein Glied sondere regelmäßig unter furchtbaren Zuckungen fad riechenden Eiter ab.
Ich wollte nicht an Selbstekel sterben. Und ich wollte auch nicht wieder mit X-Beinen laufen müssen. Deshalb gestattete ich mir einmal wöchentlich den Ausflug auf dem Pegasus zum Andromeda-Nebel.
Drittes Kapitel
Ghana wurde unabhängig, ein Stein wurde auf die Mona Lisa geworfen, Mao forderte: „Lasst hundert Blumen blühen!“, der §175 StGB wurde für verfassungsgemäß erklärt, Willy Brandt wurde regierender Bürgermeister von Westberlin, der Sputnik wurde in eine Erdumlaufbahn gebracht. Ich schmiedete sonnets, führte Buch über die verwendeten Reime, um mich nicht zu oft zu wiederholen, verbannte die Reime Herz und Schmerz, Lust und Brust, Leib und Weib, Welt und Held, Gold und hold sowie die Worte filigran und Kristall aus meinem poetischen Wortschatz, weil es mir spießig erschien, und steckte meine Werke Helche in den Briefkasten. Diese aber verzog weiterhin keine Miene, ernst und in sich gekehrt wanderte sie an der Seite einer sehr viel kleineren Freundin durch die Pausen. Manchmal weinte sie, das bekümmerte mich heftig, aber da ich sie in meinen Versen mit Schwärmerei und Anbetung überschüttete, war ich mir keiner Schuld bewusst.
Eines Mittags, als Emil Vilma in der Küche das Geschirr abtrocknete, hörte ich im Vorbeigehen an der Tür den Namen Helche. Ich blieb stehen wie vom Donner gerührt und hörte mit klopfendem Herzen, wie Emil fortfuhr: „Was soll aus dem Mädchen werden, wenn wir gegen ihren Vater Anklage erheben müssen? Und danach sieht es aus!“ „Wie alt ist sie denn?“ „Ein Jahr älter als Malte.“ „Aber das würde doch passen! Du weißt, dass er eigentlich – eine Schwester haben – müsste …“ Ihre Rede brach ab. Ich erinnerte mich, dass sie einmal von einer Fehlgeburt gesprochen hatte ein Jahr, bevor sie mich bekam. „Bitte, Vilma,“ sagte Emil beschwörend, aber Vilma versank minutenlang in schmerzliche Erinnerung. „Und das, woran du denkst, ginge nicht,“ fuhr Emil fort. „Ich bin juristisch mit dem Fall befasst, und wenn wir das Mädchen bei uns aufnähmen, würde es heißen, dass wir auch vorher schon befreundet waren. Du weißt, um was für ein heißes Eisen es sich handelt. Ich wünschte, ich müsste hier keine Entscheidung treffen. Ich war doch damals auch nicht klüger.“
Zitternd verzog ich mich auf mein Zimmer. Es gab kaum einen Zweifel: Sie hatten über eine Helche gesprochen, die ein Jahr älter war als ich – das konnte nur meine Angebetete sein! Sie lebte offenbar mit ihrem Vater und hatte keine Mutter mehr. Schon seit Wochen hatte ich die Ohren offengehalten, ob irgendwo der Name Fohrmann fiel. Aber viel mehr, als dass sie im Dezember zugezogen waren, hatte ich nicht herausgefunden, auch nicht, wo sie vorher gelebt hatten. Befand sich der Vater auf der Flucht vor der Justiz? Dann war sie offenbar jetzt zu Ende, denn wenn er angeklagt wurde, dann konnte das sehr wohl die Endstation bedeuten. Und was wurde ihm vorgeworfen? War er in eine Mordaffäre verstrickt? In einem Anfall von düsterer Romantik stellte ich mir vor, dass er seine Frau umgebracht haben könnte. Aber dann wäre Helche kaum bei ihm geblieben, und die Möglichkeit, dass sie es nicht wusste, verwarf ich als zu konstruiert.
Immerhin ahnte ich jetzt, weshalb sie geweint haben könnte; es ist ja nichts Geringes, wenn gegen den eigenen Vater staatsanwaltlich ermittelt wird. Aber erstaunlicherweise rückte deshalb niemand von ihr ab, niemand machte anzügliche Bemerkungen, auch die Lehrer schwiegen, es lag eher etwas wie eine solidarische Bedrücktheit über der Lornsenschule, und ich umschrieb mein Mitwissen mit den Zeilen:
„Schlohweiß entsteigst du, Nixe, schwarzem Teich,
behängt mit Algen nur und Krötenlaich.“
Aus späteren Gesprächen meiner Eltern in der Küche erfuhr ich, dass die Ermittlungen gegen Helches Vater sich wegen schwieriger Beweislage hinzogen, aber was ihm zum Vorwurf gemacht wurde, erfuhr ich weiterhin nicht, konnte auch in der Zeitung nichts dazu finden, und dort, wo ich hinfuhr, hinaus zum Ehrenmal, das wir den Gedenkständer nannten, weil wir in unserer pubertären Fantasie einen erigierten Penis assoziierten, spazierte ich bei guter Luft und kräftiger Salzbrise zwischen den Tafeln der vielen Tausend erschossener, zerfetzter, erstickter, verbrannter und ertrunkener Matrosen einher, interessierte mich für die Flugkünste der Möwen und überlegte, ob mir zu dem alternativlosen Reimpaar Möwe – Löwe ein sonnet einfiel. Aber über die Verse
„Wo sich der Hungerschrei der Silbermöwe
mischt mit dem Tosen ungestümer Brecher,
wo auf dem Felsen sich des Meeres Löwe
genüsslich wälzt …“
kam ich nicht hinaus.
Die Abende verbrachte ich auf meinem Zimmer am Radio. Durch eine Sendereihe des NWDR entdeckte ich den Komponisten Maurice Ravel und kaufte mir Platten mit dessen Kompositionen. Am besten gefiel mir die Sonatine, von Ravel komponiert, als er noch am Anfang seiner Laufbahn stand. In dem treuherzig-schlichten Thema des ersten Satzes fühlte ich mich selbst und mein innerstes Empfinden gespiegelt. Ich besorgte mir die Noten und suchte mit ihnen den Musiklehrer auf. Ich hoffte, dass der mir erklären konnte, warum ich gerade in dieser Musik mich selbst zu finden meinte. Aber dem Musiklehrer war die Sonatine zu schwer, er mochte sie nicht, sprach von Tonarten, Chromatik und von Ravels Dekadenz. Bald darauf entdeckte ich Ravels Ballettmusik La Valse, die ich als Abrechnung des Komponisten mit der guten alten Zeit interpretierte: Mit schneidenden, modernen Klängen hatte er die süßliche und verlogene Walzerseligkeit der Vorkriegszeit in Fetzen gerissen. Als meine Eltern mich beim Hören dieser Musik ertappten, waren sie entsetzt: „Stell das sofort ab, es verdirbt deinen Geschmack!“ Ich stellte es ab. Als sie draußen waren, stellte ich es wieder an. Diese Musik wollte ich einmal mit Helche hören! Sicherlich würde sie ebenso begeistert sein wie ich!
Ich erlebte mit, wie Harald beim Sommersportfest angeberisch zum Hochsprung erst antrat, als die Latte bereits auf 1,80 Meter lag. Natürlich riss er, aber 1,80 Meter gerissen zu haben war eindrucksvoller, als 1,50 Meter zu schaffen. Ich beschloss, ihn zu übertreffen, bastelte mir im Keller Hochsprungständer und trainierte mit ihnen auf dem Rasenplatz, wo Vilma die Wäsche zum Trocknen aufhängte. Ich zog mir jedoch eine Zerrung zu und gab entmutigt auf. „Helche ist kaum das Mädchen, das sich durch physische Höchstleistungen beeindrucken lässt,“ schrieb ich in das blaue Heft, in dem ich zwischen meinen Versen und den Reimlisten auch Tagebuch führte.
Ich las Unter Korallen und Haien von Hans Hass, ein Lieblingsbuch Vilmas, und beschloss, Taucher zu werden. Noch vor dem Krieg hatte Hass in der Karibik mit zwei Freunden getaucht und sensationelle Unterwasserfotos geschossen. Außerdem hatten sie Barrakudas, Kugelfische und Moränen harpuniert, und das alles ohne Sauerstoffflasche mit bloßem Luftanhalten als sog. Apnoetaucher. Als in einem Geschäft für Gummiwaren Tauchflossen angeboten wurden, wünschte ich sie mir zum Geburtstag und bekam sie. Aber sie saßen nicht fest am Fuß und drückten schmerzhaft meine großen Zehen. Ich legte sie zu den Hochsprungständern und fand den Gedanken, Taucher zu werden, lächerlich. ‚Helche würde sich kaputtlachen!’ „Nicht Flossen braucht die Liebe, sondern Flügel!“, hieß es dann in sonnet 22.
Ich bekam zum Geburtstag außerdem ein Schmetterlingsbestimmungsbuch, das auch die Anleitung zum Bau eines Raupenzuchtkastens enthielt. Ich beschloss, Biologe zu werden, fand auf einer Fuchsie eine fette grüne Raupe mit Stachel auf dem letzten Glied und verbrachte sie in den Kasten, wo sie sich alsbald zur Puppe versteifte. Im Frühjahr schlüpfte ein wunderschöner rotsilberner Weinschwärmer hervor, der schwirren konnte wie ein Kolibri. Ich zeigte ihn meinem Biologielehrer, der ihn mitleidig ansah und aus dem Fenster fliegen ließ. „Wenn er der Sehnsucht folgt, fliegt er zu dir!“, dichtete ich daraufhin.
Es folgte ein Mikroskop, dessen Bauteile ich aussägte. In den Fuß goss ich flüssiges Blei, die Grob- und die Feineinstellung funktionierten hervorragend. Ich untersuchte die Schuppen vom Flügel eines Mondvogels (eines Nachtschmetterlings, der aussah wie ein abgebrochenes Stück Holz), Zwiebelhäutchen, Buchläuse und die kleinen roten Spinnen, die im Sommer auf warmen Steinen so geschäftig einherlaufen. Dann aber konnte ich nicht widerstehen, onanierte in die Hand und legte einen Samentropfen unter das Objektiv. Als ich die wimmelnden Spermatozoen erblickte, wurde mir schlecht. Nicht aus Ekel, sondern weil mir war, als hätte ich in ein verbotenes Geheimzimmer der Schöpfung geblickt. Solche Kaulquappen hatte mein Vater produziert, um mich, solche würde ich produzieren, um ein noch unbekanntes Kind mit einer noch unbekannten Frau zu erzeugen. Sie konnte nur Helche heißen. „Wie gern ich liebte! Alles ist bereit,/die Herrin meines Lebens zu empfangen,“ hub ich melodramatisch an. Aber Helche schenkte mir nicht einmal einen Blick.
Emil war Filmfan seit seiner Jugend, Greta Garbo war sein ganz großer Schwarm gewesen. Er war Mitglied eines Filmclubs, und nahm mich mit in eine Vorstellung von „Lohn der Angst“, in die ich als zu jung wohl im normalen Kino nicht hineingekommen wäre. Ein schrecklicher Film, denn er bezog seine Spannung wie der Titel schon sagt, aus der Angst und nur aus der Angst vor der Explosion des Sprengstoffs, der nicht erschüttert werden darf. Aber ich kann mir kein Urteil erlauben, denn ich habe ihn, als einer der Transporter in einem Teich von Rohöl stecken zu bleiben droht, unter dem Vorwand, aufs Klo zu müssen, verlassen und bin nicht wieder hineingegangen. Das Bild des Beifahrers, der im Rohöl zu versinken droht und den Fahrer, der aber vorankommen muss, anfleht, ihn nicht zu überfahren, hatte mich überfordert. Emil entschuldigte sich bei mir; er hätte nie gedacht, dass ein Film mit so angesehenen Schauspielern wie Peter van Eyck und Yves Montand so düster sein könne.
*
In der Schule gastierte ein russischer Pianist. Helche saß eine Reihe vor mir, und ich sah, wie gebannt sie lauschte, als er Ravels Gaspard de la nuit spielte, wie frenetisch sie Beifall klatschte, als der hypervirtuose letzte Satz verklungen war. War es Eifersucht? Ich plagte meine Eltern so lange, bis sie mir ein Klavier und Klavierstunden bewilligten. Aber bereits bei Der Weiße Hirsch und Flieg, Bienlein, flieg! gab ich auf. Ich erkannte, dass der Weg bis zur Sonatine von Ravel, dargeboten in russischer Perfektion, weit, sehr weit war – ‚und lieber will ich gar kein Pianist werden als ein schlechter!’ Auch diese Erfahrung schlug sich in Versen nieder:
„Wenn in Musik gefror’ner Sinn zerfließt
und eine Liebe malt, die nimmer endet,
wenn du im Traum die lispelnde genießt,
die auch gesättigt nimmer ab sich wendet …“
*
Eine Tanzstunde wurde angekündigt, die Teilnahme war freiwillig. Ich zögerte. ‚Warum sollte ich mich an einem Unterricht beteiligen, der mich zwang, mit Mädchen zu tanzen, die mir völlig fremd waren und die keinerlei Anziehungskraft auf mich ausübten? Ja, wäre Helche in meiner Klasse gewesen, dann hätte ich das durchstehen müssen – auf die Gefahr hin, auch dort von ihr völlig unbeachtet zu bleiben – was aus der Ferne leichter erträglich ist als aus einer Nähe, in der Schweiß- und Mundgeruch, sämtliche Peinlichkeiten der körperlichen Existenz unausweichlich spürbar werden. Nein, auch wenn sie in meiner Klasse wäre, ja, vielleicht gerade dann müsste ich diese altbackene Dressur verweigern. Wozu hatte ich mich an Ravel ergötzt, wenn er in La Valse den Walzer in Stücke reißt?’ Ich nahm also nicht teil; für die Überlegung, dass Tanzenkönnen zur Grundausstattung eines jungen Mannes gehört wie der Führerschein, war ich entweder zu jung oder nicht realistisch genug.
Die Folge war, dass ich, wenn ein Klassenfest stattfand, das man jetzt Fete nannte, vereinsamt an meinem Tisch sitzen blieb, während alle anderen sich paarweise ins Getümmel stürzten … ‚Ich bin nicht ausgeschlossen, ich habe mich ausgeschlossen!’, dachte ich und suchte Zuflucht in meinem Stolz. Ich besuchte mit Emil eine Ballettvorstellung des Nussknackers in der Oper; ja, das war Tanz, während dieser sogenannte Gesellschaftstanz doch nichts war als eine rudimentäre und verkümmerte Veranstaltung, ein bloßer, mit schlechter Konservenmusik grundierter Vorwand, um mit dem anderen Geschlecht körperlich in Kontakt zu kommen. Und diese meine Einstellung wandelte sich auch später nicht, als die Mode die Tanzenden immer stärker vereinzelte, ja, die Paarbindung schließlich völlig auflöste. Sobald in einer Runde Tanzmusik erscholl, stand ich auf und ging. Der meist überbetonte Rhythmus verletzte mein ästhetisches Empfinden und vermittelte mir das Gefühl, einer Masse angehören zu sollen, die sich hirnlos einem Bewegungsdiktat überantwortete – gerade so, wie es Soldaten taten, wenn sie nach staatlich verordneter Marschmusik in ebenso sinnlose wie mörderische Gefechte zogen.
Ein neuer Direktor wurde ans Lornsen-Gymnasium berufen, nachdem der alte in Pension gegangen war. Eine der ersten Amtshandlungen des forschen Neulings bestand darin, dass er alle Schüler aufforderte, sich im SAVOY den von Alain Resnais zur Hälfte gedrehten, zur Hälfte aus Originalaufnahmen kompilierten Dokumentarfilm Nacht und Nebel anzusehen. „Ich geh da nicht rein,“ erklärte Henning, „mein Onkel sagt, es sei ein deutschfeindliches propagandistisches Machwerk, das man nicht gesehen haben müsse.“ Aber dann ging er doch mit, und als er herauskam, weinte er. Es wäre falsch zu sagen, dass alle Schülerinnen und Schüler betroffen gewesen wären. Es war mehr eine graue und lethargische Fassungslosigkeit, die nach dem Sehen dieses Films wie Mehltau alles überzog. Viele freilich verschlossen sich auch seiner bei aller Dezenz der Vermittlung unfassbaren Botschaft, machten Witze und stellten in Frage, was vom Film als wahr vorausgesetzt wurde. Befragungen der Eltern blieben ergebnislos und endeten bei den immer gleichen Ausflüchten: Die Nazis hätten den vielen Arbeitslosen wieder Arbeit und Brot gegeben, hätten die Autobahnen gebaut, KdF-Reisen ermöglicht und die Grundversorgung der von Krieg, Hunger und Inflation verunsicherten Bevölkerung gewährleistet; Antisemitismus habe es zudem immer gegeben, gebe es auch heute noch vor allem in den Ländern, die ihn Deutschland vorwürfen, und die Amerikaner vor allem sollten sich nicht so aufspielen, sie hätten Völkermord an den Indianern begangen, und ihr Ku-Klux-Klan sei eine Schande. Zynismus und Sarkasmus griffen um sich. Ich erinnerte mich an Emils Ausspruch, er sei damals auch nicht klüger gewesen, und beschloss, mit ihm nicht mehr zu sprechen. Ich begriff, dass sie alle aus dem schwarzen Teich stiegen und dass die huldvolle Geste, mit der ich mich der Tochter eines offensichtlich Verstrickten zugewandt hatte, mir nicht gut zu Gesicht stand. Ich entfachte ein Feuer in der Aschkuhle des Hauses und verbrannte darin alles, was ich zusammengedichtet hatte als privaten, um nicht zu sagen barbarischen Plunder aus der Zeit vor Nacht und Nebel, aber nach Auschwitz.
Es begann nun ein Großreinemachen. Uns war klar geworden, dass wir uns blamiert hatten. Wir hatten geschwiegen, wenn der Geschichtslehrer die slawischen Völker in einem Nebensatz rassisch minderwertig und unfähig zur Staatsbildung genannt hatte, wir hatten geschwiegen und uns gefügt, wenn der Turnlehrer uns paramilitärische Antrete- und Richtübungen aufzwang, wir hatten geschwiegen, wenn der Physiklehrer für die deutsche Physik geworben hatte gegen die jüdische eines Einstein, der mit seinem Relativismus den angeblich gesunden Menschenverstand in Frage stelle, wir hatten geschwiegen, wenn der Kunstlehrer die Werke eines Liebermann als dekadent, eines Barlach und einer Käthe Kollwitz en passant als entartet diffamierte, wir hatten geschwiegen, wenn der Musiklehrer die Negermusik des Jazz als primitiv belächelte und wenn der Religionslehrer es als „eine durchsichtige Verleumdung Jesu“ bezeichnete, wenn behauptet werde, er sei jüdischer Herkunft gewesen …
Wut baute sich als Druck in unseren Bäuchen auf; viele sprachen zu Hause nicht mehr mit ihren Vätern. Henning brach den Kontakt zu seinem Onkel ab, der als Offizier im Führerhauptquartier am 20. Juli „auf der falschen Seite“ gestanden hatte, obgleich er auf der richtigen hätte stehen können. Ich war gleichsam gelähmt, ich funktionierte weiter, als ob nichts wäre, es hatte sich jedoch in mir eine furchtbare Leere ausgebreitet, in der die Worte widerhallten: „Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends,/wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts.“ Jetzt wusste ich endlich, was Poesie ist: Sprache, die sich der Wahrheit öffnet, mag sie auch entsetzlich sein. Ich hatte Alpträume von Lawinen von Brillen, von Schuhen, von Zahnprothesen, von Frauenhaar, die über mich herabstürzten und mich zu ersticken drohten, so dass ich, in Angstschweiß gebadet, aufwachte, nur damit sich in meinen Vorstellungen sogleich wieder ein Himalaya des Grauens auftürmte, vor dem ich mich meines Daseins schämte.
Die Wut entlud sich in einem Anschlag, der in einer der oberen Klassen auf einen besonders verhassten Geschichts- und Englischlehrer verübt wurde. Dieser nutzte jede Gelegenheit, um deutlich zu machen, dass der pseudowissenschaftliche Rassedünkel, der in den Abgrund geführt hatte, von ihm immer noch geteilt wurde. Die Poesie Heinrich Heines nannte er „dekadent“ und „verdorben“, die Musik eines Mendelssohn „epigonal“, die Philosophie von Karl Marx ein einziges Dokument „krankhaften Neides“, die Psychoanalyse Freuds war für ihn eine „Unterhosenwissenschaft“, und Shakespeares größte Leistung war es nach seinen Worten, dass er mit der Gestalt des Shylock frühzeitig auf den „größten Feind des Menschengeschlechts“ hingewiesen habe. All das hätte man vielleicht als das Halbirresein eines Unverbesserlichen ignorieren können, wäre da nicht ein kaum verhohlener Hang zum Sadismus gewesen.
In meiner Klasse gab es ein Mädchen mit Namen Alice Ohlsen. Ich hatte sie bei Krocket-Partien auf dem gepflegten englischen Rasen einer Villa am Kanal näher kennen gelernt, wo die Eltern alles dafür taten, ihre zahlreichen Töchter beizeiten mit vielversprechenden jungen Männern der Stadt zusammen zu bringen. Alice war alles andere als reizvoll; große glasige Augen rollten in einem kugelrunden Kopf, den eine strähnige Ponyfrisur schmückte, sie galt als hochintelligent, schrieb aber elende Zensuren, ihre Sprechweise war sorgfältig und zögernd, als habe sie immer Angst, Fehler zu machen, und oft waren ihre Beine blutig zerkratzt, weil sie an Neurodermitis litt. „Na, Alice, wieder in den Brombeeren gewesen?“, pflegte Dr. Kruse sie dann mit Blick auf ihre Waden anzureden, die sie nicht verhüllte, weil die Kombination Schottenrock mit weißer Bluse und Söckchen sommers bei Ohlsens Gesetz war. Und wenn Dr. Kruse ihr englisches Th nicht gefiel – Alice genierte sich, die Zunge zwischen die Zähne zu stecken – musste sie auf sein Geheiß vor die Klasse treten und so lange „this thick thing“ sagen, bis sie sich, rot übergossen, vor Scham wand.
Diesem Kruse nun fiel eines Morgens, als er Haralds Klasse betreten wollte, die Tür entgegen und begrub ihn unter sich. Mit gebrochenem Joch- und Nasenbein, weiteren erheblichen Gesichtsverletzungen und zerschmetterter rechter Clavicula wurde er ins Spital eingeliefert. Es wurde festgestellt, dass die Tür vorher aus den Angeln gehoben worden war, die Polizei wurde eingeschaltet, Fingerabdrücke überführten die sechs Schuldigen, die in feierlicher Relegation aus der Schulgemeinschaft ausgeschlossen wurden. Unter den Relegierten war überraschender Weise auch Harald Hirsebeck. ‚Donnerwetter’, dachte ich, ‚das hätte ich ihm gar nicht zugetraut! Aber wer weiß, was ihn dahin gebracht hat? Von seinem Vater heißt es, er sei auch nicht immer gewesen, was er heute ist.’ Vor ihrer Verstoßung wurden die Relegierten gefragt, ob sie sich bei Dr. Kruse, der mit verbundenem Gesicht und hochgelagertem Arm in der ersten Reihe saß, entschuldigen wollten. Zwei entschuldigten sich. Die anderen vier, unter ihnen Harald, lehnten es ab und murmelten, während sie im Gänsemarsch die Aula verließen, Verwünschungen zwischen zusammengebissenen Zähnen.
Viertes Kapitel
Ich besuchte meinen Freund Henning auf Testorff, dem Gut seiner Familie. Henning war Halbwaise, vergötterte seine kleine, verhutzelte Mutter, las ihr jeden Wunsch von den Augen ab und jeden Abend aus dem „Grünen Heinrich“ vor. Eine seiner Weimaraner-Hündinnen hatte geworfen, die Welpen mit den honiggelben Augen krochen auf Hennings Armen herum und leckten ihm das Gesicht. Henning hatte sie Wotan und Loge, Freya und Fricka genannt – das fast unmerkliche Grinsen, mit dem er mir diese Namen mitteilte, ließ offen, ob er damit den alten Germanengöttern huldigen oder sich über den mit ihnen in den glorreichen zwölf Jahren getriebenen neuheidnischen Kult lustig machen wollte. Wir hörten neue Aufnahmen der famosen Griechin, insbesondere „Casta diva“, die Arie aus Bellinis Norma, die sich mit hypnotischer Feierlichkeit in unfassbare Höhe schraubt. „Diese Musik, der Gesang dieser Frau – das ist mein einziger Trost!“, sagte Henning. „Alles andere ist besudelt und heruntergekommen durch den gigantischen Verbrechensstrudel, der in all seiner quantitativen Größe qualitativ klein, kleinlich und spießig ist. Komm, lass uns Schach spielen!“
Ich setzte zu Aljechins Eröffnung an, aber Henning schüttelte den Kopf und sagte: „Nicht die. Aljechin hat auch kollaboriert.“ Wir spielten Damengambit, Henning bemerkte: „Meine Vorfahren, weißt du, haben Hunderte von Jahren immer wieder Krieg geführt, mein Vater ist im letzten auf dem Feld der Ehre gefallen, das zu einem Feld der Schande geworden ist. Auch Krieg hat seine Fragwürdigkeit, ja, seine Absurdität, insbesondere seit den Bomben auf Dresden, auf Hiroshima und Nagasaki, aber die Schande, wehrlose Menschen, Kinder, Frauen, Alte unter lügenhafter Vorgaukelei zu Tausenden, ja, Millionen mit Hilfe ihrer eigenen eingeschüchterten Institutionen in den Tod durch Erschießen oder Vergasen getrieben zu haben, diese Schande wäscht nichts und niemand je wieder von uns ab!“
*
Ebenso stilles wie schauerliches Beweisstück der Wahrheit all dessen, was Nacht und Nebel dokumentiert hatte, war die Tatsache, dass es von den Menschen, die dem Rassismus der Eltern zum Opfer gefallen waren, keine mehr gab, mit denen man ein Wort über alles hätte wechseln können. Um Spuren von ihnen zu finden, durchwanderten Henning und ich unsere Stadt, in der es in guten dänischen Zeiten, als „judenfrei“ noch „für Juden frei“ bedeutete, aber auch noch danach eine lebendige jüdische Gemeinde gegeben hatte. Auf Zehenspitzen schlichen wir an dem Grundstück vorbei, auf dem dem Vernehmen nach einst der Hebräertempel gestanden hatte. Er war zerstört, gesprengt und abgetragen, vom Erdboden ebenso verschwunden wie diejenigen, die ihn einst besucht hatten. Der Friedhof lag hinter einer hohen Mauer und war durch ein eisernes Tor versperrt – gerade als ob man noch die Toten von den Lebenden fernhalten und in ein Ghetto sperren müsse. „Nein, es ist umgekehrt,“ erklärte Henning. „Man muss die Lebenden fernhalten, damit die Totenruhe gesichert ist. Es gibt ja immer noch viel zu viele von diesen Hirnkranken.“ Wir drückten die Stirnen an die kaltmetallenen Trallen, in die der Davidstern eingeschmiedet war, und sahen graue, grünlich veralgte Grabsteine, viele von ihnen geneigt, manche umgefallen – oder umgestoßen? – unter halbhohen Eichen und Buchen stehen. Einer war so nah, dass wir die Beschriftung hätten lesen können – aber sie war bis auf einen Namen hebräisch. Der Name lautete Abraham Blümlein.
„Was würde wohl passieren, wenn wir uns mit einem Schild ‚Suchen einen überlebenden Juden!’ auf die Schlossstraße stellten? Da kommen so viele Menschen vorbei – es müsste doch noch der eine oder andere dabei sein.“ Henning hatte diese Idee.
Ich war Feuer und Flamme. Wir besorgten ein Stück Pappe, schrieben unser Sprüchlein drauf, hefteten es an einen Holzstock und postierten uns vor einem gutbesuchten Modegeschäft.
Schon nach wenigen Minuten kam der Besitzer heraus und sagte: „Verschwinden Sie hier! Was soll der Quatsch?“
Wir stellten uns vor eine Eisdiele. Die Leute lasen neugierig das Schild und gingen starren Blicks vorüber.
Ein Fotograf des Volksfreunds nahm uns auf und stellte ein paar Fragen. Er verlor schnell das Interesse und bekam nicht mit, wie ein Mann stehen blieb, das Schild und Henning, der es hielt, stahlgrau und allwissend in die Augen sah. Henning hielt seinem Blick lächelnd stand. Der Mann trug einen Lodenmantel und ebensolchen Hut, den er mit einer Fasanen- und einer Häherfeder geschmückt hatte. Ich stand daneben, und der Blick des Fremden traf nun mich. „Dich hat er wohl schon gefunden, was?“, fragte er – und rotzte mich an, dass es mir von der Jacke troff. Der Lodenmantelträger wurde von einer Frau fortgezogen, die aus einem Geschäft kam und den Jungen halb entschuldigende, halb entrüstete Blicke zuwarf, als ob sie sagen wollte: „Er ist nicht ganz bei Trost.“
Dann geschah nichts mehr. Nach zwei Stunden war unsere Geduld erschöpft, wir bekamen kalte Füße. Wir wollten gerade gehen, da blieb eine alte Frau mit einem karierten Kopftuch stehen, sah uns an, blickte dann zum Schild auf und sagte: „Warum sucht ihr nur jüdische Überlebende? Überlebende sind wir alle! Deutschland war ein einziges großes KZ, auf das die Alliierten ihre Bomben warfen! Ich war zweimal verschüttet. Wollt ihr meine Narben sehen?“ Sie machte Anstalten, ihre Bluse aus dem Rock zu ziehen, aber andere Passanten drängten sie ab, und sie verschwand im Gewühl.
*
Die Aktion hatte ein Nachspiel: Wir wurden zu Petri gerufen wurden, der uns den Zeitungsartikel im Volksfreund vorlegte. Dort wurde hervorgehoben, dass es sich um zwei Schüler des Lornsen-Gymnasiums gehandelt habe, die diese Aktion veranstalteten, „um ein trauriges Kapitel der deutschen Geschichte sinnfällig vor Augen zu rücken“. Dort war auch zu lesen, dass das Modegeschäft, vor dem wir zuerst gestanden hatten, bis 1935 in jüdischem Besitz gewesen war. Petri bat uns, in Zukunft solche Aktionen mit ihm abzusprechen, damit er nicht aus der Zeitung davon erfahre. Als ich erzählte, dass ich angespien worden sei, erwiderte Petri: „Freuen Sie sich, dass es dabei geblieben ist und dass Sie nicht Ärgeres haben einstecken müssen. Es wird noch lange dauern, bis die Menschen hierzulande der Wahrheit werden ins Gesicht sehen können. Das ist wie mit der Medusa. Erinnert ihr euch?“ Er schüttelte in komischer Verzweiflung den dunklen Lockenkopf, als er die Fragezeichen in unseren Augen sah. „Man konnte sie nicht ansehen, ohne zu versteinern. Deshalb lenkte Perseus, als er ihr den Kopf abschnitt, seine Hand, indem er in den spiegelnden Schild sah. Nacht und Nebel war ein solcher spiegelnder Schild.“
Einige Tage später traf bei Petri ein Brief ein, den dieser an uns weitergab. Er lautete:
Sehr geehrter Herr Petri,
bitte verzeihen Sie, dass ich mich an Sie wende, da mir die Anschrift der beiden Schüler, die in der Schlossstraße nach einem Überlebenden gesucht haben, nicht bekannt ist. Da sich offenbar niemand bei ihnen gemeldet hat, möchte ich das tun, obgleich ich keine Jüdin bin. Ich war aber mit einem Mann verheiratet, der, Christ, jüdischer Herkunft war und deshalb verfolgt wurde. Als er gezwungen wurde, den gelben Stern zu tragen, machte er seinem Leben ein Ende. Ich könnte den beiden jungen Männern nicht viel, aber vielleicht ein wenig über das jüdische Leben hier in meiner Heimatstadt erzählen. Sie dürfen mich jederzeit gern anrufen. Hochachtungsvoll
Erna Würzburger
Wir reisten in den nächsten Wochen mehrfach in die Nachbarstadt und trafen dort mit Frau Würzburger zusammen, der Witwe des verstorbenen Rechtsanwalts Max Würzburger. Henning machte sich Notizen von allem, was sie erzählte; ich merkte, dass sein Interesse vom Schuldgefühl erdrückt wurde. Unvergesslich blieb ihm ein Besichtigungsgang, zu dem Frau Würzburger uns einlud und für den sie sich einen Schlüssel in einem Fischgeschäft holte. Sie schloss die Tür eines aus rotem Klinker errichteten Gebäudes auf. Schon im Flur drang uns schwer und fettig riechender Qualm entgegen, der die Augen beizte; ich erinnerte mich, wie Vilma kurz nach der Währungsreform mit einem in Zeitungspapier gewickelten Etwas heimgekommen war, es ausgewickelt und einen goldbraun schimmernden Fisch enthüllt hatte, einen Bückling, von dessen apartem Fleisch und Rogen ich gar nicht hatte genug bekommen können …
Wir traten in einen würfelförmigen Raum; die Wände troffen von gelblich-bräunlichem Niederschlag, überall standen Kisten und Kasten, Fässer und Tonnen, und auch hier roch es intensiv nach Holzrauch und Fisch. „Dies war bis zum 9. November 1938 der Betsaal der Synagoge,“ erläuterte Frau Würzburger. „Ihr seht noch an der kassettierten Decke, dass der Raum einmal anderen, weniger prosaischen Zwecken diente. Die Fächer waren ornamental ausgemalt, aber das hat der Sott alles überlagert und abblättern lassen. Dort oben die Fenster – dort saßen die Frauen. Und hier befand sich der Thoraschrein, in den sie eine Handgranate warfen. Auch ich habe dort oben auf der Empore gesessen. Bevor mein Mann sein Leben beendete, ist er zum Judentum zurückgekehrt, was ich ihm nicht verdenken kann; denn die Christen unterstützten in ihrer weit überwiegenden Mehrheit seine Verfolgung und Entrechtung nur wegen einer Herkunft, die er doch mit ihrem Heiland und Gott gemeinsam hat. Wobei ich ‚unterstützen’ auch das verlegene und beklommene Wegschauen derer nenne, die sich dessen heute oft genug schämen. Aber es gab auch viele, die den Wahnsinn so weit trieben, dass sie Jesus Ariertum andichteten. Und ohne die Kooperation der Kirchenämter wäre die jüdische Herkunft vieler Verfolgter nicht nachweisbar gewesen und unbekannt geblieben. So traurig es ist, aber der Fanatismus, unter dem wir – auch wir Ehefrauen jüdischer Männer – zu leiden hatten, wurde nicht nur von den pervertierten staatlichen, sondern auch von gewissenlosen und opportunistischen kirchlichen Institutionen mitgetragen.“
„Ich sitze in der Küche am Tisch,“ schrieb ich in mein blaues Heft, „die weißen Punkte auf dem roten Wachstuch springen mir in die Augen. Ein durchfettendes Zeitungspapier rollt sich von selbst auseinander und enthüllt einen Bückling. Aber das sonst so zarte Fleisch will zwischen den Zähnen nicht nachgeben, es ist zäh und fasrig. Etwas Fremdes hat sich dazwischen geschlichen, ich ziehe es aus dem Mund, ziehe und zerre, und als ich das lumpige Fetzchen auf den Tisch lege – hat es die Form von zwei verkehrt aufeinander gelegten Dreiecken.“
*
Henning kam zu mir auf Gegenbesuch. Vilma, die an Migräne litt, war zur Kur nach Bad Wildungen, Emil verbrachte wie üblich den Abend mit Zeitunglesen, Sumatrarauchen und Portweintrinken im Wohnzimmer. Direkt daneben, nur durch eine verglaste Schiebetür und einen Art-Déco-Vorhang getrennt, lag das Zimmer, in dem mein Gast und ich uns über Nacht aufhalten sollten. Wir hatten bis spät in der Nacht die Grünfeld-Variante studiert und ausprobiert, waren dann müde ins Bett gefallen und gleich eingeschlafen. Nach Mitternacht legte sich etwas auf Maltes Arm. Es war Hennings kalte Hand, sein Gesicht näherte sich im Halblicht dem meinen, und für einen Moment durchzuckte mich die Angst, mein Freund wolle mich küssen. Aber dann hörte ich Emils Stimme aus dem Wohnzimmer, der gedämpft, aber insistierend darauf bestand, dass alles nur ein „Missverständnis“ sei. Aber wem sagte er das? Telefonierte er? Der Tisch wurde gerückt, ein Stuhl fiel um, die Prothese des Vaters trat dumpf aufs Parkett.
„Das geht schon seit mindestens zehn Minuten so!“, flüsterte Henning. „Es ist eine Frau bei ihm!“ Es wurde ein Weilchen still.
„Nein, es ist gut! Es ist gut!“, hörte man plötzlich die Frauenstimme mehr zischen als sprechen, und kurz darauf wurde der Vorhang beiseite gerissen, die Schiebetür aufgeschoben, eine hochgewachsene Gestalt stürmte durch unser Schlafzimmer, warf das Rouleau empor, riss das Fenster auf, setzte ein Knie auf die Fensterbank, schwang das andere Bein hinaus, das Rouleau fiel herab, man hörte Schritte sich schnell entfernen.
„Wer war das?“, fragte Henning.
„Keine Ahnung,“ murmelte ich. Henning zog sich die Decke über die Schultern.
„Ist ja richtig lebendig hier! Bitte mach das Fenster zu, es wird kalt.“
Ich spähte hinaus, als ich das Fenster schloss, aber die Straße lag still und verlassen im kalten Neonlicht der Röhren an den Peitschenmasten.
Emil kam aus dem Bad hereingekrückt, bereits im Nachthemd, aus dem der Stumpf kläglich herabbaumelte, und sagte: „Tut mir leid. Aber es war nichts von Bedeutung. Völlig bedeutungslos. Macht euch keine Gedanken. Schlaft weiter!“
Tags darauf kam ich von der Schule ins leere Haus. Scheu sah ich ins Wohnzimmer mit dem Schreibtisch, den Bücherschränken und dem Clubsessel auf dem grauschwarz gerauteten Teppich, ob es Spuren des nächtlichen Zerwürfnisses gäbe, das mir so unwirklich vorkam, dass ich versucht gewesen wäre, es für einen Alptraum zu halten, wenn Henning es nicht in der Schule kopfschüttelnd bestätigt hätte. Aber es war alles aufgeräumt und wie sonst, die Portweinflasche stand neben der Kiste mit Sumatra-Zigarren auf dem rollbaren, mit Solnhofener Schieferkacheln eingelegten Rauchtisch. Doch dann schaute mich aus dem Papierkorb ein mehrfach geknifftes, jetzt entfaltetes Blatt an, das mir bekannt vorkam. Ich zog es heraus. Es stand ein Gedicht darauf, dessen letzte Zeilen lauteten:
„Schlohweiß entsteigst du, Nixe, schwarzem Teich,
behängt mit Algen nur und Krötenlaich.“
*
In den folgenden Wochen war ich häufiger auf dem gepflegten englischen Rasen der Ohlsen-Villa am Kanal anzutreffen. Alice erwies sich als eine amüsante und amüsierte Spielpartnerin, die nichts mehr liebte, als wegzuschlagen und weggeschlagen zu werden. Dieses zentrale Recht des Krocketspielers, eine gegnerische Kugel, die er angeschossen hat, in die fernere Umgebung hinauszuschmettern, indem er gegen die eigene, davor gelagerte und mit dem Fuß gehaltene, schlägt, nannte Alice croquieren, ich hingegen krockettieren. Hierüber stritten wir uns so lange zuerst im Spaß, dann im Ernst, bis wir unter einer Trauerweide beschlossen, unseren Streit mit einem Kuss zu beenden; und dieses von Alice erstaunlich feucht und langwierig ausgeführte Mundmanöver, bei dem sie keinerlei Schwierigkeiten hatte, die Zunge zwischen den Zähnen hervorzustrecken, besiegelte unsere von Tag zu Tag zärtlicher werdende Freundschaft, die freilich die Grenze des sittlich Gebotenen nie überschritt. „Lass sie uns meiden, die Wonnen der Gewöhnlichkeit!“, hatten wir einander, aus Tonio Kröger zitierend, den wir gerade gelesen hatten, eines Nachts versprochen, als unsere Münder gar nicht wieder auseinander fanden unter der Trauerweide, während die Lichterketten eines großen russischen Frachters lautlos vorüberglitten.
Wir lasen den Briefwechsel von Abälard und Héloise, fragten uns schaudernd, was Héloise wohl gemeint hatte, als sie ihren Geliebten bat: „Lass mich deine Hure sein!“ Wir lasen Stolz und Vorurteil von Englands weiblichem Shakespeare und Sturmhöhe von der dämonischen Emily Bronté, lasen Krieg und Frieden von Tolstoi, ich wurde Bolkonsky und Alice wurde Natascha und sagte: „O, was für ein Glück, den Geliebten so aufopferungsvoll pflegen zu dürfen!“ – und für uns war es eine wohltuende Erfahrung, dass zwischen Junge und Mädchen, Mann und Frau geistiger Austausch und gegenseitige Anregung möglich war. Ich hatte die Liebe nur als einseitige Anbetung kennengelernt, hatte mich verausgabt, ohne je eine Reaktion zu erhalten, ich war völlig ausgedörrt, und nun erfüllte sich mein Seelenleben wieder mit Neuem und Bedeutendem. Alice schrieb bessere Zensuren und trat selbstbewusster auf, sogar ihre Neurodermitis ging zurück, ihre oft so glasigen Augen konnten jetzt richtig funkeln, sie zwirbelte sich Löckchen in ihr unansehnliches Haar und wurde Klassensprecherin. Ich ging zwar immer noch mit Henning im Pausenkreis, aber es war Alice, der ich begegnen wollte, während die fischige Helche mich völlig kalt ließ. Ihr Vater war trotz des milden staatsanwaltlichen Plädoyers verurteilt worden und in die nächste Instanz gegangen. Was ihm zur Last gelegt wurde, interessierte mich nicht mehr; in der Nacht des Henningbesuchs war ich doppelt verraten worden: Von Helche und von meinem Vater. Beide fielen meiner hasserfüllten Verachtung anheim.
Petri, der neue Schuldirektor, war ein wahrer Menschenfischer. Er las mit uns Strindbergs Traumspiel, Brechts Kaukasischen Kreidekreis, Sartres Fliegen und Osbornes Blick zurück im Zorn, und wir lasen diese Werke nicht nur, wir führten sie auch auf, was zu einem Sturm der Entrüstung unter den Eltern führte. In meiner Klasse unterrichtete er leider nicht, sie blieb Studienrat Möller überlassen, einem grauen Verfechter der Inneren Emigration, wir mussten uns mit Texten von Wiechert, Carossa und Bergengruen begnügen und den langweiligen Begründungen dafür lauschen, warum Thomas Mann Deutschland „verraten“ habe, als er ins Ausland ging. „Was – bis auf ein paar Widerstandskämpfer – gab es in diesem Deutschland denn, das nicht förmlich danach schrie, verraten zu werden?“, fragte ihn Henning und kassierte dafür eine Fünf im nächsten Aufsatz. In den Pausengesprächen kursierte der Ausspruch, „auch Möller könnte eine Tür vertragen“; eine Auffassung, die ich nicht teilte. Studienrat Dr. Kruse war durch das auf ihn verübte Attentat in seinen Vorurteilen eher gefestigt worden. So wurde berichtet, er habe die Relegierten als „bolschewistische Halunken“ bezeichnet.
Am langweiligsten waren jedoch die Stadttheaterbesuche, die Möller uns verordnete – als Ausgleich dafür, dass er mit uns keine Stücke aufführte. Einmal mussten wir uns eine plüschige und von Blechhelmen rasselnde Johanna von Orléans anschauen (Brechts Heilige Johanna der Schlachthöfe, die Petri in seiner Klasse las, wäre uns lieber gewesen). In der Pause schlug Henning vor, einen Ausflug an den Hafen zu unternehmen, um sich so dem langweiligen Absitzen der restlichen Akte zu entziehen. Vier Jungen, auch ich, waren sofort bereit, und erstaunlicherweise schloss sich auch Alice an. Wir landeten in einem Etablissement mit dem vielversprechenden Namen Peppermint-Bar. Henning machte uns darauf aufmerksam, dass auf dem Schild am Eingang zwar honette Preise standen, aber mit der winzigen Anmerkung: „Ohne Musik“. Musik jedoch war immer, das hörte man schon von draußen.
Als ich mich ans Halbdunkel, den Tabakrauch und das aufreizend jaulende Genäsel einer Hammondorgel gewöhnt hatte, nahm ich vor allem eines wahr: Alice beobachtete mit unverhohlener, förmlich gieriger Neugier, wie die Mädchen, die hier arbeiteten, mit Gästen anbandelten, indem sie mit ihnen tanzten, sich auf ihre Knie setzten, ihr Gesicht in ihrem Schoß vergruben, mit ihnen aus einem Glas tranken und eine gemeinsame Zigarette rauchten – bis sie sie so weit hatten, dass sie mitkamen – die Treppe an der grün lasierten Wand hinauf, wo eine Tür ins Hausinnere führte. Das erinnerte mich daran, wie ich als dummer kleiner Kalendertaschenträger von Harald bei einer Brause im Wintergarten sitzen gelassen wurde. War ich inzwischen klüger geworden? Alice machte mir Mut, mit ihr zu tanzen – es war ohnehin nur ein Herumgeschiebe auf der winzigen Tanzfläche – ich tanzte mit ihr oder vielmehr ahmte nach, was ich für Tanzen hielt, Alice wurde vom Personal misstrauisch, von einigen Gästen höhnisch beäugt, was sie verlegen machte, aber ihre Wangen glühten. Als wir an unseren Platz zurückkehrten, kam ein bulliger Werftarbeiter in Blauzeug, der hier wohl gerade seinen Wochenlohn verjubelte, schlug Alice mit der flachen Hand auf den Hintern und resümierte: „So rech nix drin inne Büx!“
„Ich bitte Sie!“, protestierte ich, aber der Kumpel erwiderte: „Bitt mich lieber um nix. Bist du nich der Sohn von Staatsanwalt Ossenblom? Der bist du doch! Mit dem hab ich noch ne Rechnung offen! Sag ihm n schönen Gruß von mir!“
„Dafür müssten Sie mir Ihren Namen sagen,“ erwiderte ich kalt. Der Kumpel grinste höhnisch.
„Trallenkieker! Grüß ihn vom Trallenkieker!“
„Lass uns gehen!“, raunte Alice und bezahlte ungerührt die überhöhte Rechnung. Wir verdrückten uns aus dem Schuppen, die anderen schlossen sich an, weil es an der Zeit war, zu Schillers rasselnden Blechhelmen zurückzukehren. Unser Fernbleiben war Möller, der während der Aufführung von Klassikern, die er auswendig kannte, regelmäßig einschlief, nicht aufgefallen.
„Ich bring dich nach Hause, schönes Fräulein!“, bot ich Alice an, die noch mit der Nachtlinie der Straßenbahn an den Kanal hinausfahren musste. Sie erwiderte:
„Bin weder Fräulein, weder schön,/ kann ungeleitet nach Hause gehn!“
Aber dann lag sie doch so weich in meinem Arm, der alte Straßenbahnkasten rumpelte über Weichen und rüttelte uns noch enger zusammen, wir wurden stumm vor Zärtlichkeit füreinander. Ich begleitete sie zur Villa, wo sie aber nicht gleich hinein- und schlafen gehen mochte. Die letzte Bahn zurück war jetzt sowieso weg, was ihr einen Grund lieferte, bei mir auszuharren. „Weißt du, woran ich immer habe denken müssen in der Peppermint-Bar? An das Wort von Héloise ‚Lass mich deine Hure sein’ …“
„Ich habe nie verstanden, warum sie sich so erniedrigt,“ erwiderte ich. „Ich habe an etwas ganz anderes denken müssen, an die Worte des einzigen inneren Emigranten, den ich zu achten vermag: ‚Zwei Welten steh’n in Spiel und Widerstreben,/allein der Mensch ist nieder, wenn er schwankt,/er kann vom Widerspruch nicht leben,/obwohl er sich dem Widerspruch verdankt.’“
Wir standen unter der Trauerweide, unter der wir uns zum ersten Mal geküsst hatten, Alice hatte sich rücklings an mich gelehnt, wir schauten über den dunklen Kanal. „Lass mich deine Hure sein!“, raunte Alice inbrünstig und presste sich an mich. Nun brach auch bei mir der Damm, und schon nach wenigen Minuten hauchte Alice zu meinem Entzücken und mit zärtlich glucksender Begeisterung die Worte, mit denen sie von Dr. Kruse so oft gequält worden war.
*
„Weißt du eigentlich, dass du genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen bist?“, fragte Alice, als wir einmal miteinander am Kanal entlang radelten. Ich wartete, was sie mir erzählen wollte. „Ich sollte eigentlich wegen meiner Neurodermitis verschickt werden. Dann hätten wir uns wohl kaum oder erst sehr viel später kennen gelernt. Ich sollte ein Vierteljahr in Kur fahren.“
„Und wohin?“
„Ans Tote Meer!“
„Das soll gut sein?“
„Ja. Die Sonne, der hohe Salzgehalt des Wassers … Hast du nie davon gehört? Das Wasser ist so dickflüssig von Salz, dass man darin auf dem Rücken schwimmend Zeitung lesen kann!“
„Und warum bist du nicht gefahren?“
„Du warst mein Totes Meer!“
Wir legten eine Wolldecke aus, Alice hatte einen Picknickkorb vorbereitet mit wunderhübschen Schüsselchen, Tellerchen und Tässchen aus blaugrundigem Wedgwood mit Laubdekor. „Von meiner Großmutter,“ sagte sie. „Sie war Engländerin, und ich heiße nach ihr.“ Riesige Frachter glitten vorüber. Wir sahen einander an. Wir hatten die Backen voll. „Schluck schnell runter,“ sagte Alice. „Ich will, dass du mich küsst.“
*
Herr Möller erkrankte an der Leber, Herr Petri vertrat ihn und las mit meiner Klasse Büchners Woyzeck, wir beschäftigten uns mit dessen Leben und dann mit dem des Namenspatrons der Schule, des Sylters Uwe Jens Lornsen, der ein knappes Jahr nach Büchner ebenfalls in der Schweiz gestorben war, allerdings durch Selbstmord im Genfer See und nicht an Typhus in Zürich. „Stellt euch vor,“ zündelte Petri, „man hätte Lornsen, der nach Brasilien geflohen war vor den Häschern der Reaktion, man hätte ihm den Hessischen Landboten Büchners zukommen lassen – wie begeistert wäre er gewesen! Er, der den Deutschen immer wieder vorwarf, in Erbsenzählerei zu versinken, hier hätte er den Atem des wahren Revolutionärs verspürt, wäre bereits 1836 von Brasilien zu Schiff los – und hätte sich mit ihm, der ebenfalls von der deutschen Polizei gesucht wurde, in Zürich getroffen! Natürlich klammheimlich! Was wäre wohl aus dieser Begegnung entstanden? Wie hätte Büchner das Schicksal des mehr als zwanzig Jahre Älteren in Szenen zu fassen gewusst – seine Krankheit, seinen Wahnsinn, seinen hoffnungslosen Patriotismus, die Liebe zu seiner Schwester – was für ein Material! Warum nur bin ich beamteter Pädagoge geworden und nicht freier Schriftsteller? Jetzt habe ich ein festes Gehalt und eine gesicherte Zukunft – aber was ist das wert, wenn diese Zukunft eine leere Einbahnstraße in die Pensionierung, ins Verschwinden in der Namenlosigkeit ist?“ Er warf die Tafelkreide hasserfüllt auf den Boden und sank vernichtet auf einen Schemel.
Georg Büchner schreibt ein Stück über Uwe Jens Lornsen, unter diesem Arbeitstitel begann die Klasse mit Feuereifer Szenen zu entwerfen, die auf der Bühne in der Aula, über der das Negativ einer längst entfernten Swastika auf der Wand noch menetekelte, geprobt und verbessert wurden. Wie Erkel, Lornsens Schwester, bereits von Wahnsinn gezeichnet, am Spülsaum bei List ein Kleiderbündel findet und es für ihren ertrunkenen Bruder hält … Wie Lornsen den Homöopathen Pêchier aufsucht und ihn anfleht, ihm zu helfen … Wie er in einer Kirche den Kelch nimmt – und dann kriecht die Angst in ihm hoch, dass er alle mit seiner Flechtenkrankheit infiziert hat … Wie er sich zuerst die Pulse aufritzt, dann ins eiskalte Wasser geht und sich mit der Pistole ins Herz schießt … Wie der Vater von seinem Tod hört und ihm den Nachruf widmet:
„Selbstherrlich warf er ab des Lebens Joch –
was er litt, möcht’ ich keinem gönnen.
Schade ist es doch –
es hätte immer noch
was Ordentliches aus ihm werden können.“
Die Reime hatte ich eingearbeitet und hatte dafür das Heft ausgegraben, in dem ich über die in meinen sonnets an Helche benutzten Reime Buch geführt hatte; es war dem Autodafé meiner gesammelten Dichtungen entgangen. Petri war der Meinung, man müsse gerade das Empörerische auf eine Weise fassen, dass es wie in Erz gegossen wirke. Henning von Testorff spielte den Vater, der sich einmal als dänischer König verkleidet, ich spielte den Lornsen, und Alice Ohlsen als Erkel war so erschütternd, dass der Zuschauerraum weiß von Tempos war wie ein Margeritenfeld.
Fünftes Kapitel
Emil hatte die Planstelle durch den Federstrich eines Beamten der Justizverwaltung ergattert, seine eigentliche Heimat war das Ruhrgebiet. Durch einen Bergschaden hatte sich die Notwendigkeit ergeben, im Wohn- und im Schlafzimmer seines Elternhauses eine Treppe einzufügen, und die Unterhöhltheit des Bodes, das stille, ferne und gefährdete Wirken der Männer, auch seines Vaters, tief unten in Schacht und Stollen der Zeche Friederika hatte sein Lebensgefühl geprägt, die meeroffene Stadt erschien ihm flach und zweidimensional. Vilma hingegen war in einer Hansehafenstadt aufgewachsen, in der es nach senatorenhafter Behaglichkeit, nach Tradition, Fisch, Bordeaux in Eichenfässern und kaufmännischem Stolz roch. Ihre Heimatstadt erschien ihr aber eher von der gründerzeitlichen Hektik und Fiebrigkeit erfüllt, durch die sie groß geworden war, ihr war die Poesie des langsam und verlässlich Gewachsenen abhanden gekommen, trotzdem sehnte sie sich Zeit Lebens nach Hause zurück, obgleich der Krieg in der Hansestadt kaum einen Stein auf dem anderen gelassen hatte.
‚Eigentlich gehöre ich gar nicht hierher,’ dachte ich oft. ‚Ich bin vom Herkommen her ein Ruhrpott-Hansestadt-Zwitter, ein bloßer bürokratischer Zufall hat mich wie einen schiffbrüchigen Robinson in dieser gesichtslosen Garnisonsstadt an Land geworfen. Aber wo sind meine Wurzeln?’ Um so erfreuter, ja, fast andächtig nahm ich die viel tiefere Verankerung von Alice zur Kenntnis. Ihre englische Großmutter hatte einen altansässigen von Ahlefeld geehelicht, nach dem sogar eine Straße hieß; er hatte sich mit der Wiederbelebung des Umschlags einen Namen gemacht, eines Termins im Januar, zu dem sich alljährlich unverabredet Kaufleute und Magnaten in der Stadt vornehmlich zu Kreditgeschäften getroffen hatten und der sich alsbald zum Volksfest mit Karussells und Schmalzgebackenem auswuchs. Das in edelstem, fast fadem Klassizismus aufgeführte Gutshaus dieses Großvaters erschien mir als vergangenheitsgesättigtes manor-house aus einem Roman von Jane Austen. Ich besuchte es mit Alice, die dort ihren Cousin Ludbert begrüßte, im Familienkreis „der Sofahocker“ genannt auf Grund der faulen Unbeweglichkeit, mit der er, vorm Fernseher kauernd und Chips in Unmengen vertilgend, darauf wartete, endlich über ein Erbe verfügen zu dürfen, das er umgehend am Travemünder Roulettetisch zu verdoppeln gedachte.
„Du solltest hier Hausherrin sein!“, sagte ich schmeichelnd, „du könntest diese Herrlichkeit mit einer Seele füllen und als erstes die widerlichen Trophäen herausreißen, mottenzerfressene Löwenköpfe und Staubfänger von Elchgeweihen …“ Alice aber glaubte nicht, dass sie sich dafür eignen würde:
„Das Erbgut meiner ritterlichen Vorfahren ist an mir vorbeigeflutscht!“, sagte sie mit komischem Bedauern. „Repräsentieren liegt mir nicht, über den Posten der Klassensprecherin werde ich nie hinausgelangen. Lieber als in diesem Manderley möchte ich in einer der Soldatenwohnungen leben mit Klo auf halber Treppe, von denen es Tausende gibt. Vielleicht würde man dort noch den Pulverdampf der Novemberrevolution schnuppern, mit der hier wackere Matrosen die Männerabschlachtorgie, genannt Erster Weltkrieg, zu Ende gebracht haben!“
Dennoch führte mich Alice auch dorthin, wo einst das Stadtschloss gestanden hatte, in dem ein später ruchlos Ermordeter seinen ersten Schrei getan hatte, jener unglaubliche Zar, der Frieden mit Friedrich II. geschlossen und dadurch Preußen vor dem Untergang bewahrt hatte. „Es ist gut, dass wir uns immer vorsehen, wenn wir zusammen sind,“ sagte Alice. „Aber wenn ich doch einmal schwanger werden sollte, glaub nur nicht, dass ich es wegmache.“ Das sagte sie mit so ruhiger Überzeugtheit, dass ich mich unwillkürlich ein wenig beugte, als gälte es, eine unerwartete Last zu schultern. Alice lächelte und stupste mich mit der Schulter. „Nur keine Sorge,“ sagte sie, „ich mach es auch alleine groß!“
Der alte Zentralbau der Stadt war Luftminen zum Opfer gefallen, die eigentlich der Werft Mennig & Kliet und den auf Reede liegenden Kriegsschiffen gegolten hatten. Ähnlich war es der alten Universität ergangen, so dass nach dem Krieg in den Gebäuden einer ehemaligen Pulverfabrik gelehrt, geforscht und studiert werden musste. Alice und ich standen vor dem Trümmerhaufen, der von einem Adelshof aus dem 18. Jahrhundert geblieben war und der gerade weggeräumt und mit schweren Lkw abgefahren wurde, und betrauerten den Verlust der würdevollen Häuser am Alten Markt mit ihren dichten Fensterzeilen, die der Stadt, stünden sie noch, wenigstens einen Hauch von Fernhandelseleganz verliehen hätten. So aber waren an die Stelle des ohnehin wenigen Alten überall die Klötze und Betonboulevards des Wirtschaftswunders getreten und hatten eine Stadt geformt, die nur im Sommer, wenn auf der Förde Segel wie Lilien erblühten und bunte Spinnaker wie Papageien sich blähten, ein wenig Schönheit zurückgewann. Freilich tauchten auch die grauen und kaum wahrnehmbaren Ungetüme wieder auf, die der Krieg mit der See erzeugt, lagen unscheinbar wie gestrandete Wale in Docks oder zeigten die aggressiven Penisse ihrer Lafetten.
„Warum ist eigentlich der Krieg als Mittel der Politik ein, wie es scheint, völlig unausrottbarer Missstand?“, wollte Alice von mir wissen, als wir ein solches Monstrum ausmachten, das mit lauernder Friedfertigkeit am Kai wippte.
„Ich fürchte, aus einem ganz einfachen Grund,“ erwiderte ich. „Krieg macht Spaß. Seine Vorbereitung bringt Geld und schafft Arbeitsplätze. Wenn er dann ausbricht – wie ein Vulkan!, gerade als ob es nicht Menschen wären, die ihn machten! – dann produziert er zwar unendliches Leid, aber zugleich sättigt er auch den Schicksalshunger der Menschen, die sich in Friedenszeiten bei der Erledigung immer gleicher Alltagsroutinen langweilen und es genießen, wenn Angst und Schrecken, Hunger, Frieren und Sterben an ihre Stelle treten – und nicht nur Leid, sondern auch Gesprächsthemen schaffen! Der trojanische Krieg hat drei Jahrtausende mit Gesprächsstoff versorgt – vom folgenden Frieden hingegen redet niemand. Hast nicht sogar du Friedliebende schon bedauert, nicht die Natascha eines schwerkriegsverletzten Bolkonsky zu sein? Ganz abgesehen mal von den Architekten, die nichts toller finden als Flächenbombardements! Endlich werden wieder zentral gelegene Bauplätze für wichtige und auch großformatige Projekte frei!“
„Du hast auf meine Frage geantwortet, aber beantwortet hast du sie nicht. Zynismus ist nie eine Antwort, sondern immer nur deren Vortäuschung. Aber wahrscheinlich hast du recht damit, dass die Natur des Menschen allein für den Frieden nicht gemacht ist. Auch ich streite mich ja gern mit meinen Schwestern, sie nennen mich schon Penthesilea, was sie freilich meist zu Penti verkürzen, worüber ich mich dann ärgere.“
Wir wanderten gemeinsam durch die liebliche Probstei, tranken selbstgepressten Apfelmost unter der Eiche eines Fachwerkhofes und lauschten respektvoll den Erläuterungen des Altbauern über den Verfall der Getreidepreise. Über dem Eingang hing eine tönerne Plakette, welche das Anwesen als Erbhof nach dem Reichserbhofgesetz auswies, und an einer Stelle war etwas weggemeißelt und weggekratzt.
Dann besuchten wir das Ehrenmal für die gefallenen oder ertrunkenen Matrosen, dessen respektlose Bezeichnung durch die Pennäler ich meiner Freundin mitzuteilen zögerte. Ein Onkel von ihr hatte als Kaleu ein U-Boot befehligt, das vor Grönland von amerikanischen Torpedos versenkt worden war – nachdem es seinerseits einige tausend Bruttoregistertonnen aufgebracht und im Zusammenhang damit wahrscheinlich Hunderte von Menschen dem nassen Tod überantwortet hatte. Onkel Vinzenz, sagte sie, habe die Haut um seine Augen wie eine Blende zusammenziehen können und habe das auf ihren Wunsch gerne immer wieder virtuos runzelnd vorgeführt. Der nach oben in gewaltiger Rundung sich verjüngende Turm des Mals sollte beim Betrachter positive Empfindungen, ja, vielleicht Hoffnungen religiöser Art auslösen, hatte der Architekt nach Auskunft eines Prospektes geplant. Ich empfand das Bauwerk in seiner leeren Monumentalität als den bedrückenden Versuch, das sinnlose Sterben vieler wackerer Männer zu heroisieren. Aber ich genoss den Rundblick von oben weit hinaus bis zu den dänischen Inseln, freilich musste man die Augen nahe genug an das Stahlgitter, das den todessüchtigen Sprung in die Tiefe verhindern sollte, heranbringen, um durch seine Maschen im Sichtgenuss nicht behindert zu werden. „Das war nun also der Gedenkständer,“ sagte Alice trocken, als wir wieder auf festem Boden standen. Ich umarmte sie kopfschüttelnd und lachend.
„Und ich hatte es für zu starken Tobak gehalten, dir diesen Ausdruck mitzuteilen.“
„Wohin würdest du deine Hochzeitsreise machen, wenn du sie mit mir machtest?“
„Keine Ahnung. Muss denn sowas sein?“
„Nein.“ Alice lachte. „Die Hochzeitsreise meiner Eltern führte ganz brav in Mutters Heimatstadt Birmingham, wo sie es genoss, in Männerkleidern meinen Vater durchs Rotlichtviertel zu begleiten. Ich würde gern mit dir ganz konventionell nach Venedig fahren.“
„Warum?“
„Es soll dort einen völlig unwirklichen Reichtum gegeben haben, der so extrem war, dass er sich selbst verachtete. Das gefällt mir. Nach einer Party im Palazzo Vendramin soll der Gastgeber, um das Abwaschen zu sparen, das massiv goldene Besteck in den Canale Grande haben kippen lassen … Es hat was Grandioses, oder?“
„Ich werde nicht schlau aus dir,“ sagte ich resigniert. „Einmal schwärmst du für die Armut roter Revoluzzer, dann berauschst du dich an solchen dekadenten Scherzen …“
„Liebst du mich?“
„Ja.“
„Das genügt. Schlau werden kannst du aus anderen!“
Sechstes Kapitel
Petri ließ es sich nicht nehmen, eine weitere Pionierleistung in puncto Erinnerungskultur zu vollbringen: Er bestimmte am traditionellen Wandertag einen Ort zu dessen Ziel, der von anderen eher gemieden und mit Schweigen umgeben wurde, einen jener vielen Orte des Grauens und der Schande, mit denen die Landkarte Deutschlands gesprenkelt ist. Birken und Kiefern hatten sich versät und in ein anmutiges Wäldchen verwandelt, was einmal ein Zwangsarbeiterlager war, in dem Hunderte von Russen, Polen, Franzosen, Belgiern und Holländern noch im letzten Kriegsjahr unter Bedingungen eine Rollbahn bauen mussten, mit denen verglichen die Arbeitsbedingungen der Arbeiter, die die Pyramiden Ägyptens zusammenkarrten, paradiesisch genannt werden dürfen. Nur die Fundamente der Baracken hatten sich erhalten, erkennbar war auch eine lange Reihe von Latrinen und eine Konstruktion, die einem schmaleren Fußballtor ähnelte: ein Galgen.
Petri rang nach Worten, stammelte zunächst Unverständliches und wurde dann deutlich: „Ungenügend oder gar nicht verpflegt, ungenügend bekleidet, ärztlich unbetreut, den Schikanen und sadistischen Launen von Männern preisgegeben, die zu Hause brave Familienväter sein mochten, hier aber unter dem Gesetz ihrer unumschränkten Herrschaft eine Grausamkeit zeigten, die ihre tiefinnere Unsicherheit und moralische Verwahrlosung enthüllte, wrackten sich an diesem Ort Hunderte unter unsäglichen Qualen zu Tode, wenn sie nicht durch bewussten Ungehorsam, Angriffe auf die Wachmannschaften oder Fluchtversuche die erlösende Kugel suchten. Und zur gleichen Zeit versuchte ich mit einem Fähnlein Hitlerjungen einen Krieg noch zu wenden, den zu gewinnen eine Katastrophe gewesen wäre, und schickte Vierzehnjährige in den Tod!“ Tränen traten ihm in die Augen, Mund und Kinnpartie zuckten.
‚Und wo bleiben meine Tränen?’, fragte ich mich. ‚Millionen von Toten, nicht zu reden vom Elend der Versteckten, Geflohenen, Entwurzelten, Entrechteten, nicht zu reden vom allerfurchtbarsten Überleben der Lager als halbentseeltes Bündel aus Haut und Knochen, das in aller Augen den vernichtenden Vorwurf las: Du musst Mitschuld auf dich geladen haben, sonst hättest du nicht überlebt! – nicht eine einzige Träne presst es meinen fühllosen Augen ab, nur Entsetzen, Fassungslosigkeit, Wut – und ich muss überlegen, was ich tun kann, um mich von diesem Alpdruck zu befreien. Mehrere Möglichkeiten bieten sich an: Ich kann einfach ins Horn der Uneinsichtigen und Ewiggestrigen tuten und das alles für einen Versuch der Alliierten halten, uns Deutsche nun auch moralisch zu vernichten. Ich kann den Plan fassen, auszuwandern, könnte in einer anderen nationalen Identität unterkriechen, mein Deutschtum ablegen, verdrängen, ja, leugnen, und um das vorzubereiten, könnte ich schon hier im Lande anglo-, franko- oder russophil werden. Ich kann jegliche Mitverantwortung ablehnen, alle Schuld der Elterngeneration zuschieben und sie aufs Klarste und Eindeutigste verurteilen. Ich kann meine Zuflucht in Entschuldigungen und Rechtfertigungen suchen, indem ich z.B. Verständnis für Antisemitismus entwickle und die Hauptschuld für ihren Untergang den Juden selbst anlaste. Ich kann die Wertordnung einfach umstülpen und mir sagen: Wir Deutschen waren schon immer die Größten – in der Philosophie (Kant, Hegel, Marx), in der Musik (Bach, Mozart, Beethoven), in der Kunst (Dürer, Caspar David Friedrich) – jetzt sind wir eben auch im Bösen die Größten geworden und haben den Rest der Welt mit einer alle Masse und Maßstäbe sprengenden Gräueltat für immer weit hinter und unter uns zurückgelassen! Und ich kann mich in einen Nihilismus flüchten, dem der Massenmord nur ein weiteres Indiz für die Bestialität des Menschen und die vollständige Sinnlosigkeit und Amoralität der menschlichen Existenz ist und etwa die These vertreten, der Massenmord an Juden, Zigeunern und Slawen müsse durch die Ermordung der gesamten Menschheit getoppt und zu Ende geführt werden – Endlösung der Menschenfrage und Erlösung des Planeten von einer Pestilenz, die ihn zu ersticken droht!
Die letzte Möglichkeit gefiel mir zeitweise am besten. Sie stritt nichts ab, sondern trat gleichsam die Flucht nach vorn an, musste nicht aufgeschoben werden wie die Auswanderung und reflektierte die sich mehrenden Äußerungen und Befürchtungen, die Übervölkerung der Erde betreffend. Zugleich entsprach sie in ihrer tiefschwarzen Glorifikation der Selbstvernichtung meiner Stimmungslage; ich errichtete in meiner Phantasie eine Gaskammer für Milliarden und ein Krematorium gleicher Kapazität, hockte wie ein Geier auf meinem rauchenden Werk, und, wenn die letzte Füllung verbrannt war, schoss ich mir eine Kugel durch den Kopf. Die Gräuel der Nazis schmolzen in dieser Vorstellungswelt auf dilettantisches Vorläufertum zusammen, das den Gedanken der Erlösung des Planeten von seinem bedrohlichsten Schädling noch nicht zu denken gewagt hatte.
„Ich betrete ein Hotel,“ schrieb ich in das blaue Heft, „man wird vorne prachtvoll und höflich empfangen, aber die Zimmer sind kläglich, ja, es gibt keine Zimmer, nur einen langen Saal, in dem Holzpritschen aufgeschlagen sind, in die die Gäste zu zweit, ja, zu dritt hineingepfercht werden. Ich muss mich damit anfreunden, in mittlerer Höhe untergebracht zu sein, neben einem Mann, der nur aus Haut und Knochen besteht. Aber als ich zu ihm unter die Decke krieche, ist er ganz glatt und rund und fasst sich wollüstig an, meine Hand gleitet über seinen Rücken und seine Glutäen. Aber er ist eiskalt, und ein Grauen beschleicht mich. Ich sehe in das Bett unter mir hinab – und dort liegen zwei schneeweiße Frauengestalten, die Augen leer und ohne Augenstern, die Münder sinnlich geschwollen, und pressen ihre gipsenen Brüste aneinander… ‚Bitte herhören! Bitte herhören!’ tönt es mit dröhnender Stimme aus einem Lautsprecher, ‚suchen Sie sich die Lage aus, in der Sie verbleiben möchten! Die Umwandlung beginnt in wenigen Minuten.’ Ich liege auf dem Rücken und betrachte meine Hände. Zu meinem unsäglichen Grauen verwandeln sie sich von den Fingerspitzen her in schneeweißen Gips! Ich versuche zu schreien, aber mein Mund bleibt stumm, es schreit in mir, aber kein Laut dringt aus mir heraus…“
Ich überlegte, wie es zu diesem Traum hatte kommen können. Wir hatten Platons „Phaidon“ gelesen und darin die Stelle: „Er aber ging umher, und als er merkte, dass ihm die Schenkel schwer wurden, legte er sich gerade hin auf den Rücken: denn so hatte es ihn der Mensch geheißen. Darauf berührte ihn eben dieser, der ihm das Gift gegeben hatte, von Zeit zu Zeit und untersuchte seine Füße und Schenkel. Dann drückte er ihm den Fuß stark und fragte, ob er es fühle; er sagte: ‚Nein.’ Und darauf die Knie, und so ging er immer höher hinauf und zeigte uns, wie er erkaltete und erstarrte. Darauf berührte er ihn noch einmal und sagte, wenn ihm das bis ans Herz käme, dann würde er hin sein.“
Aber ich hatte auf dem Dachboden auch Hefte gefunden, in denen Gips- und Marmorplastiken abgebildet waren, sie hießen „Der Rächer“, „Berufung“, „Flora“, „Hoffnung“, „Vergeltung“, „Bereitschaft“ oder „Aurora“. Das war die Kunst der glorreichen zwölf Jahre gewesen: Ein leichenhafter, strotzend-moribunder Akademismuskitsch.
Siebentes Kapitel
Das Lornsen-Gymnasium bestand aus dem Haupt- und dem Nebengebäude sowie der Turnhalle. Während sich im Hauptgebäude die Klassenräume, das Lehrerzimmer, der Zeichensaal und die Aula befanden, waren die naturwissenschaftlichen Räume in einem später errichteten Nebengebäude untergebracht. Physik-, Chemie- und Biologiesaal verfügten über stark ansteigende Sitzreihen vergleichbar den Anatomietheatern, die es an alten medizinischen Fakultäten noch gibt. Den Chemiesaal schmückte die periodische Tafel der Elemente, unter denen ich mich, warum auch immer, von den seltenen Erden immer am meisten angezogen fühlte. Im Physikraum gab es einen großen Glasschrank mit stabilen Versuchsanordnungen z.B. für das Messen von Beschleunigungen oder die Erzeugung von Vacuen. Zierde des Biologiesaals aber war das Skelett eines zierlichen Menschen, unerkennbar ob Mann oder Frau, vom Schülerhumor aber schon vor Jahrzehnten als Skelett des geheimnisvoll verschollenen Schulpatrons Uwe Jens Lornsen gedeutet, der dem historischen Vernehmen nach jedoch ein hochgewachsener Friese war, während es sich bei dem zierlichen Knochengerüst wahrscheinlich um das eines unidentifizierten Toten, also unbekannten Soldaten aus dem Koreakrieg handelte. Im Hauptgebäude gab es einen Kartenraum, wo die Geografielehrer sich für ihre Stunden ausrüsteten – unter tunlichster Vermeidung des noch reichlich vorhandenen kartografischen Materials aus den glorreichen zwölf Jahren, die Deutschland zu einer perversen, es verzehrenden kurzfristigen allerhöchsten Machtentfaltung verholfen hatten. Ältere biologische Präparate in Formalin wie z.B. ein Fötus mit zwei Köpfen waren unter das Walmdach verbannt und bildeten dort eine Art von Gruselkabinett, das nur die wenigsten beim Transport von Gerümpel einmal kennengelernt hatten.
Ich sollte mich in der Biologiearbeit zur Osmose äußern, zur Zellteilung und zur Entwicklung bestimmter Einzeller. Mein hilfesuchender Blick zu Alice hinüber wurde bemerkt; sie schrieb mir ein Briefchen voll nützlicher Tipps und Hinweise, die sie mit Herzen und Kusskreuzchen ummalt hatte. Zum ersten Mal in meinem Leben musste ich mir eingestehen, dass ich wohl eine Eroberung gemacht hatte und dass Alice bis über die Ohren in mich verliebt war – ohne dass mir klar war, was sie an mir eigentlich liebenswert fand; ich fand mich bis auf die Knochen banal und hoffte nur, dass Alice meine Banalität nicht so bald erkannte. Während ich noch darüber und über die Tatsache nachgrübelte, dass ja auch der maskuline homo sapiens beim Liebesakt Tausende der Einzeller produziert, bei deren Anblick unterm Mikroskop mir schlecht geworden war, ertönte aus dem Chemiesaal plötzlich ein lauter Knall, dem tiefe Stille folgte. Dann erhob sich ein schrilles und blökendes Durcheinandergekreisch und –gebrüll vieler Stimmen, die Tür des Chemiesaals flog krachend auf und Rauch drang über den Flur schnell auch in den Biologiesaal ein.
„Schließt eure Hefte und verlasst den Raum, zügig, aber ohne Gedrängel, die Mädchen zuerst!“, befahl der Biologielehrer, derselbe, der einst den Weinschwärmer hatte fliegen lassen. Aus der offenstehenden Tür des Chemiesaals drang gelblichdichter Qualm, offenbar hatten ihn alle Schüler schon verlassen, und von draußen wurde das Heulen der Sirene hörbar. Da war mir, als ich die Tür passieren wollte, als hörte ich von drinnen ein Keuchen und kotzendes Husten. Ich hielt die Luft an, durchdrang die gelbe Rauchwand, fand drinnen in der ersten Reihe einen röchelnden Körper am Boden, zog ihn zwischen den Bänken hervor, hob ihn auf die hantelgestärkten Arme und trug ihn, nun selbst verzweifelt keuchend, hinaus. Draußen verlor ich das Bewusstsein und wurde samt meiner Beute von Rettungskräften aufgefangen.
Im Spital erfuhr ich, dass ich Helche Fohrmann aus dem Rauch geholt hatte. Als ich mich etwas erholt hatte, erwog ich, sie zu besuchen – sie lag nur ein paar Zimmer weiter. Aber ich verwarf diesen Plan, weil ich mich von ihr verraten fühlte. Als ich das Spital verließ, stand sie rauchend in der Eingangsschleuse. Blass und mitgenommen, wie sie noch war, sah sie wunderschön aus, sie trug einen graublauen Frotteemantel und hielt die Arme fröstelnd unterm Busen verschränkt, aber ich riss meine Augen von ihr los und eilte zu dem Taxi, das meine Eltern bestellt hatten. Am Abend rief sie mich an und sagte nach langem Zögern, sie wolle mir danken.
„Da nicht für,“ erwiderte ich landesüblich. Sie dankte mir auch für die „vielen schönen Gedichte“, die ich ihr geschrieben hätte.
„Und warum hast du sie neulich Nacht meinem Vater gezeigt?“
„Das habe ich nicht getan.“
„Ich habe doch eines im Papierkorb gefunden.“
„Es war stark zusammengefaltet, oder? Warum wohl? Denk doch mal nach!“ Sie begann zu weinen. „Ich habe es wie einen Talisman in meinem BH getragen. Aus dem ist es herausgefallen, als …“ Sie konnte nicht weitersprechen und legte auf.
Ich besuchte sie im Spital. Ihr Zimmer hieß Innsbruck, das war mein Geburtsort. Ich war auf die Welt gekommen, als es noch gar nicht an der Zeit war, meine Mutter war auf Reisen gewesen, und nun lag Helche, die ich gerettet hatte, im Zimmer Innsbruck. Obgleich ich nicht abergläubisch war, wunderte ich mich über diesen Zufall. Der andere war der, dass sie genau das eine Jahr älter war, um das auch meine stillborn Schwester älter gewesen wäre, wenn sie überlebt hätte. Ja, es war eine Geschwisterlichkeit zwischen uns, die dadurch, dass sie keine wirkliche war, nur noch gesteigert wurde. Ich saß an ihrem Bett, sie bat mich, ihre Hand zu ergreifen, und da lag sie nun in meiner, diese lange Hand mit den Grübchen über den Fingergrundgelenken, die mich einmal so entzückt hatten. „Und weißt du auch noch, warum ich die Hand gestreckt habe? Ich wollte meiner Freundin den neuen Ring mit dem Karneol zeigen, den ich von meinem Vater bekommen hatte.“
„Was – ach ja – nein! War da ein Ring?“
Helche lächelte gerührt. Die Grübchen über ihren Fingergrundgelenken hatten den Ring in den Schatten gestellt. Mir fiel jetzt wieder ein, wie betreten wir auseinander gegangen waren, nachdem es bei den Artisten auf dem Hochseil fast zu einem Unfall gekommen war. Aber in mir hatte Helches Hand geherrscht und sonst nichts. Ich erzählte ihr, wie ich damals davon geträumt hatte, ihre Hand einmal zu küssen. „Tu es doch!“, murmelte sie tonlos, „küss dich satt daran!“ Die Hand roch süßlich nach glycerinhaltiger Hautcrème, aber das störte mich nicht. Und es störte mich nicht, dass neben den Fingernägeln blutige Stellen waren von abgerissenen Niednägeln. Ich war krank vor Zärtlichkeit für diese geknickte und beschädigte Lilie, die ich einem vorzeitigen Tod entrissen hatte. „Warum hast du das getan?“, wollte sie wissen. Ich überlegte, ob ich ihr die Wahrheit zumuten sollte. Ich fasste mir ein Herz.
„Ich habe dich nicht erkannt,“ sagte ich. Sie entzog mir die Hand und wandte sich ab. „Damit wirst du leben müssen,“ sagte ich und stand auf. „Ich habe dir Dutzende von sonnets geschickt, und du hast nicht einmal reagiert. Willst du mir etwa vorwerfen, ich hätte dich leichtfertig für hochnäsig gehalten?“
„Ich habe keins von ihnen vergessen.“
„Ich will doch nichts, als dass du mein gedenkst …“ zitierte ich mich selbst, um sie zu testen. Ich hatte die sonnets zwar verbrannt, aber keines von ihnen vergessen.
„Gelegentlich, wenn du nach innen schaust, /Die Schritte deiner Seele zu mir lenkst, /Und dich an meiner Lieb’ und Treu’ erbaust …“ Es zeigte sich, dass sie das gesamte sonnet auswendig konnte. Ich war so gerührt, dass ich ihr den Mund mit einem Kuss schloss. Trotzdem gelang es ihr fortzufahren:
„Ich will doch nichts, als dass dein durst’ger Sinn /Am Wohllaut meines Verses sich erquickt /Und dass sich an den Worten, die ich bin, /Dein ausgehungertes Gefühl entzückt.“
Eine Krankenschwester kam herein, weshalb wir unseren Kuss als flüchtiges Abschiedsküsschen tarnten, ich ging hinaus, kaum meiner Sinne mächtig, sprang in die Luft, als ich unter den abblätternden Kastanien einherging, rollte auf einer der lackbraunen Früchte aus, saß lachend mit schmerzenden Handgelenken am Boden, sog den Duft des welken Laubes ein und hatte das Gefühl, endlich nach Hause gekommen zu sein.
*
„Woher wusstest du, dass mein Gefühl ausgehungert war?“, fragte Helche mich am Abend telefonisch. „Ich fand das, offen gestanden, ein bisschen selbstherrlich. Hätte ich nicht durchaus einen Freund haben können?“
„Harald?“, krächzte ich mit belegter Stimme ins Telefon.
„Was für ein Harald? Ach, Harald Hirsebeck, dieser Lackaffe … Meinst du, so einer gefällt mir? Er ist ein halbes Jahr hinter mir hergedackelt und hat mich mit seinen Schmalzaugen angeschmachtet, dann hab ich ihm gesagt, ich sei schon versichert – da hat er’s aufgegeben.“
„Er hat immerhin zu denen gehört, die Dr. Kruse eine Lektion erteilt haben.“
„Fandest du das etwa gut? Wenn wir Türen auf alle Dummköpfe werfen wollten, hätten wir viel zu tun. Aber ganz etwas anderes. Ich werde morgen entlassen. Wo sehen wir uns dann?“
„Bei mir. Oder bei dir.“
„Du bist vielleicht naiv! Bei mir geht nicht. Mein Vater will nicht, dass ich Besuch empfange, und schon gar nicht den Sohn eines Mannes, der ihn angeklagt und als Verbrecher gegen die Menschlichkeit gebrandmarkt hat. Und bei dir … Ich hoffe, du verstehst, dass ich nach dem Zwischenfall mit deinem Vater euer Haus nicht wieder betreten möchte.“
Ich gab Helche innerlich recht: Ich war naiv. Was war in jener Nacht passiert? Dass Helche zu Emil gekommen war, um für ihren Vater zu bitten, war sonnenklar. Dass Emil diese Situation ausgenutzt hatte, um, ein anderer Scarpia, Gunstbeweise von ihr zu erpressen, war ebenfalls klar. Wie weit war sie, wie weit war er gegangen? „Es ist gut, es ist gut!“, hatte Helche mehrmals mehr gezischt als gesagt, das klang nach „Genug, mehr gibt’s nicht!“ Ich kam mir kleinlich vor, als ich merkte, wie genau ich es gern gewusst hätte. Immerhin hatte sie das zusammengefaltete sonnet von mir aus dem BH verloren. Beschämt gestand ich mir ein, dass ich so viel, wie sie für ihren Vater zu riskieren bereit gewesen war, weder für Emil noch für Vilma riskiert hätte. Aber dann wurde mir klar, der Vergleich war schief; ein Mann, der bitten ging, lief sehr viel weniger Gefahr, Objekt der Begierde zu werden als eine Frau, und kam wohl auch kaum in Versuchung, sich selbst als solches anzubieten.
Wir verabredeten uns im Café Siedler an der Schlossstraße, feierten im ersten Stock ihre Gesundung und besiegelten unsere Freundschaft mit einem gemeinsamen Stück Trümmertorte. Wir taten unbefangen, aber ich merkte an Helches gespannter Aufmerksamkeit, dass sie nur ungern bekannte Gesichter gesehen hätte. Beim Annehmen des Tortentellers bewegte sie sich so fahrig, dass sie die Tischkerze umstieß und aufschrie. „Ein Bunsenbrenner fiel um, es gab eine Verpuffung und der ganze Chemietisch stand in Flammen.“ Die Erinnerung ließ sie erzittern. „Weißt du übrigens, dass sie wegen Brandstiftung ermitteln?“ Ich wusste es nicht. „Und weißt du auch, wen sie verdächtigen? Man kann es sich an fünf Fingern abzählen.“ Sie machte es vor, und es sah makaber aus mit ihren abgerissenen Niednägeln. „Die sechs Relegierten natürlich, unter ihnen als Drahtzieher Harald Hirsebeck. Sie sollen den Tisch präpariert haben.“ Ich versuchte, ihr zuzuhören. Aber ihr Fuß lag zwischen meinen Beinen und machte sich dort zu schaffen. Ihre Frivolität am öffentlichen Ort betörte mich, und es war mir herzlich egal, ob der Tisch des Chemiesaals präpariert gewesen war oder nicht.
Achtes Kapitel
„Was ist mit dir? Nie mehr hast du Zeit für mich!“, sagte Alice traurig, als ich sie einmal zur Straßenbahn brachte. „Erzähl mir nichts von Cicero und Stochastik! Du bist mir vielleicht eine treulose Tomate! Du hast dich in Helche Lohmann verliebt, als du sie aus dem Rauch trugst. Ich kann das verstehen, stell dir vor, ich kann es verstehen! Aber nimm dich in Acht! Ich glaube nicht, dass sie es ehrlich mit dir meint!“ Tränen quollen aus Alices glasigen Kulleraugen, stolz und zornig wandte sie sich ab. Wir standen noch eine Weile stumm da und wussten nichts mehr zu sagen. Dann kam die Bahn. Freilich konnten wir einander nicht aus dem Weg gehen, da wir derselben Klasse angehörten. Betrübt, aber hilflos beobachtete ich, dass Alice wieder wurde wie früher – scheu, gehemmt und mit blutig gekratzten Waden.
‚Was kann ich dafür, dass ich Helche liebe?’, rechtfertigte ich mich vor mir selbst, als ich eines Nachmittags im Liliencronpark vor den Tennisplätzen stand und nur wenig interessiert einen Ballwechsel zwischen Petri, der einen verschlissenen Trainingsanzug trug, und einem jungen Schnösel in blitzweißem Tennisdress verfolgte. ‚Ist meine Liebe für Helche nicht älter als die für Alice? War sie nicht nur – auf Grund eines Missverständnisses – einige Monate, ja, fast ein Jahr auf Eis gelegt? Und ich habe wirklich nicht gewusst, wen ich rettete, als ich in den Chemiesaal eindrang! Wer weiß, ob ich’s getan hätte, hätte ich Helches Stimme erkannt! Aber wenn sie dann jetzt tot wäre – ich würde meines Lebens nicht mehr froh. Selbst wenn ihr Vater ein Verbrecher ist und sie sich, um ihm zu helfen, Emil gegenüber allzu freizügig verhalten hat – sie wäre keine Verbrecherin, sondern nur eine opfermütige Tochter! Was können wir für das Grauen, das unsere Väter und Mütter angerichtet, geduldet, mitgetragen, verteidigt und nach allen Richtungen in Europa und über Europa hinaus ausgebreitet haben? Und was weiß ich über Alices Herkunft? Die Ohlsens haben viel Geld, weil der Vater Chemiker ist. Wagt man denn überhaupt nachzufragen, was er womöglich in den glorreichen zwölf Jahren produziert hat?’ Erfreut sah ich, dass Petri dabei war, dem jungen Schnösel, der ihn völlig unterschätzt hatte, eine Tennislektion zu erteilen.
‚Bin ich denn als Mann,’ überlegte ich weiter, ein Stück Bitterschokolade lutschend, ‚zur Untreue überhaupt fähig? Treulos wäre es, sich gleichzeitig zwei Mädchen zuzuwenden und das eine mit dem anderen zu betrügen. Aber ich betrüge Alice nicht mit Helche, sondern wende mich dieser mit allen Sinnen und Fasern zu und von Alice ab – so wie ich mich damals von Helche ab- und Alice zuwandte. Die Natur hat es so eingerichtet, dass Mann und Frau sich jeweils nur mit einem Partner zur Zeit vereinigen – also hat sie im Grunde der Untreue von vornherein das Fundament entzogen. Den Augenblick des Genusses teile ich mit keiner anderen als mit der sich mir hingebenden Frau. Im Moment meiner höchsten Zuwendung bin ich immer nur einer zugewandt.’ Fröhlicher Zynismus erfüllte mich, als ich diese rabulistischen Betrachtungen anstellte.
Hingabe – was für ein merkwürdiges Wort, wenn es um die Liebe von Mann und Frau ging! Ich hatte es mehrfach aus dem Munde meiner Mutter vernommen, wenn sie, was selten vorkam, sich ein Herz fasste, um mir Einblicke ins Erwachsenenleben zu geben. „Wenn eine Frau sich einem Mann hingibt, dann denken beide in diesem Moment an nichts weniger als an Kinder,“ hatte sie einmal gesagt. Warum konnte nicht auch ein Mann sich einer Frau hingeben? Hatte er nicht sogar eher noch mehr zu geben als sie? Ich dachte an Helches kecken Fuß und wie gut mir der gefallen hatte. Mein Höchstes war es nicht, eine Frau zu erobern, sondern von ihr umgarnt zu werden. Schon wieder so ein merkwürdiges Wort! Kaum überließ man der Frau ein wenig die Initiative, schon verfiel das Deutsche in die Terminologie der Handarbeitsstunde – oder der Vogelstellerei.
Und über noch etwas musste ich nachdenken. Hatte Alice sich geirrt, als sie von Helche Lohmann sprach? Sicherlich war es ein Irrtum. Helche ging in eine der höheren Klassen, zu denen bestand so gut wie kein Kontakt. Vom Verfahren gegen einen Lohmann hatte der Volksfreund mehrfach, wenn auch nur knapp und widerwillig berichtet. Hatte er seinen Namen geändert, um sich der Verfolgung zu entziehen? Aber welcher Lohmann würde zur Tarnung einen so ähnlich klingenden Namen wie Fohrmann benutzen? Gerade das aber machte ihn als Decknamen vielleicht besonders unverdächtig und dadurch geeignet … Nannte die Presse seinen wirklichen Namen, während an seiner Haustür noch der angenommene stand?
Ich beschloss, Helche beim nächsten Treffen danach zu fragen. Ich begann jetzt, abendliche Radtouren zu unternehmen. Sie führten mich an die Förde und dann in den Liliencronpark, wo die Kanada-Gänse laut schwurbelnd beiseite watschelten, wenn ich sie dabei störte, an den Bänken nach Essensresten zu suchen. Auf einer dieser Bänke – sie war vom Vorschussverein gestiftet – pflegte ich zu warten, bis eine junge Dame vorbeikam, die, wenn die Luft rein war, höflich und distanziert neben mir Platz nahm. Wir redeten miteinander, wie wir es in Filmen von Agenten gesehen hatten – mit parallel geradeaus gerichteten Blicken – gerade als ob wir uns für den Campanile des Rathauses mehr interessierten als füreinander. Als es immer früher dunkel wurde, wurde es zwar auch immer kälter, aber ich brachte eine Wolldecke in der Satteltasche mit, wir saßen im Dunkeln und streichelten einander mit fröstelnden Fingern. „So geht das nicht“, sagte Helche eines Abends. „Fällt dir nichts Besseres ein?“
Ich war ganz in meine klamme Erregung verloren gewesen und empfand Helches Frage als kalte Dusche. Sie konnte so grausam vernünftig sein. „Heißt du eigentlich Fohrmann oder Lohmann?“, fragte ich sie, um diesen Merkposten endlich abzuhaken.
„Nun fang du nicht auch noch damit an! Solange sie meinem Vater nicht rechtskräftig nachgewiesen haben, dass er dieser Max Lohmann ist, der in Frankreich gewütet haben soll, heißt er weiter Fohrmann, und damit auch ich, ja? Außerdem geht das nur unsere Väter was an.“
„Neulich Nacht warst du anderer Meinung.“
„Da glaubte ich etwas tun zu können und zu müssen. Aber das war ein Fehler. Bitte finde heraus, wo wir ungestört zusammen sein können! Ich sehne mich sehr danach!“ Mit kalten Lippen und Händen nahmen wir voneinander Abschied.
*
Auf dem Schulhof würdigten wir einander keines Blickes. Ich gestand Henning, ich wolle mich mit einer Freundin treffen und wisse nicht wo. Der Junker lachte und sagte: „Ihr könnt euch gerne bei uns im Gutshaus treffen! Meine Mutter wird zwar den Kuppeleiparagraphen ins Feld führen, wenn ich ihr davon erzähle – und das muss ich schon aus Gründen der Sohnesloyalität tun – aber es gibt so viele unsinnige Vorschriften im Strafgesetzbuch, die sie mit mir verachtet, dass sie sich auch über diese, wenn auch unter Bedenken, hinwegsetzen wird. Wer ist denn die Glückliche?“ Als ich zu Boden sah, fuhr Henning lächelnd fort: „Ach, so natürlich … Wozu rettet man ein Mädchen aus dem Feuer? Ich hoffe, du verbrennst dir an ihrem Dank nicht die Finger!“
Die Weimaranerwelpen waren zu einer Meute athletischer Jagdhunde herangewachsen, die Helche gierig beschnoberten, als Malte sie der Hausherrin und ihrem Sohn präsentierte. „Willkommen auf Testorff,“ sagte die verhutzelte kleine Baronin. „Ich habe euch zwei Betten im Giebelzimmer gemacht und habe sie auseinandergeschoben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dieser Lösung einverstanden wärt.“ Wir versicherten ihr, dass wir das seien, und nahmen an der Tafel im Rittersaal Platz. An der Wand war das Fresko eines Falkners zu sehen, über ihm flatterte ein Fähnchen mit der Inschrift VELLE AT NON POSSE DOLENDUM EST.
Ein scheues Bauernmädchen mit roten Apfelbacken trug Röstkartoffeln und Sülze auf, dazu gab es Rauenthaler Wülfen. Die Höflichkeit gebot es, der Baronin zuzuhören, als sie in den reichen Fundus ihrer Familiengeschichte griff und berichtete, wie ein Vorfahr, als er Louis Seize bei seiner Flucht vor den Jakobinern helfen sollte, die Pferde falsch angeschirrt habe, wodurch viel Zeit verloren ging. „Letztlich hat mein Ururururgroßvater also den Tod dieses Monarchen zu verantworten. Denn ohne seinen Fehler wäre die Flucht geglückt und Louis Seize wäre nicht bereits in Varennes wieder eingefangen worden! Aber ich kann damit leben, denn Louis Seize war ein fast so unfähiger Monarch wie Wilhelm II. Hätten die Deutschen diesen Dummkopf, als er Bismarck entließ, wegen Hochverrats aufs Schafott gebracht, uns wären zwei Weltkriege und die Hitlerei erspart geblieben.“ Das sagte sie im Ton so abgrundtiefer Verachtung, dass ich es einfach so stehen lassen musste. Außerdem spielte Helche unter dem Tisch anzüglich mit meinen Fingern. Mir wurde abwechselnd heiß und kalt.
Lag es am steifkühlen Leinen, mit dem die Betten bezogen waren? Ich hielt die wunderschöne, gertenschlanke und voll zur Frau erblühte Helche im Arm und fühlte mich so verzagt! ‚Wie soll ich dieser Frau je gerecht werden?’, fragte ich mich. ‚Sie könnte doch ganz andere Liebhaber haben als den blutarmen, plattfüßigen Malte … Es ist unmöglich, dass sie mich wirklich liebt. Alice hat mich gewarnt – aber welches Ziel könnte sie verfolgen mit gespielter Zuneigung? Gegen ihren Vater wird nicht mehr von Emil ermittelt, und selbst wenn mein Verhältnis zu ihm besser wäre, ich könnte nichts mehr für sie – und für ihn – tun. Nein, sie liebt mich aus Dankbarkeit – aber ist Dankbarkeit ein Fundament für Liebe? Lässt sich Dankbarkeit im Bett begleichen? Möchte sie mir gegenüber keine Verpflichtung mehr spüren?’ Und noch etwas beunruhigte mich. Hatte nicht mein Vater doch mit ihr „Liebe gemacht“? War es nicht – unästhetisch, eine Frau zu lieben, die auch der eigene Vater schon – geküsst, ja, vielleicht – begattet hatte? Es war ähnlich unzulässig und peinsam, wie es das leibliche Lieben der eigenen Mutter gewesen wäre … Ich war so verlegen, dass ich ein Gespräch anzuknüpfen versuchte. „Was ich an großen Hunden hasse“, sagte ich, „ist, dass sie den Menschen immer zwischen die Beine gehen.“ Helche lachte.
„Was stört dich daran?“, fragte sie. „Es sind Tiere, dazu noch Nasentiere, und auch wir Menschen haben dort nun einmal den stärksten Eigengeruch.“
„Ich fand es peinlich, wie Wotan dir die Nase förmlich in den Schoß bohrte.“
„Ich wünschte, du tätest es auch!“
Diese Worte brachten meinen Hochmut zum Einsturz, und ich fand mich nicht nur damit ab, nicht besser als ein Tier zu sein, sondern lernte auch, es zu genießen. „Wie schützen wir uns?“, fragte Helche, und es zeigte sich, dass ihre Frage eine rhetorische gewesen war, denn sie hatte das Schutzmittel dabei, applizierte es zu meiner geschmeichelten Überraschung eigenhändig mit den wunden und doch so geschickten schlanken Fingern und warf mir dabei schelmische Blicke zu.
„Das wichtigste erotische Organ ist der Kopf“, philosophierte Helche, als wir zur Ruhe gekommen waren. „Du hast mir erzählt, dass du dich immer nach der älteren Schwester gesehnt hast, die dir das Schicksal vorenthielt. Nun überträgst du diese ungenutzten Gefühle auf mich. Da es aber das Inzestverbot gibt, hast du zunächst Angst gehabt, mich sexuell zu lieben, dann aber hast du diese Angst überwunden, und das mitschwingende Inzestverbot hat dich nur noch begehrlicher gemacht und deine Lust, wenn ich es recht beobachtet habe, nicht unerheblich gesteigert …“
„Wie klug du über die Liebe reden kannst. Wer hat dir das alles beigebracht?“
„Mein erster Liebhaber.“
Ich schwieg. Es genügte mir zu wissen, dass das Harald nicht gewesen war. Aber Helche war in Plauderstimmung. „Siehst du dort das Bild an der Wand?“ Ich schaute ins Halbdunkel, richtete das Licht der Nachttischlampe darauf. „Was zeigt es? Es zeigt einen alten Mann, der an der Brust einer jungen Frau trinkt. Ein sehr schönes Motiv, nicht wahr? Wir haben nach dem Krieg in Paraguay gelebt. Dort ist meine Mutter gestorben, und mein Vater ist nach Deutschland zurückgekehrt im Glauben, hier könne er wieder leben und eine neue Frau finden. Wir wären besser in Lateinamerika geblieben … Es war so herrlich dort! Ich war dreizehn, und mein Vater hatte einen alten italienischen Freund, Don Nicanor Paredes, der wunderschön Gitarre spielte und sang … Er war faltig und grauhaarig wie der Mann dort auf dem Bild! Trotzdem verliebte ich mich in ihn und er sich in mich, und eines Nachts, mein Vater war schon schlafen gegangen, Don Nicanor saß noch im Patio und entlockte seinem Instrument unirdische Töne, setzte hin und wieder ab, um mit seiner Bombilla Mate aus dem Kürbis zu saugen, und sang ein Tangolied … Da setzte ich mich, halbes Kind, das ich noch war, auf seine Knie und bat ihn, das Geschenk meiner Jungfräulichkeit von mir anzunehmen. Wir waren dann oft zusammen, und ich habe die Lebens- und Liebeserfahrung eines sehr viel älteren Mannes – er hätte mein Vater sein können – unersättlich in mich aufgesogen! Deshalb macht es mir auch nichts aus, dass du noch recht liebesunkundig bist und nicht die Geduld und Kenntnis aufbringst, um mich glücklich zu machen. Ich spüre, dass du mich begehrst, und werde dich zu einem guten Liebhaber ausbilden!“
Das war keine sehr tröstliche Perspektive; es wehte mich etwas Fremdes und allzu Weltläufiges aus Helches Worten an. ‚Wahrscheinlich’, dachte ich, ‚hält sie mich in Wirklichkeit für ein beschränktes Landei und wird mich so schnell wie möglich gegen einen erfahreneren Freund austauschen. Oder sie verfolgt irgendwelche verschwiegenen Ziele. Hätte ich ihr nicht andere Gedichte geschrieben als diese anglisierenden sonnets, wenn ich mehr von ihrer Vergangenheit gewusst hätte? Hätten ihr spanische Formen wie Habanera oder Seguidilla, hätten Verse im manieristischen Stil Gongoras ihr nicht mehr zugesagt? Und dieser grauhaarige Don Nicanor Paredes ist mir unheimlich. Oder hätte es auch mir gutgetan, mich einmal in eine ältere, liebeserfahrene Frau zu verlieben? Dann wäre ich jetzt nicht der Anfänger, der sich ausbilden lassen muss!’
Helche bemerkte mein missvergnügt-nachdenkliches Gesicht, begann zu weinen und schluchzte: „Wenn du mich nicht liebst, liebt mich hier keiner! Es war ein Fehler, dass ich so offen war, ihr Männer wollt immer die ersten und die besten sein! Wenn mein Vater auch in zweiter Instanz verurteilt wird, verliert er bestimmt seine Zulassung als Anwalt – und wohin sollen wir dann gehen? Schon jetzt haben wir manchmal nicht genug Geld, mir die Schulbücher zu kaufen …“ Ich konnte ihrem Tränenfluss nicht widerstehen und tröstete sie mit der gewachsenen Ausdauer des Erschöpften so zärtlich und nachdrücklich, dass ihr Schluchzen sich in dankbares Seufzen verwandelte.
Henning hatte zum Frühstück Isoldes Liebestod aufgelegt, raunzend dargeboten vom geschmeidigen Sopran einer Schwedin, und sagte hintersinnig: „Es war mir ein Vergnügen, eure Brangäne zu sein!“ Ich erwähnte, dass meine Mutter für Wagner schwärme, mein Vater hingegen für Verdi, weshalb sie die Oper selten gemeinsam aufsuchten. Einig seien sie sich nur in ihrer gemeinsamen Wertschätzung für Richard Strauss.
„Großartige Einfälle. Aber ein politischer Ignorant. Alles ist beschmutzt“. Henning pellte sein Ei sorgsam aus der Schale; sein Mund bewegte sich, aber er ersparte sich weitere Erläuterungen. Seine Mutter köpfte ihr Ei mit einem wohlgezielten Messerhieb. Helche blieb vor Verwunderung der Mund offen stehen.
„Sie entstammen wirklich einer Familie von Haudegen!“, sagte sie. „Wie ich hörte, war Ihr Bruder in der Wolfsschanze, als dieses heimtückische Attentat …“
„Dieses Attentat war großartig und notwendig“, schnitt die Baronin ihr das Wort ab. „Mein Bruder will es bis heute nicht wahrhaben, weil er mit der Tatsache, dass er die zwölf besten Jahres seines Lebens an einen besessenen Lumpen verschwendet hat, nicht leben will und kann. Wir waren doch alle völlig verblendet, unser Verstand war außer Kraft gesetzt, und den Rest an Menschlichkeit erledigten Angst und das trotzige Gefühl, es könne nicht sein, dass Deutschland im Namen Deutschlands ruiniert würde.“
„Ruiniert haben es die Alliierten“, erwiderte Helche mit einem eisigen Lächeln. „Aber wir sollten es machen wie Audrey Hepburn, die auf die Frage, wie sie es anstelle, dass Leute aller Art sich darum rissen, bei ihr zu Gast zu sein, geantwortet haben soll: ‚Indem ich ein Gesprächsthema ausschließe: Politik.’ Auch wir sollten sie von diesem so gemütlichen Frühstückstisch verbannen.“ Die anmutige Amerikanerin holländischer Herkunft erwies sich jedoch als matte Schutzheilige; ein sehr ungemütliches Schweigen machte sich breit, und ich war froh, als Helche und ich uns unter zahlreichen Dankesworten verabschiedet hatten, auf den Rädern saßen und heimwärts fuhren.
Neuntes Kapitel
Ein einsames Jahr stand mir bevor. Helche hatte Abitur gemacht und schrieb sich an einer süddeutschen Universität ein, um Journalistik zu studieren. Ich hatte nie wieder ein Gedicht für sie geschrieben; war aber so heftig in sie verliebt und an ihren zärtlichen Umgang gewöhnt, der in der Leidenschaft kein Gesetz als das der höchsten Lust anerkannte, dass ich mich fragte, wie ich das Alleinsein, mehr aber noch die Vorstellung ertragen sollte, was Helche mit ihrer Freiheit in Würzburg anfing. Zwar hielt ich sie nicht für treulos, aber doch auch für viel zu liebeserfahren, als dass sie leichthin „etwas anbrennen ließ“ – eine Redensart, die sie in diesem Zusammenhang benutzt hatte. Alice hatte die Schule verlassen und war in ein Internat am Bodensee eingetreten, wo es ihr dem Vernehmen nach gut ging, was mich sehr erleichterte – ich machte mir Vorwürfe, dieses so schutzlos ehrliche Mädchen verlassen zu haben. Es blieb mir nun gar nichts anderes übrig, als mich für Tacitus zu interessieren, mich für die Feinheiten der Stochastik zu begeistern und Sartre zu lesen, dessen gauloise-geschwängerter Existenzialismus sich an der Schule verbreitete als eine willkommene, unbesudelte Alternative zu dem, was die braun verschmutzte ältere Generation der Lehrer anzubieten hatte.
Nach langem Nachdenken hatte sich die Oberstaatsanwaltschaft dazu durchgerungen, die Ermittlungen gegen Fohrmann einzustellen; die Verantwortung an den begangenen Verbrechen treffe seinen Vorgesetzten, der jedoch gefallen sei. „Ich freue mich sehr,“ sagte Emil auf einem gemeinsamen Spaziergang am Fördeufer zu mir, „dass meine Einschätzung des Falles von der Oberstaatsanwaltschaft geteilt wurde.“ Emil pausierte erschöpft; sein Stumpf war entzündet, und er bewegte sich auf Unterarmkrücken. „Vielleicht bin ich ja doch nicht ein so schlechter Jurist.“ Von der anderen Seite der Förde grüßte der riesige rote Gedenkständer herüber. Ich zögerte, mich auf ein Gespräch mit Emil einzulassen. Würden nicht wieder nur Rechtfertigungen kommen von der Art: ‚Die Nazis haben die Autobahnen gebaut’? Nicht einmal die waren ja auf ihrem Mist gewachsen; die erste Teilstrecke hatte der damalige Oberbürgermeister von Köln, Konrad Adenauer, im August 1932 eröffnet.
„Warum solltest du ein schlechter Jurist sein?“, fragte ich dann.
Emil runzelte die gewölbte Stirn, in deren Mitte die Delle an die Zange erinnerte, mit der er geholt worden war. Er setzte sich wieder in Bewegung. „Weißt du, nirgends wird so viel gelogen wie in gerichtlichen und Ermittlungsverfahren. Aufgabe des Juristen ist es, das Gespinst aus Lügen zu durchdringen und die Wahrheit herauszufinden. Aber da ich nicht imstande war, das Lügengespinst der Nazis zu durchschauen, bin ich in Wahrheitsfindung offenbar nicht gut.“ Emils Mund wurde noch schmaler und verzog sich angewidert. Er tat mir leid – aber ohne Herablassung. Vielmehr fragte ich mich, ob ich einmal eine bessere Bilanz meines Lebens würde ziehen können als mein Vater, und mir wurde klar, dass das von den Herausforderungen abhing, mit denen ich konfrontiert werden würde.
„Ist es dir eigentlich schwer gefallen, gegen Fohrmann zu ermitteln?“
„Sehr.“
„Warum?“
„Wir kannten uns gut und waren – damals im Referendarlager in Jüterbog – Freunde geworden.“
„Wie das?“
„Nun ja – im Referendarlager, durch das damals alle angehenden Juristen geschleust wurden, hatte ich Quatsch gemacht.“
„Quatsch?“
„Wir kriegten wohl hundertmal täglich Gemeinschaftsgeist gepredigt. Mir und einigen anderen hing das zum Halse heraus. Ständig musste man sich anpassen. Jeder Individualismus ging dabei verloren. Ich hatte ja bis dahin brav und bürgerlich studiert, und die Verhältnisse in der Weimarer Republik waren so zerklüftet, dass einem gar nichts anderes übrig blieb, als sein eigenes und besonderes Wesen zu kultivieren; mein Freund Rudi und ich trugen nur Schwarz und suhlten uns in schopenhauerschem Pessimismus … Nichts gefiel uns besser, als bei einer guten Havanna über den Jammer des Daseins und das dumme und kurzbeinige Weibergeschlecht zu räsonnieren … Da kannst du dir vorstellen, wie sehr uns dieser verdammte Gemeinschaftsgeist nervte … Also haben wir, Max und ich und noch ein paar Kameraden, uns einen Streich ausgedacht.“
„Wann war das?“
„Im Sommer 34.“
Ich schaute meinen Vater erwartungsvoll an. Der fuhr fort: „Wir dachten: Man muss das einmal karikieren, damit sie begreifen, wie kindisch es ist, immer alles gemeinsam zu tun … Aufstehen, Putzen, Duschen, Essen, Trinken, Pinkeln, Gerätereinigen, sogar Naseputzen … Mit Max und drei anderen bin ich auf allen Vieren über den Hof gekrochen. Wir haben uns Klopapier um den Hals gehängt und zusammen skandiert: ‚Es ist ein Zeichen für Gemeinschaftsgeist, wenn die Kompanie gemeinsam scheißt!’“ Emil lachte erwartungsvoll, ich aber hob die Schultern, fand es nicht überwältigend.
„Und was war die Folge?“
„Wir hatten Glück. Der Propagandaminister war anwesend. Er war Zeuge unseres Aufzugs geworden, seine Suite und vor allem die Lagerleitung schaute ihn gespannt an. Aber er sagte mit gesalbter Herablassung: ‚Junger Wein muss brausen!’ Das ersparte uns eine offizielle Abstrafung.
„Und warum hast du es nicht abgelehnt, gegen Fohrmann zu ermitteln? Du warst doch befangen!“
„Das wäre kein Freundschaftsdienst gewesen. Das sah er genauso. Die Gefahr bestand, dass er in die Hände des jungen Jacobsen fiel, eines Karrieristen, der keinerlei Verständnis für die damalige Zeit aufbrachte.“
„Was hat Fohrmann getan?“
„Er hat – im Rahmen eines Vergeltungsbefehls – Erschießungen nicht nur von Kombattanten, sondern auch von Zivilisten angeordnet.“
„Was war ihr Verbrechen?“
„Sie hatten zwei von unseren Soldaten aus dem Hinterhalt erschossen.“
„War das bei Oradour?“
„Nein, Montagnac.“
„Hättest du das auch angeordnet?“
„Ich weiß es nicht. Ich bin ja glücklicherweise nicht Offizier geworden.“
„Warum eigentlich nicht?“ Emil zog die Augenbrauen hoch.
„Zur Offiziersprüfung gehörte auch ein Gewaltmarsch. Ich neigte zu Blasen, lief auf Vollballon und quälte mich unsäglich … Da kam ein Bauer mit seinem Dieselross vorbei. Er kam vom Markt, sein Anhänger war leer. Ich habe meiner Gruppe und mir selbst erlaubt, aufzusitzen …“ Er lachte bei der Erinnerung. „Aber das war natürlich eines künftigen Offiziers nicht würdig. Ich wurde Feldwebel – und wahrscheinlich hat mir das die Selbstachtung gerettet, die Kastenmine, auf die ich mit Lotte ritt, das Leben.“
Ich kannte das Bild, auf dem winzig klein ein Soldat auf einen ebenfalls winzigen Kaltblüter steigt. „Was für ein gutes Tier sie war!“, sagte Emil wehmütig. Dann fuhr er fort: „Das Problem war: Ich musste diese Freundschaft – und auch das Mitleid, das ich für Fohrmann fühlte – bei den Ermittlungen ignorieren, durfte aber auch nicht in den Fehler verfallen, überstreng gegen ihn vorzugehen, nur um den Verdacht einer eventuellen Befangenheit vorbauend zu widerlegen. Den Begriff des gesetzlichen Unrechts hatte es ja in unserer Ausbildung nicht gegeben. Da musste erst Radbruch kommen, um uns die Augen zu öffnen. Wir waren zu der Auffassung erzogen worden, dass Recht und Gesetz identisch seien. Und auch Radbruch ist erst 1946 so klug geworden, zu erkennen, dass unerträgliches Unrecht nicht dadurch Recht wird, dass es Gesetzesform annimmt.“
„Es ist also alles ausgegangen wie das Hornberger Schießen.“
„Nicht ganz. Es wurde rechtskräftig festgestellt, dass er Max Lohmann und nicht Max Fohrmann ist. Daraufhin hat er versucht, sich das Leben zu nehmen.“
„Die arme Helche,“ entfuhr es mir halblaut.
„Sprichst du von seiner Tochter?“ Ich nickte. „Bist du mit ihr befreundet?“ Ich nickte. „Habt ihr was miteinander?“ Ich schüttelte erschrocken den Kopf. Es erschien mir unmöglich, diese Frage wahrheitsgemäß zu beantworten. Hatte nicht mein Vater sich in jener Nacht auch in Helche verliebt? Die Vorstellung, mit dem eigenen Vater um dasselbe Mädchen zu rivalisieren, war mir unerträglich. Deshalb lenkte ich ab mit der Frage:
„Wenn du dich für einen schlechten Juristen hältst – warum hast du daraus nicht die Konsequenz gezogen und deinen Beruf aufgegeben?“
„Ich hatte Familie, Vilma – und dich. Ich hatte doch sonst nichts gelernt! Aber ich habe eine Konsequenz gezogen. Ich wurde mehrfach an höhere Gerichte berufen. Ich habe immer abgelehnt. Auf diese Weise habe ich mich bestraft.“
„Und warum bist du nicht wieder in die Kirche eingetreten?“
„Das ist ein weites Feld … Religionen, in denen Götter mit Menschenfrauen Kinder bekommen, sind heidnisch. Das Christentum ist eine solche Religion. An einen göttlichen Schöpfer vermag ich zu glauben, aber nicht daran, dass der Schöpfer einen Sohn zeugt, diesen hinrichten lässt und dann wieder von den Toten auferweckt. Das ist für mich eine wunderliche Moritat, mit der ich nichts anfangen kann. Der strenge Monotheismus von Judentum und Islam sagt mir mehr zu.“
„Und wie konntest du dann in eine dermaßen antisemitische Partei eintreten?“
„Antisemitisch waren schon viele gewesen – aber letztlich hatten sie dann alle mit den Juden zusammengearbeitet. Bismarck war Antisemit. Aber in Geldsachen verließ er sich auf seinen Bankier Bleichröder. Kaiser Wilhelm war Antisemit – und sein Bankier war Ballin. Ich hielt den Antisemitismus der Nazis für ein taktisches Manöver, um mit Hilfe antisemitischer Stimmen an die Macht zu kommen. Dass sie dermaßen blutigen Ernst machen würden, lag jenseits meiner Vorstellungskraft. Ich sage ja: Ich habe mich täuschen lassen, und ein guter Jurist lässt sich nicht täuschen.“
Wir kehrten nach Hause zurück. Mir war, als hätte ich ein Stückchen meines Vaters wiedergefunden. Es war groß genug, um ihn besser zu verstehen, aber nicht groß genug, um ihm zu verzeihen. Klein und läppisch war all das vor dem erdrückenden Gigantismus des schwarzen Teichs.
(weitere Kapitel in Arbeit)
Weder – noch
Karl Rossmanns Notizen
Was vorher geschah
Der 16jährige Karl Rossmann wird von seinen Eltern gezwungen, nach Amerika auszuwandern, weil er das Dienstmädchen Johanna Brummer geschwängert hat. Er findet Aufnahme bei seinem reichen Onkel, dem Senator Edward Jacob in New York, dessen Gunst er sich aber verscherzt, als er die Einladung eines Freundes von Edward Jacob, Mr. Pollunder, annimmt, diesen und seine Tochter Klara zu besuchen. Klara behandelt ihn in dem ihm zugewiesenen Schlafzimmer rücksichtslos mit Jiu-Jitsu-Griffen, wirft ihn fast aus dem Fenster, er rettet sich wieder in die Hauptwohnung des riesigen Hauses, aber dort konfrontiert ihn ein anderer Freund seines Onkels, Mr. Green, mit dem Rauswurf durch seinen Onkel. Verstoßen und obdachlos begibt er sich auf die Landstraße, in einem kleinen Wirtshaus lernt er Delamarche und Robinson kennen, zwei Arbeitslose, die nach Butterford wollen, wo es angeblich Arbeit gibt. Unterwegs besorgt Karl Proviant in der Küche des Hotels Occidental, das in der Stadt Ramses liegt. Dort nimmt sich die Oberköchin Grete Mitzelbach seiner an, verschafft ihm einen Job als Liftjunge, und er freundet sich mit Grete Mitzelbachs Sekretärin an, der Schreibmaschinistin Therese Berchtold. Doch Robinson dringt betrunken ins Hotel ein und beschmutzt es, Karl Roßmann wird erneut gefeuert. Delamarche lebt inzwischen mit der übergewichtigen früheren Sängerin Brunelda zusammen, die er an Bordelle ausleiht, so an das Unternehmen 25, in das Karl sie auf einem Wägelchen bringt. Im Traum hat er die Vision eines Naturtheaters, in dem alle eine Chance haben, eine Stelle zu bekommen. In diesem Naturtheater wird Musik mit Trompeten gemacht, und eine der Trompeterinnen ist Fanny, seine alte Freundin.

Sitze in der Buchhaltung des Unternehmens 25, benutze voller Schreiblust die Underwood, die mir hier zur Verfügung steht, und finde endlich Zeit, über das Geschehene zu berichten. Aber ich muss mich auf gelegentliche kurze Notizen beschränken, da ich hier nicht mein eigener Herr bin, sondern mit Kontrollen rechnen muss. Ich fange da an, wo mein getreuer Chronist seinen Bericht beendet hat: Bei meiner Ablieferung Bruneldas im Unternehmen 25. Sie war froh und lachte, als wir ankamen. Der Verwalter wies ihr ein Zimmer zu, ich musste auf dem Hof den ganzen Tag warten. Ein Junge, den sie „boy“ rufen, brachte mir einen Teller Bohnensuppe und eine Flasche Bier, so war es auszuhalten. Weil es kalt war, wickelte ich mich in Bruneldas Decke. Wie soll das weitergehen? Heute bringe ich sie hierhin und morgen dahin. Wir brauchen das Geld, weil Bruneldas Kasse leer ist. Sie ist leer, weil der selbstherrliche Delamarche nicht sparsam leben kann. Robinson schickt er in Wohnungen, und was der da treibt, kann man sich ausmalen. Am Abend spät kommt der Verwalter, drückt mir zehn Dollar in die Hand und sagt, das sei die Ablöse. Er wolle Brunelda behalten, weil sie das Geschäft belebe. Die Liste ihrer Vormerkungen werde immer länger. Ich soll den Wagen wieder mitnehmen und Delamarche das Geld bringen. Der wird ein Gesicht machen!
Er hat nicht nur ein böses Gesicht gemacht. Er hat getobt und mich angeschrien, die Ablöse sei ein Witz, Brunelda sei das Doppelte wert, ich hätte die Hälfte unterschlagen. Ich sagte, ich sei todmüde und müsse dringend schlafen. Aber er hörte nicht auf, mich zu beleidigen, ich krempelte meine Taschen um und zeigte ihm, was ich besaß: Nichts. Aber ich musste meine Sachen ausziehen, er suchte sie durch, schlug mir hart an den Kopf und warf mich nackt aus der Wohnung. Zum Glück stand Bruneldas Wagen noch im Hof, ich wickelte mich erneut in ihre Decke und sah zu, dass ich wegkam. Es war ja immer mein Traum gewesen, Delamarche zu entkommen. Aber ohne Kleider, nur in eine Decke gehüllt, hatte ich es mir nicht vorgestellt. Außerdem blutete ich am Kopf. Wohin mit mir?, überlegte ich. Auf Brunelda war kein Verlass, aber sie war der einzige Mensch, den ich und der mich kannte. An der Bahnbrücke gab es Nischen, ich legte mich in eine hinein. Sie stank nach Urin. Aber ich wollte nur noch schlafen. Und ich schlief gut, in Schlaf gewiegt durch das Gerumpel endloser Güterzüge.
Früh am Morgen ging ich in den Hof des Unternehmens 25. In der Mitte gab es einen Brunnen mit Pumpe, ich setzte mich auf die Einfassung, obgleich ich erbärmlich fror. Da sah mich der Junge, der mir die Suppe gebracht hatte. Hallo!, sagte er und tanzte um mich herum. Offenbar brachte mein Aufzug ihn zum Lachen. Dann holte er etwas Werg und riss ein Stück von seinem Hemd ab, damit verband er mir den Kopf. Ich sagte ihm meinen Namen, und er machte Charles daraus. Seinen Namen gab er mit Tuesday an, also Dienstag. In seiner Familie hießen alle nach den Wochentagen ihrer Geburt, seine Mum hieße auch Dienstag. Dann nahm er mich mit in sein windschiefes Holzhäuschen. Da brannte ein Feuerchen und ich konnte mich aufwärmen. Er zeigte mir seine Wäsche und seine Kleider, ziemliches Gelumpe, ich suchte mir ein Hemd und einen Drillich aus, auch Socken hatte er für mich. Die Sachen waren mir alle etwas zu klein, aber ich war froh, nicht mehr nackt zu sein. Als der Verwalter mich sah, erkannte er mich nicht wieder. Aber ich erzählte ihm, dass ich ihm Brunelda gebracht hätte und auch, was Delamarche gesagt hatte. Sie ist nicht doppelt so viel wert wie zehn Dollar, sondern zehnmal so viel!, sagte er grinsend. Ich fragte ihn, ob ich bei ihm Geschäftsdiener werden könne. Er schickte mich zum Oberbuchhalter. Das war ein schwammiger Mann, der hinter jedem Satz grundlos kicherte. Er stellte mich ein, aber für sehr geringen Lohn. Meine Aufgabe ist es, das Geld vom Oberkassierer in die Buchhaltung zu bringen. Dafür benutze ich eine chromglänzende Stahlkasse, die nur vom Oberkassierer und vom Oberbuchhalter geöffnet werden kann. Wenn also etwas fehlt, kann ich es nicht gewesen sein. Tuesday fragte mich, ob ich bei ihm übernachten wolle. Ein halber Cent pro Nacht war ihm genug. In ungelenker Druckschrift hatte er einen Vertrag entworfen, den ich unterschrieb. Wir rauchten einen Stumpen zusammen. Ich dachte an Robinson und seine Zigaretten. Da fiel mir ein, dass ich als Kind von meiner Mutter ein Buch mit dem Titel „Robinson“ vorgelesen bekommen hatte. Der fand, als er auf einer Insel einsam lebte, einen Freund, das war ein Menschenfresser, und den nannte er Friday. Ich erzählte es Tuesday. Er lachte mörderisch und sagte, er sei auch ein Menschenfresser, und biss mir in die Schulter.
Wenn der Oberkassier das Geld lispelnd und zischelnd in die Stahlkasse zählt, sehe ich, dass es wahre Berge von Dollarnoten sind. Ich fragte ihn, wieviel davon Brunelda verdient hätte, er sagte, gut ein Drittel. Da 25 Frauen im Unternehmen 25 arbeiten, teilen sich 24 von ihnen die restlichen zwei Drittel, kommen also auf einen viel kleineren Betrag, im Schnitt jede auf ein Sechsunddreißigstel. Der Verwalter hatte Recht: Brunelda war Gold wert. Ich sagte dem Oberbuchhalter, was ich ausgerechnet hatte. Du kannst rechnen?, fragte er nachdenklich und kicherte. Ob Brunelda wusste, dass ich in ihrer Nähe war? Ich bat Tuesday, es ihr zu sagen, aber er sagte, ob ich verrückt sei, der Frauenflur sei für Leute wie ihn tabu, ich sollte lieber selbst gehen und mich ihr zeigen, am besten gegen Mittag, dann habe sie ausgeschlafen und die Kundschaft komme meist erst gegen Abend.
Heute wurde ich einer Buchhalterin zur Ausbildung zugeteilt. Sie heißt Fanny und ist sehr streng. Sie gab mir ein Buch über doppelte Buchführung, das studiere ich Tag und Nacht. Meine Aufgabe ist es, den jeweiligen Lohn zu errechnen. Der gesamte Tagesgewinn wird gleichmäßig auf alle Arbeiterinnen aufgeteilt, und dann werden Aufwendungen für Essen und Trinken, Zimmermiete, Seife, Parfüm, Öle, manchmal auch Medikamente und Arztkosten davon abgezogen, außerdem Verwaltungskosten. Wenn Brunelda nicht wäre, bliebe da kaum noch was übrig, aber da sie das „beste Pferd im Stall ist“, wie der Verwalter sich ausdrückt, bekommen alle etwas mehr, und das ist der Grund, weshalb die Kolleginnen sie zwar beneiden, aber auch verehren. Das hat der Oberkassier mir erzählt. Warum die Kunden sie bevorzugen, weiß ich nicht. Sie ist fett wie ein Walross, und ich würde nicht auf die Idee kommen, mit ihr machen zu wollen, wozu Johanna mich verführt hat. Im Vergleich mit Brunelda war Johanna schlank und schön. Dabei fällt mir ein, dass ich einen Sohn habe. Wie er wohl aussieht? Was wird Johanna ihm über mich erzählen? Vielleicht gar nichts, weil sie längst einen Mann gefunden hat, der ihr den Fehltritt verzeiht, aber meinen Namen nicht hören will. Dass der Junge Jakob heißt, gefällt mir. Das ist ein guter Name, und mein Onkel heißt auch so. Mein Onkel! Warum nur hat er mich verstoßen? Ich kann ihm nicht böse sein. Er hat mich streng behandelt wie mein Vater. Durch ihn habe ich Englisch und Reiten gelernt und mich in der Geborgenheit seines Hauses an Amerika gewöhnen können.
Fanny taut langsam auf und gewinnt Vertrauen zu mir. Sie nennt mich spöttisch Negro, weil ich mit Tuesday befreundet bin. Sie hilft mir, mich besser und passender anzuziehen, und findet mich weltfremd. Das bin ich wohl auch, aber nicht eigentlich welt-, sondern amerikafremd. Alles wird hier in Geld berechnet, nicht mal ein Glas Wasser bekommt man umsonst. Sie hat mir auch ein Kämmerchen angeboten, es liegt neben dem ihren, ja, sie hat mich gebeten, es zu beziehen, weil der Verwalter sie bedränge. Wenn ich in ihrer Nähe sei, werde sie sich beschützt fühlen. Tuesday weinte, als ich bei ihm auszog. Aber ich versprach, ihm den halben Cent pro Nacht weiter zu zahlen. Seit ich Buchhalter bin, beziehe ich höheren Lohn. Fanny rät mir, nie zu zeigen, dass ich mit der Arbeit fertig bin, sondern so zu tun, als sei ich immer „busy“. In Amerika muss man immer „busy“ sein, sonst gilt man als Faulenzer.
Letzte Nacht gab es ein fürchterliches Getöse im Hof: Motorengewummer, Polizeisirene, mehrere Schüsse. Ich schlüpfte in die Kleider und wollte besinnungslos raus, aber Fanny hielt mich zurück: Bleib!, zischte sie im Hinauslaufen, dich kennen sie nicht, und das bringt dich in Gefahr! Durchs Fenster konnte ich kaum etwas sehen, nur herumirrende Schatten. Fanny kam zurück: Es hat einen Mord gegeben, und einer ist verhaftet worden. Sie weinte, ich saß auf ihrer Bettkante und wusste nicht, womit ich sie trösten sollte.
Tags darauf war eine der Frauen aus der Lohnliste gestrichen; Brunelda war es nicht. Und Tuesday war verschwunden. War er der Verhaftete? Oder war er weggelaufen, schreckhaft wie er ist? Ich hoffe, dass er wiederkommt, er ist mein einziger Freund. Dies schreibe ich eine Woche später. Ich bewege mich auf dünnem Eis. Als „Negro“ genießt man hier nicht das höchste Ansehen. Aus Fanny ist nicht herauszubekommen, was passiert ist. Sie sitzt mit übergeschlagenen Beinen und unbewegter Miene über ihren Büchern. Ich liebe ihre Brauen. Sie sind schwarz und schwingen sich in eine mir unbekannte Welt. Was kann so ein Frauengesicht alles verbergen! Zwar habe ich einen eigenen Schreibtisch, der längst nicht so komfortabel ist wie der, den ich bei meinem Onkel hatte (von einem Regulator kann keine Rede sein), aber nicht sorglos sehe ich hinaus in den Hof. Tuesdays Bude ist nur noch ein Haufen durcheinander liegender Bretter und Balken. Ich könnte schon Feierabend machen, aber solange Fanny nicht geht, gehe auch ich nicht. Der Mond scheint zu mir herein und sieht mich als armen Bureaubeamten eines Unternehmens, das ich aus meinem Lebenslauf besser fernhalte. Zu unsauber ist, womit und wie hier Geld verdient wird, auch wenn auf peinliche Sauberkeit geachtet wird. Fünf Frauen putzen täglich alles aufs Gründlichste, unter ihnen Tuesdays Mutter, das weiß ich, weil sie auch Tuesday heißt und auf der Lohnliste steht. Gestern, als sie im Hof alle auf dem Brunnenrand saßen und Stumpen rauchten, rief ich ihren Namen. Eine breithüftige Frau mit grauem Kraushaar, fleischigem Gesicht und vollen Lippen sah auf. Als ich sie fixierte, kam sie langsam auf mich zu. „Ich bin Tuesdays Freund,“ sagte ich. „Dann sind Sie Charles, der Negro.“ Ich nickte. „Ich freue mich, so kann ich Grüße ausrichten von meinem lieben Sohn. Ich habe ihn besucht, er ist im Gefängnis, bald bekommt er seinen Prozess.“ „Was wirft man ihm vor?“ „Das spreche ich nicht aus, es ist eine Lüge.“ Ich bat sie, ihm einen Dollar mitzubringen, wenn sie ihn das nächste Mal besucht. „Den Dollar nehme ich und kaufe ihm Lakritz dafür, Geld würde ihm nur abgenommen von den Wärtern.“ Ich wollte ihr die Hand geben. Aber sie hielt die ihre zurück, rollte umherblickend mit den Augen und sagte gepresst: „Machen Sie sich nicht unglücklich!“
„Ich war stellenlos,“ sagte Fanny mir eines Abends, als sie sich hinter dem Vorhang, der unsere Kammern trennt, bettfertig machte. „Da stieß ich auf die Anzeige des Unternehmens 25, sie suchten eine Lohnbuchhalterin, das traute ich mir zu. Außer mir gab es mehr als ein Dutzend Mädchen, die sich bewarben, aber sie konnten entweder nicht rechnen oder hatten eine saumäßige Klaue, und so wurde ich genommen. Was stellt man sich unter einem Unternehmen 25 schon vor? Sicherlich nicht das, was es ist, und als ich es begriff, war ich schon für drei Jahre unter Vertrag und muss nun noch ein halbes Jahr durchhalten, dann bin ich weg, wenn ich nicht vorher aus dem Fenster springe.“ „Warum erschreckst du mich mit solchen Äußerungen? Lieber solltest du darüber nachdenken, was aus mir hier wird, wenn du gehst. Noch nie habe ich mich so schmutzig gefühlt wie hier, und es ist ein Schmutz, den auch die schärfste Seife nicht abwäscht.“ „Und was meinst du, was für ein Schmutz das ist?“ „Ich weiß es nicht, er ist fettig uns stinkt.“ „Was Männer und Frauen hier tun, ist etwas Natürliches, und etwas Natürliches ist nie schmutzig. Aber es muss aus Liebe geschehen und nicht für Geld, dadurch wird es schmutzig. Ja, lieber Charles, du solltest hier auch nicht bleiben, und wenn ich gehe, biete ich dir an, mitzukommen.“ „Was, wirklich, das würdest du tun?“ „Du bist auch arm dran, und trotzdem hast du dich für Tuesday eingesetzt. Du hast ein gutes Herz, vor dir muss ich mich nicht fürchten. Vor dem Verwalter fürchte ich mich, er droht mir mit Schlägen, wenn ich ihm nicht zu Willen bin. Er hat schon mehrfach versucht, wenn du nicht da warst, mich auf das Kanapee zu werfen, das ja eigentlich eher eine Chaiselongue ist, aber bisher konnte ich mich ihm widersetzen. Jetzt wo du da bist, bin ich hier im Bureau entbehrlich und soll in das verwaiste Zimmer ziehen. Aber ich bin zum Mietmädchen nicht geboren.“ Fannys Worte taten mir gut und erfüllten mich mit einem uferlosen Gefühl der Sehnsucht nach Glück, und dieses Glück hatte schwarze Brauen. „O Fanny, süßeste aller Frauen, was hast du mir angetan?“, rumorte es in meinem Inneren, „ja, nimm mich mit, wenn du fortgehst, denn ohne dich will ich hier nicht bleiben, und wo du hingehst, will auch ich hingehen!“
Hier sitze ich nun an meinem Schreibtisch, das Gaslicht rauscht über mir, und ich denke darüber nach, was aus mir werden soll. Gäbe es nicht einen besseren Posten für mich, als Buchhalter eines Katzenhauses zu sein? So nennt man in Amerika ein Bordell, auch wenn es keine einzige Katze darin gibt. Der Blick in den Innenhof ist mir verleidet, weil er mich an Tuesday erinnert, der spurlos verschwunden ist. Und verschwunden ist auch Fanny; dem Verwalter ist es gelungen, sie mit einer Mixtur aus Drohungen und Liebenswürdigkeiten gefügig zu machen, und nun steht sie auf meiner Lohnliste. Am letzten Abend hat sie sich mit den Worten verabschiedet: „Komm, Charles, lass uns das tun, was ich nun bald für Geld tun muss. Ich liebe dich und möchte, dass du mich besitzt, bevor fremde Männer gegen Bares in mich eindringen. Wenn du meine Liebe erwiderst, dann ziere dich nicht lange und erfülle meinen Wunsch!“ Ich habe ihn ihr erfüllt, und wir haben beide geweint. Ich habe ihr Grüße an Brunelda aufgetragen, sie will sie ihr ausrichten. „Sag mir, was du über Tuesday weißt!“, forderte ich sie auf. Aber sie schwieg und sagte dann: „Er hat es jetzt besser.“
Eine Tüte mit goldglänzenden Kugeln der Marke Hershey‘s lag heute Morgen auf meinem Schreibtisch, beigefügt war ein Zettel:
Liebster Karl,
ich wusste ja gar nicht, dass Du hier bist! Jetzt erreichten mich Deine Grüße durch eine neue Kollegin. Ich freue mich, dass Du in meiner Nähe bist, und habe auch Nachrichten für Dich, die Dich interessieren werden. Komm bitte morgen um 10 Uhr auf einen Kaffee zu mir aufs Zimmer, der Verwalter weiß Bescheid. Genieße die beigefügten Trüffel! Sie sind ein Kavaliersgeschenk an mich, doch ich bin üppig genug, das viele Fleisch, mit dem ich mein Geld verdiene, ist mir oft eine Last. Und verzeih mir, dass ich oft garstig war, das war ich nur, weil Delamarche mich drangsalierte. Hier führe ich ein freies Leben, und es geht mir gut!
Deine Brunelda
Ich las diese Mitteilungen mit einer Mischung aus Freude und Angst. Konnten es andere als schlechte Nachrichten sein, die sie für mich hatte? Erfreulich war, dass sie von meinem Verbleib im Unternehmen 25 gar nichts wusste! Dann beruhte meine Karriere zum Oberbuchhalter also nicht darauf, dass sie von ferne die Hand über mich hielt! Ich war allein durch meine Tüchtigkeit und die Protektion Fannys so weit gekommen! Das erfüllte mich mit gelindem Stolz, der aber bald von der Angst vor den Nachrichten, die Brunelda für mich in petto hatte, niedergewalzt wurde. Hatte das OCCIDENTAL Ermittlungen gegen mich in Gang gesetzt? Beanspruchte Delamarche weiterhin Ersatz für die angeblich unterschlagene Hälfte von Bruneldas Ablöse? Musste ich nun doch Alimente für den kleinen Jacob zahlen, den Johanna Brummer mit meiner widerwilligen und lüsternen Hilfe in die Welt gesetzt hatte? Die wildesten Spekulationen gingen mir durch den Kopf, und ich merkte, dass ich mich schuldig fühlte, obgleich ich es vielleicht gar nicht war. Hatte Johanna mich nicht verführt? Aber hätte ich nicht ein Präservativ benutzen können? Hatte ich nicht alles getan, um Robinson an der Besudelung des Hotels zu hindern? Aber hätte ich ihn vielleicht gar nicht erst eintreten lassen dürfen? Und hatte ich die Ablösesumme nicht vollständig an Delamarche abgeliefert? Aber hatte ich nicht auch wenigstens kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt, ein wenig von dem Geld für mich abzuzweigen? Konnte man nicht auch für nur erwogene Verbrechen bestraft werden? Stand das nicht sogar in der Bibel?
Diese Überlegungen ermüdeten mich schrecklich. Ich schloss die Tür ab und legte mich auf das Kanapee, von dem Fanny gesagt hatte, es sei eigentlich eher eine Chaiselongue, schlief und träumte von einer Arbeitsmöglichkeit bei einem großen Zirkus. Er nannte sich „Naturtheater“ und warb auf Plakaten um Mitarbeiter mit den Worten: „Jeder ist willkommen! Verflucht sei, wer uns nicht glaubt!“ Und tatsächlich: Ich wurde angenommen – wenn auch nicht als Künstler oder Ingenieur, sondern als europäischer Mittelschüler, der ich ja mal gewesen war! Und ich traf Fanny wieder – als trompetenden Engel – und Giacomo, der als Liftjunge im OCCIDENTAL mein Kollege gewesen war.
Ein fürchterliches Krachen weckt mich auf. Die Tür ist aufgebrochen worden, das Schloss liegt am Boden, und in der Tür steht, schwitzend, schwankend und heruntergekommen, Delamarche. „Hier find ich dich also, embezzler!“, lallt er. „Das wirst du mir büßen!“ Er dringt ein und beginnt, Kisten und Kasten aufzureißen, ich aber, von Schlaf und Traum gestärkt, stelle mich ihm entgegen, ringe ihn nieder auf das Kanapee und presse das Gesicht des Strampelnden so lange in die Polster, bis er erschlafft. „Entfernen Sie sich!“, herrsche ich den Betrunkenen an, „und wundern Sie sich nicht über die gesalzene Schlosserrechnung, die ich gezwungen bin, Ihnen zu schicken!“ So habe ich ihm heimgeleuchtet, und ein besseres Vorspiel zum Treffen mit Brunelda kann es nicht geben als diesen Sieg über einen verleumderischen Erpresser.
Aber ich hatte mich getäuscht. Es war ein Pyrrhus-Sieg. Das Wort hab ich bei Studienrat Dr. Krumpal im europäischen Lateinunterricht gelernt, ich hoffe, ich benutze es richtig. Es gab wieder Aufruhr und Polizei, Schüsse fielen, und am Ende war Brunelda tot, Delamarche hatte sich nicht damit abfinden können, dass sie nicht mehr für ihn arbeitete. Er hat sie unter falschem Namen besucht und erwürgt. Ich habe Brunelda nicht allzu gern gehabt, aber so ein Ende hat sie nicht verdient. Was für eines habe ich verdient? Werde auch ich auf dem elektrischen Stuhl Platz nehmen dürfen, durch den der Fortschritt Schlinge, Henkersbeil und Guillotine ersetzt hat? Nicht umsonst hält die Statue der Freiheitsgöttin ein Schwert in der hochgereckten Rechten. Und was waren das für Nachrichten, die Brunelda für mich hatte? Ich werde es nie erfahren. Noch ist ihre Leiche im Kühlhaus, der Attorney hat sie nicht freigegeben, aber zu ihrer Bestattung werde ich gehen. Sie war katholisch wie Johanna Brummer, und es ist keineswegs falsch, vorm Symbol des gekreuzigten Juden demütig den Kopf zu neigen. Das Leiden ist als solches verehrungswürdig, denn so verdient es immer sein mag, es ist doch immer Leiden. Und gibt es verdientes Leiden überhaupt? Ist nicht alles Leiden unverdient?
Alle waren da, der Verwalter, der Oberkassier, Bruneldas Kolleginnen, unter ihnen auch Fanny, die ich kaum wiedererkannte, weil sie dicker geworden war; dazu Polizisten, Geschäftsdiener (boys), und Herren aller Couleur, nein, das ist missverständlich, sie waren alle weiß, aber nicht alle trugen Pelerine und Zylinder, wie es sich gehört, sondern viele auch schlichten dunklen Rock und Schiebermütze. Sie mochten sich das Vergnügen, Brunelda besuchen zu dürfen, wohl mühsam vom Munde abgespart haben. Und, was mich erstaunte, manche waren mit ihrer Frau gekommen, gingen Hand in Hand mit ihr, schwangen das Bambusstöckchen in der linken Hand, ein Assessoire, das schwer in Mode gekommen ist, ich habe es ja zuerst in Onkel Jakobs Hand gesehen, der auch ständig damit gespielt oder es auf den Boden gestoßen hat – damals, auf dem Dampfer meiner Ankunft. Bruneldas riesiger Sarg – sie war eine riesige Frau gewesen – war mit einem Bukett aus weißen Chrysanthemen geschmückt und wurde von den Tenören und Bässen der Met, an der sie einst als Sopranistin unter Vertrag gewesen war, zu Grabe getragen. Ich weinte, und als eine Hand sich in die meine schlich, weinte ich noch mehr, denn obgleich sie fester als früher war, wusste ich doch gleich: Es war Fannys Hand. Der Trauerzug passierte einen hoch aufragenden Marmorengel und eine protzige Kapelle, hinter die zog Fanny mich, legte den Finger auf die Lippen, und ich erinnerte mich, dass es den Frauen des Unternehmens 25 strikt verboten war, Liebesbeziehungen einzugehen. Gebückt schlichen wir immer weiter fort, die Deckung von Grabmälern, Bäumen und Buchsbaumhecken geschickt nutzend. Schließlich gelangten wir an ein frisches Grab, in dem Massen von Blumen, eben noch frisch, über einander lagen und zu welken begannen, in das ließ Fanny sich fallen und zog mich mit. Sie drückte mich so fest an sich, dass mir die Luft wegblieb. Ihr aufgedunsener Körper hatte dennoch seinen Reiz nicht verloren und versuchte mich sehr, ich knöpfte mir die Hose auf, aber sie wehrte mich ab und raunte: „Nein, Charles, beschmutze dich nicht mit mir, ich bin nicht mehr die saubere Fanny, die du einst gekannt hast, ich bin eine Besudelte und Infizierte, aber ich leihe dir eine zärtliche Hand, o du mein über alles geliebter Charles!“ Im dumpfen Moderduft der Rosen, Nelken und Hyazinthen verbrachten wir eine selige Stunde, und in dieser Stunde erfuhr ich, was sich für mein Weiterkommen als nützlich erweisen sollte, aber ich wurde auch gewarnt. „Man wird dir eine Frau aufdrängen, und arglos, wie du bist, wirst du sie heiraten und mich vergessen.“ Ich widersprach ihr leidenschaftlich, versprach ihr ewige Treue – aber sie murmelte unter Tränen: „Ich bin es nicht wert. Vergiss mich!“
Ich sitze wieder an dem Schreibtisch, der mittels eines Regulators auf alle Papier- und Aktenformate eingestellt werden kann, im fünften Stock des Bureauhauses meines Onkels. Diese Karriere verdanke ich nicht dem Oberkassier, sondern allein der Information Fannys, der Brunelda erzählt hatte, dass ihr wichtigster und spendabelster Freier aus New York sei, ein Tallyman (Zollinspektor) in den Lagerhäusern am Hafen, aber sie würde sich nicht wundern, wenn er ihr Besitzer wäre. Und bei der Beisetzung Bruneldas habe eine Kollegin ihr zugeraunt: „Der Große da in Pelerine und Zylinder mit dem Bambusstöckchen, weißt du, wer das ist? Das ist ein leibhaftiger Senator aus New York, Bruneldas Tallyman!“ Ich konnte es nicht fassen. Was hatte mein sittenstrenger und prinzipientreuer Onkel mit dem Unternehmen 25 zu tun? Die Antwort drängte sich auf: Er war sein Besitzer und der Verwalter nur sein Strohmann, denn es durfte keinesfalls bekannt werden, dass er ein Cathouse besaß, und noch weniger, dass er Kunde von dessen größter Attraktion gewesen war, der ehemaligen Operndiva Brunelda. Ich hatte ihn hoch geachtet, und auch sein brutaler Entlassungsbrief hatte mich in meiner Hochachtung nicht irrewerden lassen. Aber nun fiel ein ganz anderes Licht auf ihn, nicht einmal unbedingt ein schlechtes, denn auf eine Weise, die ich noch nicht ganz verstehe, scheinen ja Bordelle auch ihren Beitraq zu Ordnung und gesellschaftlicher Stabilität zu leisten. Der Mann scheint für die Einehe nicht geschaffen. Ich fasste mir ein Herz und schrieb ihm einen Brief mit der Underwood, den ich noch auswendig weiß, weil ich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt habe:
Lieber Onkel Edward,
es ist ungewiß, ob ich Dich so noch nennen darf, da Du mich verstoßen hast, aber verwandt ist verwandt. Verzeih mir, daß ich mich unaufgefordert an Dich wende, aber der Zufall hat es gefügt, daß ich Oberbuchhalter im Unternehmen 25 geworden bin, von dem gemunkelt wird, es gehöre einem namentlich nicht in Erscheinung tretenden New Yorker Senator. In meinen Büchern taucht ein sehr gut zahlender Tallyman aus dem Hafen auf, Gordon Czech, als wöchentlicher Besucher unserer jüngst verstorbenen Brunelda; bist Du der besagte Gordon Czech? Es könnte ja sein, daß Du Dir, um Deinen guten Ruf zu schützen, ein Pseudonym zugelegt hast; denn leider ist auch in einem so freiheitlichen Land wie dem unseren der Kauf von Liebesdiensten immer noch anrüchig, obgleich es wohl nur wenige gesunde Männer gibt, die noch nie einen Dollar dafür ausgegeben haben, allein das Unternehmen 25 verzeichnet 2964 Kunden. Eine Freundin meiner Freundin will Dich auf dem Begräbnis Bruneldas gesehen haben, aber das kann natürlich ein Irrtum gewesen sein. Mit Brunelda war ich gut bekannt, leider auch mit ihrem Mörder, den der elektrische Stuhl erwartet. Wie es dazu kam, kann ich Dir, wenn es Dich interessiert, gelegentlich mündlich berichten.
Ich wage nicht zu hoffen, dass Du mir mein eigenmächtiges Fortbleiben zum Besuch von Mr. Pollunder inzwischen verziehen hast, aber ich wollte Dich wenigstens wissen lassen, dass ich ein tüchtiger Buchhalter geworden und stolz darauf bin, meinem Onkel, wenn das Gerücht denn wahr ist, weiterhin dienen zu dürfen. Dein Karl.
Des Risikos, das ich mit diesem Brief einging, war mir wohl bewusst; wochenlang wartete ich auf eine Reaktion, besonders natürlich auf den ersehnten Hinauswurf, aber er kam nicht, ja, der Verwalter war zuvorkommender denn je, auch der Oberkassier war plötzlich wie Samt und Seide, hakte meine Bücher ab, ohne sie sich anzugucken. Das einzige, was mir angekreidet wurde, war Fannys Verschwinden, denn sie war zuletzt mit mir gesehen worden. Ich wurde verhört und noch mal verhört, aber ich konnte nur sagen: Sie hatte mir nichts davon gesagt, dass sie wegwollte, geschweige denn ein Ziel genannt. Dann kam der große Tag: Ein crèmefarbener Stoddard-Dayton fuhr vor mit schwarzem Chauffeur. Er überreichte mir einen Brief, der nur die Worte enthielt: „Bitte komm zu mir zurück, lieber Neffe Karl, ich habe Dir verziehen und bereue meine übertriebene Strenge!“ Einen Augenblick zögerte ich: Sollte ich in die Höhle des Löwen zurückkehren? Dann nahm ich kurzentschlossen auf prall glänzenden Lederpolstern Platz, wurde ins Herz von New York kutschiert, in alle früheren Rechte und Räumlichkeiten wieder eingesetzt, und dann geschah etwas, das zu berichten mir offen gestanden überaus peinlich ist: Mein Onkel, ergraut und gealtert, aber sonnengebräunt, kam zu mir ins Zimmer, verschloss hinter sich die Tür, und dann umarmten wir uns nicht etwa, sondern er kniete vor mir nieder und bedeckte meine Hände mit Küssen. Aber die Macht, die ich ganz offensichtlich jetzt über ihn habe, erfüllt mich nicht nur mit Glück, sondern auch mit Angst: Wie leicht könnte er sich eines Menschen, der zu viel über ihn weiß, entledigen – über dienstbare Geister, die zu jeder Schandtat für ihn bereit wären, verfügt er genug. Die Geschäftswelt New Yorks ist brutal und rücksichtslos, und ich weiß, dass ich mit einem Bein im Grab stehe, selbst die vom Onkel ins Auge gefasste Ehe mit Clare Pollunder, deren Verlobter Mack bei einem Reitunfall ums Leben kam, wird mich nicht endgültig absichern, denn Clare ist, wie ich bei meiner Ankunft erfahren habe, zwar eine Schönheit, aber die skrupelloseste von allen.
Ich beaufsichtige seit Wochen die Lagerhäuser am Hafen, in denen es nach Nelken, Muskat, Kardamom, Zimt und Kreuzkümmel riecht. Ich hatte mal 20, mal bis zu 100 Schauerleute zu beaufsichtigen, je nachdem, wieviel zu stauen war, zu Beginn tanzten sie mir auf der Nase herum, schließlich war ich erst 18, befolgten nur widerwillig meine Anweisungen, und lachten lauthals über mein lückenhaftes Englisch.
Meiner Verlobung mit Clare hatte ich in tiefem Fatalismus entgegengesehen. Jeder andere hätte sich gefreut, die Tochter eines steinreichen Kaufmanns zu ehelichen, aber ich gruselte mich vor ihr. Hatte ich einstmals ihren roten Mund als das einzig Anziehende an ihr bewundert, erschreckte mich jetzt ihre Blässe, die sie, seit Mack, ihr eigentlicher Zukünftiger, tot war, nicht mehr mit Puder zu übertönen versuchte. Ich war für sie offensichtlich nur zweite Wahl, sie wollte auf mich nicht anziehend wirken und bemühte sich nicht im Geringsten, das zu vertuschen. Sobald das Gespräch auf Mack kam – und es kam oft auf ihn, Clares Wohnung war förmlich vollgestopft mit Schleifen und Pokalen des routinierten Reiters und Sportwagenfahrers – geriet sie schnell ins Schwärmen darüber, wie gut er zu ihr gepasst habe, sie seien wie Schlüssel und Schloss für einander gewesen, und sie könne nur hoffen, dass es ihr gelinge, ihn in der Ehe mit mir, am besten über ein schnelles Kind, zu vergessen. Ich nannte ihn mit liebevollem Spott ihren Hillbilly, aber sie entgegnete mir durchaus verärgert, ein Hillbilly sei doch wohl eher ich, sie habe in den Atlas geschaut und gesehen, dass meine Heimatstadt im fernen Tschechien von Bergen umgeben sei. Und ich solle mir keinerlei Illusionen machen: Sie wolle weder unverheiratet bleiben, noch mich lieben, ihr einziger Liebster habe die Pferde und die Automobile mehr geliebt als sie und sei schließlich ihr Opfer geworden. Ob nicht auch ich ein Anliegen hätte, das mir wichtiger sei als sie? Ich wolle, antwortete ich, weder erneut verstoßen werden (und das würde ich, wenn ich die Ehe mit ihr ausschlüge), noch wolle ich letztlich, so leid mir das tue, sie, denn meine einzige Liebe sei Fanny, meine frühere Vorgesetzte. Da funkelte Clare mich drohend an und sagte: „Oho, wie ich dir, so du mir! Aber der Unterschied ist: Mein Geliebter ist tot, deine Geliebte aber dürfte noch am Leben sein.“ Herr Pollunder, der unseren Dialog belauscht hatte, kam herein, tanzte um uns herum und rief: „Ihr bleibt nicht länger zusammen, als Edward Jacob lebt, aber was soll’s? Es sind Ehen schon unter ungünstigeren Auspizien geschlossen worden! Und lebt er lange, bleibt ihr lange zusammen, macht mir nur recht bald ein Enkelchen, ein gesundes kleines Enkelchen mit zwei gesunden kleinen Eiern!“ Clare errötete, was ihr gut zu Gesichte stand, ob der Drastik ihres Vaters, fasste mich unter dem Arm und sagte: „Komm, wir gehen nach nebenan und schreiten gleich zur Tat!“ Aber ich war wie erstarrt, und so begnügten wir uns damit, uns gegenseitig die von Diamanten strotzenden Ringe auf den linken Ringfinger zu streifen und die Liste unserer Trauzeugen und der Brautjungfern durchzugehen. Ich würde gern Renell, Giacomo und Therese aus dem Hotel OCCIDENTAL benennen, am liebsten auch Fanny, aber sie ist spurlos verschwunden.
In Europa ist Krieg. Sollte ich mich freuen, dass ich hier in Sicherheit bin? Ich bin im besten Soldatenalter, und alle meine früheren Klassenkameraden müssen an die russische Front. Zum ersten Mal denke ich jetzt auch wieder an Paulchen, meinen Bruder, den Braven, Daheimgebliebenen.[5] Freilich war er nicht brav genug, um ein freier Mann zu bleiben – er wanderte wegen einer lächerlichen Unterschlagung ins Gefängnis. Wird es ihn vor der Front bewahren? Dann wäre es ja das einfachste Mittel, der Einberufung zu entgehen, dass man kriminell wird. Eine Gefängniszelle ist doch komfortabler als der Schützengraben. Aber ich fürchte, dieser wohlfeilen Form von Drückebergerei wird man den Riegel vorschieben. Bei meinen Schauerleuten sind zwei Landsleute, Heinrich aus Pilsen, ein Schmied, er hat nur ein Auge und möchte heimkehren, um seine vaterländische Pflicht zu erfüllen, und Ernst aus Linz, er möchte in die Hotellerie, ich habe ihm das OCCIDENTAL in Ramses empfohlen. Wird meine Empfehlung ihm nützen? Vielleicht bei Grete Mitzelbach aus Wien, der Oberköchin, an die soll er sich wenden. Briefe an sie, an Therese, Renell und Giacomo hab ich ihm mitgegeben. Als wir Abschied von einander nahmen, haben wir uns umarmt und haben uns in der Umschlingung regelrecht ineinander verknotet. Er ist zierlich und fast noch hübscher als Giacomo; was ihm an Kraft beim Stauen fehlte, glich er durch Geschicklichkeit aus. Er würde als Liftjunge eine hervorragende Figur abgeben und dem ebenholzfarbenen Renell bei den Frauen Konkurrenz machen, wenn ihn nicht gar ausstechen. Ich traue ihm zu, dass er wird, was ich nie werde: Ein wahrer Don Juan, dessen Eroberungen sich auf einem schier endlosen Faltblatt, genannt Leporello, zusammendrängen. Warum tue ich mich so schwer mit den Frauen? Ich muss zu ihnen aufsehen, sie bewundern können, um wahrhaft zu lieben – aber alles endet in beschämender, dampfmaschinenartig stoßender, banaler Fleischlichkeit.
Wie sportlich und stark Clara war, hatte ich bei unserer ersten Begegnung im Haus ihres Vaters erfahren müssen, ich hatte Todesangst ausgestanden, als sie mich bezwang und fast aus dem Fenster des hochgelegenen Zimmers warf. Der sagenhaften Brünhilde gleichend, die ihren Freier Gunter fesselte und unter die Decke hängte, war sie wohl nur von Mr. Mack, ihrem Siegfried, zu bezwingen gewesen, über mich lächelte sie verächtlich und voller Mitleid. Als nun aber der Zirkus Johnny L. Jones Combined Shows in einem Vorort von New York gastierte und mit einer über alle Maßen starken Frau warb, war Clara sofort Feuer und Flamme und wollte sie erleben. In dem crèmefarbenen Stoddard-Dayton fuhr Runaway uns nach Newark. Der Zirkus war ausverkauft, aber Runaway hatte einen Freund unter den blaurot und silbern livrierten Platzanweisern, der uns auf Plätze hineinschmuggelte, die technischem Personal vorbehalten waren.

Der beißende Geruch nach Großkatzen mischte sich mit dem von Pferden, Dickhäutern und Sägemehl, in drei nebeneinander liegenden Arenen fanden die Vorführungen unter schmetternder Musik in atemberaubendem Wechsel statt, und während Käfiggitter für die Löwennummer aufgebaut wurden, vertrieb uns ein Clown in viel zu weiten Kleidern die Zeit mit Kunststücken auf seiner Trompete, der er auch, wenn er sie umgekehrt hielt, blökende Töne zu entlocken wusste, dabei hielt er den Kopf auf eine Weise schräg, die mit vertraut vorkam, und dann schimpfte er mit einer unverkennbaren Frauenstimme, die, obgleich sie verstellt war, in mich einschlug wie ein Blitz. Und während Clare neben mir mit dem Opernglas die Hebekunst Sandwinas, der deutschstämmigen Athletin, verfolgte, die ihren Gatten auf dem gestreckten rechten Arm jonglierte, und sie, Clare, dabei einmal ums andere ausrief: „Enorm, wahrhaft enorm!“, hatte ich nur Augen für die bezaubernde Clownin und war entzückt, von Clare wenig später zu hören, dass ihr Daddy Anteile an den Johnny L. Jones Combined Shows halte, so dass es ohne weiteres möglich sei, Sandwina und, wenn ich es unbedingt wolle, auch die Clownin, deren Nummer ja nun eher als abgeschmackt zu bezeichnen sei, für das Rahmenprogramm unserer Hochzeitsfeier zu gewinnen.
Als Runaway mich wieder einmal zur Arbeit an den Hafen fuhr, sah er die Trauer in dem Blick, mit dem ich ihn fixierte, und er fragte mich nach dem Grund. Ich sagte ihm, dass ich mich durch ihn an einen guten Freund erinnert fühlte, den ich im Unternehmen 25 hatte und der auf Nimmerwiedersehen in der Untersuchungshaft verschwunden sei. Er fragte mich nach den Umständen, ich erzählte ihm von der unruhigen Nacht mit Polizeisirenen und Geschieße, und dass hinterher Tuesday weg und eine unserer Frauen tot war. Runaway schwieg mit einem vielsagenden, halb traurigen Lächeln. „Es ist klar, dass man ihm den Tod der Frau zur Last gelegt hat. Einen Prozess wird er kaum bekommen, und wenn, dann müsste der Attorney ihm nicht seine Schuld, sondern er müsste seine Unschuld beweisen, und das gelingt ihm nie. Nein, die Polizei wird ihn freilassen. „Was?“, sagte ich hoffnungsvoll, „dann besteht Hoffnung, dass ich ihn wiedersehe?“ Runaway schüttelte sein weises Haupt, auf dem graue Locken sich kräuselten. „Die Polizei lässt ihn frei, aber in eine erregte, von seiner Schuld überzeugte weiße Menschenmenge hinaus.“ Ich wusste genug, denn die Bilder hatte ich in den Postkarten-Auslagen von Kiosken gesehen: Weiße Männer, die sich unter einem über ihnen hängenden Schwarzen versammelt hatten und selbstzufrieden, wenn nicht sogar stolz in die Kamera feixten. „Kann ich noch etwas für ihn tun?“ Runaway lächelte und begann das Lied zu singen, das von dem „sweet chariot“ handelt, der herabkommt, um Elias zu erlösen – ich hatte es auch von Tuesday mehrfach gehört.
Heute gab mir der Onkel einen Feldpostbrief, den Paulchen an ihn geschrieben hat:
Lieber Onkel Edward,
wir haben lange nichts von Dir gehört, es geht Dir hoffentlich gut. Hat Karl, den die Eltern vor einem Jahr nach Amerika geschickt haben, sich bei Dir gemeldet? Bejahendenfalls grüße ihn bitte und sage ihm, dass ich Pate seines Jungen geworden bin, der sich prächtig macht. Ich bin an der italienischen Front am Marmolata-Gletscher, die Verpflegung hier ist besser als an der russischen, aber wir langweilen uns und frieren. Alles Gute wünscht Dir Dein Neffe Paul
Postscript: Nach dem Krieg komme auch ich und hoffe auf Deine Hilfe! D.O.
Paulchen war der Haft also entkommen, wohl weil man der Meinung war, dass Straftäter an der Front besser aufgehoben seien als im Knast. Davon sagte ich aber dem Onkel nichts. Er musste von Paulchens Verurteilung zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe ebenso wenig wissen wie von unserem jahrelangen Streit, den beizulegen offenbar Paulchens Absicht war, als er die Patenschaft für den kleinen Jakob übernahm. Dass dieser sich „prächtig macht“, war wohl nur eine Floskel, über die ich mich trotzdem freute, wusste ich bis dato doch gar nichts über meinen Sohn, und dann kann sogar eine Floskel beruhigen. Wie alt mochte er jetzt sein? Bei meiner Abreise war er etwa ein Jahr alt gewesen, also mochte er jetzt zwei Jahre alt sein und mit Laufen und Sprechen beginnen. Sollte Paulchen Johannas Verführungskünsten ebenfalls erliegen, würde er vielleicht nach dem Ende des Krieges, und das konnte bald sein, mit ihr und dem Stief- und Patensohn und wahrscheinlich auch mit einem ehelichen Kind hier aufkreuzen. Würde er sich mit meiner starken Stellung bei Onkel Edward abfinden können? Oder würde der Neid ihn zu Intrige und übler Nachrede veranlassen, wie ich sie von ihm kannte? Ich erwog, wenn Paulchens Einwanderung konkret werden sollte, die Nachricht von seiner Straffälligkeit einzusetzen, um ihn vom Haus des Onkels und dessen Wohlwollen abzuschneiden. Üble Nachrede würde das nicht sein, sondern nur Unterrichtung über ein Faktum. Und ich bin nicht bereit, das Kriegsbeil so bald zu begraben nur auf Grund einer Patenschaft, von der ich mir eh nicht viel Gutes verspreche.
Im Juli begannen die Ermittlungen der Bauerarbeiter-Gewerkschaft gegen Edmund Mack sen., den Vater von Clares verunfalltem Verlobten. Ihm wurde vorgeworfen, Bauaufträge mit Hilfe riesiger Bestechungssummen als scheinbar billigster Anbieter an Land gezogen zu haben, Konkurrenzfirmen waren von ihm bestochen worden, teurere Angebote abzugeben. Als der Bürgermeister nicht mehr mitspielen wollte, ersetzte er ihn durch einen Freund, dessen Wahl er sicherte, indem er die Gewerkschaft der über 10.000 Barkeeper auf seine Seite zog und ebenfalls die gesamte Hotellerie für seinen Mann werben ließ. Der wurde gewählt, aber die Times deckte die Zusammenhänge auf und klagte Mack der aktiven und die für ihn tätigen Beamten der passiven Bestechung an. Er entzog sich der Verhaftung, indem er auf Reisen nach Europa ging, um dort einem Kartell für den Wiederaufbau deutscher Kriegszerstörungen in Belgien beizutreten. Clare war empört, dass man ihren Beinahe-Schwiegervater für korrupt hielt. „Korrupt sind viele, aber nicht er!“, sagte sie. „Er hat schon als Student Bestechungsmethoden angeprangert und hat sich immer für Gesetz und Recht eingesetzt.“ Sie verabschiedete sich unter Tränen von ihm, als er das größte Schiff der Cunard-Linie bestieg, die vierschlotige Lusitania.
Ich bemühte mich, den frohen und zuversichtlichen Bräutigam zu spielen, während in meinem Innern schwarze Verzweiflung herrschte. Clare hatte sich die Haare kunstvoll um den Kopf winden lassen, so dass sie apart asymmetrisch daherkam, auch ihr Lächeln erschien mir schief, und ihr gelang die Darstellung einer glücklichen Braut noch weniger als mir die des stolzen Eroberers einer schwerreichen Frau. Sie lächelte zwar, aber ihr Lächeln war wie eingefroren und bloße Maske. Ich hatte meine goldenen Manschettenknöpfe vergessen, zum Glück war Giacomo gekommen und half mir mit seinen messingnen aus. „Ja, aber dann hast du keine!“, wandte ich ein, doch er meinte, im Blickpunkt stünde nicht er, sondern ich, und er sei mir auch zu Dank verpflichtet, weil er seit meinem Weggang wieder Liftjunge im OCCIDENTAL sei. Die Oberköchin war da, anlassgemäß in eine senffarbene Rüschenbluse und einen dunkelgrünen Stufenrock gekleidet. Sie vertrat die Stelle einer Mutter an meiner Seite. Dafür war ich sehr dankbar, die gegen mich vorgebrachten Anschuldigungen im Hotel hatten sie also nur vorübergehend verstimmt. Sie erriet, was in mir vorging. Ich hatte mich bei ihr eingehängt und schmiegte mich an sie, da raunte sie mir zu: „Noch kannst du den Kopf aus der Schlinge ziehen!“ Aber dazu fehlte mir der Mut, ich hatte die Not der Landstraße, der Stellenlosigkeit, Armut und Ohnmacht geschmeckt, dahin wollte ich nicht zurück, Clare war mein Schicksal, da musste ich durch, auch wenn ich in neue Abhängigkeiten geriet. Der zu erwartende Reichtum meiner Frau lag als schwere Hypothek auf unserer Beziehung, sie wollte, als es um die Hochzeitreise ging, auch gleich mit dem Bestimmen anfangen, aber da setzte ich mich durch und machte ihr klar, wo der Hammer hängt. Ich wollte nicht nach Venedig in ein vom Krieg zerrissenes Europa, mich reizte es viel mehr, mit Runaway in der 16fach crèmefarben lackierten und geschliffenen Stoddard-Dayton-Pullman-Limousine nach Ramses zu reisen und eine herrschaftliche Suite im Hotel OCCIDENTAL zu beziehen, weil ich neugierig war, wie sie dort mit dem Gatten einer Millionenerbin umgehen würden, den sie, als er Liftjunge im Hause gewesen war, nach Strich und Faden drangsaliert hatten. Zugegeben: Ich hatte zu wenig darauf geachtet, mir nicht die falschen Freunde zuzulegen. Aber sucht man sich seine Freunde aus? Werden sie einem nicht oft durch den Zufall gleichsam zugeteilt? Ich war in dem kleinen Wirtshaus, das ich nach meiner Verstoßung aufgesucht hatte, in ein Zimmer gelegt worden mit zwei Stellenlosen, „gelegt“ ist gut, denn es war für mich gar kein Bett da, und die beiden merkten sofort, dass ich bemittelter war als sie – sie hatten keinerlei Gepäck, ich hingegen einen vollgepackten Reisekoffer. Deshalb nahmen sie mich in hinterhältiger Kameradschaftlichkeit in ihre Wandergruppe auf, ich, aller menschlichen Bindungen beraubt, war froh, nicht mehr völlig allein dazustehen, und so wurden Delamarche und Robinson meine „Freunde“, ich setze das in Anführungsstriche, denn über argwöhnische Mitmenschlichkeit hinaus ist unsere Freundschaft nie gediehen.
Die prachtvolle, ganz in weißer Schokolade gehaltene achtstöckige Hochzeitstorte von Huyler, ein wahrer Wolkenkratzer von Hochzeitstorte, wurde hereingetragen von der stärksten Frau der Welt, Sandwina. Sie wirkte dabei so unangestrengt, lächelte so entspannt, als sei die Torte aus lauter Watte. Als ich das Messer hob, um sie anzuschneiden, zerbarst sie von innen, und ihr entstieg in weißen Schlabberkleidern die unvergleichliche Clownin mit der Trompete, in die ich mich im Zirkus der Johnny L. Jones Combined Shows verguckt hatte, weil sie mich an eine Frau erinnerte, die unwiederbringlich aus meinem Leben verschwunden war. Die Hochzeitstorte lag nun in Stücken, Clare sah sich suchend nach einem Gegenstand um, den sie stemmen und ihre Kraft mit derjenigen Sandwinas messen konnte, da trat ein Diener herein und übergab Clares Vater eine Depesche. Herr Pollunder las sie, sein Gesicht verdüsterte sich, er bat um unser Gehör, alle standen auf, denn es kam, nach seiner Miene zu schließen, nichts Erfreuliches auf uns zu. Der Wortlaut war: „Die Cunard-Linie teilt mit, dass ihr Dampfschiff HMS Lusitania von einem deutschen U-Boot vor Irland torpediert worden und gesunken ist. Es sind viele Opfer zu beklagen.“ Wir standen still und ließen die Nachricht auf uns wirken. Die Lusitania war auch mein Schiff gewesen. Mit dunklen Vorahnungen dachten wir daran, dass Edmund Mack sen. mit über tausend Passagieren an Bord war. Clare war anzusehen, wie furchtbar beunruhigt sie war, Tränen quollen ihr aus den Augen, ohne dass sie das Gesicht im Geringsten verzog. Später erfuhren wir, dass über hundert Amerikaner unter den tausend Ertrunkenen waren. Die Empörung über die „boches“ und die „huns“ war allgemein, ich hätte mich am liebsten in ein Mauseloch verkrochen. Glücklicherweise brach Herr Pollunder die Hochzeitsfeierlichkeiten mit dem Ausdruck des Bedauerns ab, und Onkel Edward begleitete uns zu seinem Stoddard-Dayton. „Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen,“ prophezeite er, „die Stimmung kippt gegen Deutschland, und unser Land wird in den Krieg eingreifen. Aber hab keine Angst, Karl, dass du Soldat werden und gegen deine Landsleute kämpfen musst: Wir verladen Waffen, Munition und bald auch Soldaten, du bist unabkömmlich.“ Ich war darüber weniger glücklich, als er meinte; der Krieg hätte ein Schlupfloch aus dieser unguten Ehe werden können – aber das war nun auch verstopft! Runaway drehte bereits die Anlasserkurbel, da kam Onkel Edward noch einmal zurück. „Wirf doch mal einen Blick in die Bücher des Hotels OCCIDENTAL. Hier eine Vollmacht von mir, sie wird dir alle Türen öffnen. Ich habe den Eindruck, dass da mehr Geld als üblich verschwindet.“
Bei der Ankunft in Ramses kamen wir auch am Unternehmen 25 vorbei. Unter dem Vorwand, meinen dortigen Schreibtisch noch leeren zu müssen, ging ich hinein, begrüßte meinen Nachfolger, der mir bereitwillig die Gehaltslisten zeigt, denen ich entnahm, dass Fanny nicht wieder aufgetaucht war, auch wenn ich nicht überprüfen konnte, ob sie sich nicht unter einem der vielen neuen Namen verbarg. Auch der Verwalter war mittlerweile durch einen Nachfolger ersetzt, ich wurde von allen sehr respektvoll behandelt, da meine guten Beziehungen „nach oben“ sich herumgesprochen hatten. Ich suchte Tuesdays Mutter, aber sie war nicht mehr da. Sie habe sich geweigert, weiter für Weiße zu arbeiten, wurde ausfällig und habe ins nächste Bedlam verbracht werden müssen. Als ich mich dort meldete und sie sprechen wollte, erfuhr ich, dass die Patientin Tuesday einer Mitpatientin so routiniert bei der Geburt ihres Kindes beigestanden habe, dass man sie zur Haushebamme ernannte. Aber sprechen könne ich sie nicht, sie sei als Midwife an ein anderes Irrenhaus ausgeliehen worden. Ich sammelte meine Notizen zusammen (bis zum 14. Bogen lagen sie noch im Geheimfach), und als ich traurigen Abschied nahm von meiner Underwood, sah der neue Verwalter, wie sehr ich an ihr hing – und schenkte sie mir. Ich kehrte zu Clare zurück, die sich die Zeit in einem Drugstore bei Ginger-Ale damit vertrieben hatte, mit einem hübschen braunen Kellner anzubandeln, in dem ich Renell erkannte, aber er erkannte mich nicht. Das war mir sehr lieb, und es setzte sich im OCCIDENTAL fort, wo mir die Oberköchin zuzwinkerte, meine Identität aber nicht preisgab. Unserer Suite im sechsten Stock schämte ich mich – denn ich hätte sie mir nie leisten können – ich war jetzt Prinzgemahl, nicht die beste Voraussetzung, um mit Verve eheliche Pflichten zu erfüllen und einen Vorgänger auszustechen, der sich Clare offenbar tief ins Fleisch eingebrannt hatte. Auch Giacomo tat, als kenne er mich nicht. Aber einmal mit ihm allein im Lift, konnte ich nicht widerstehen, umarmte ihn und spürte seine Liebe.
Die Hochzeitsnacht verbrachte ich in einem Kabuff neben unserem Schlafzimmer, einer Art begehbarem Kleiderschrank. „Ich bin immer noch in Trauer um Mack,“ sagte Clare theatralisch, „respektiere das bitte, und zwinge mich nicht zu einem Verhalten, das seine Rechtfertigung nur in freiwilliger und gern gegebener Liebe findet! Oder bist Du mit einer bloßen Dienstleistung zufrieden?“ Mir war es recht, dass ich mich nicht bewähren musste, und so verbrachten wir die erste unserer Flitterwochen nach außen glücklich, in Wahrheit fast mit einander verfeindet, Clare war schon immer kapriziös gewesen, jetzt aber wurde sie auf gehässige Weise launisch, verabschiedete sich zu Spaziergängen durch die nächtliche Stadt, weil sie nicht schlafen könne. „Da hat es gerade wieder einen Überfall gegeben!“, wandte ich ein. „Dann lasse ich meinen Schmuck eben hier!“ „Es gibt Männer, die wollen etwas anderes als Schmuck!“ „Ich nehme Renell als meinen body-guard mit.“ Er war zwar eigentlich nur Liftboy, übernahm dienstfertig aber auch diese Aufgabe. Aber dann erfuhr Clare aus der Presse, dass unter den Opfern des Untergangs der Lusitania auch Mack sen. war. Sie weinte hemmungslos, dann wandte sie sich zu mir und sagte: „Du bist jetzt mein einziger Trost, Charles!“ Sie umfing mich zärtlich, hängte sich tränenüberströmt und wie erledigt an meinen Hals. Verlockungen, mit denen das Wesen nicht mitgeht. Das Auf und Zu, das Dehnen, Spitzen, Aufblühn der Lippen, als modellierten dort unsichtbare Finger.[6] Aber was blieb mir anderes übrig.
Zurück in New York von der wohl kürzesten und liebesärmsten Hochzeitsreise, hatte ich Polizei in meinem Bureau und musste mich einer Befragung stellen. Ob ich Landsleute bei der Arbeitsverteilung bevorzugte? Es sei aufgefallen, dass auch bei geringem Arbeitsaufkommen ein Arbeiter aus Pilsen in Österreich immer beschäftigt werde und nie zurückstehen müsse. Ich berief mich auf seinen besonderen Fleiß und auf seine Invalidität: Als Einäugiger fände er nirgends sonst Arbeit, ich würde auch andere Invalide, wenn sie arbeitsfähig seien, bevorzugt einsetzen. Es gebe noch einige Landsleute unter den Schauerleuten, die wohl gelegentlich darauf pochen würden, dass wir eine Muttersprache sprächen, aber das spiele für mich keine Rolle, ich sei inzwischen ein guter Amerikaner geworden und empfände keinerlei besondere Loyalität für mein Herkunftsland Österreich-Ungarn, für das Deutsche Reich schon gar nicht seit dem Untergang der Lusitania.
Am Abend rief mein Onkel mich zu sich. Bei einem Glas Cloverleaf Bonde Kentucky Rye, an dem ich misstrauisch nur nippte, erfuhr ich, dass Heinrich aus Pilsen, als er ein Ticket für die Rückkehr nach Europa lösen wollte, von Umstehenden auf Grund seines deutschen Akzents und seines Reiseziels als „Hun“ beschimpft worden war. Er habe die Beherrschung verloren und den Beleidiger niedergestochen. Onkel Edward schlug mir vor, mich anderwärts und unter dem anglisierten Namen Charles Rider einzusetzen. Ein deutscher Name sei momentan nicht nur nicht von Vorteil in den Vereinigten Staaten, sondern förmlich eine Belastung. Ob die Namensänderung so ohne weiteres möglich sei, wollte ich wissen, er nippte an seinem Whiskey, nickte und sagte, er habe sich ja seinerzeit auch umbenannt; wenn feststehe, dass man mit der Umbenennung keine unredlichen Absichten verfolge (dafür werde vor allem geprüft, ob man schuldenfrei sei), stehe ihr nichts im Weg, es bedürfe nur des Gangs zum Bezirksbureau. Ob er mir schon erzählt habe, wie er von Brunelda mit meinem Namen erschreckt worden sei. Er habe sich ganz der Lust in ihrem Armen überlassen, da flüsterte sie ihm plötzlich leise „Karl Rossmann“ ins Ohr, er habe gestutzt und sie fragend angeschaut, da habe sie meinen Namen wiederholt und an seinem Stutzen bemerkt, dass er ihn kannte. „Du bist der Onkel von Karl Rossmann!“, habe sie lachend gesagt und so sein Inkognito gelüftet. Er sei natürlich neugierig gewesen und habe die ganze Geschichte, wie Delamarche mich zu ihr gebracht und wie ich durch gelegentliche Bemerkungen angedeutet hätte, dass mein Onkel in New York mehrere Lagerhäuser am Hafen besitze, mit denen ja auch er, Edward, unklugerweise und im Vertrauen auf die Unerkennbarkeit seiner Identität gelegentlich geprahlt habe. Die Erinnerung an Brunelda trieb ihm Tränen in die Augen, ich wagte ihn zu fragen, ob er sie geliebt habe. „O ja, ich habe sie geliebt wie das Meer,“ erwiderte er. „In ihr zu versinken, zu ertrinken, sie war das weiblichste aller Weiber, war unsäglich erlösend. Und ich hatte doch schon für die Sängerin, die sie einmal war, geschwärmt: Keine sang Bellinis ‚Casta diva‘ wie sie – am Busen dieser Göttin zu liegen – ihre Kehle zu küssen, ihr süßes Lispeln zu hören: ‚Freundchen, ergieße dich!‘ – Ihr Tod hat mich mehr getroffen als der meiner eigenen Mutter … Aber Delamarche hat das verdiente Geschick ereilt. Er wurde vom Geschworenengericht Ramses zum Tod durch den Strang verurteilt. Ich lasse es mir nicht nehmen, seiner Hinrichtung beizuwohnen.“ Ich schauderte und wechselte das Thema: „Wo soll ich inskünftig arbeiten?“ Das sei noch nicht entschieden, sagte der Onkel, ob ich selbst keine Wünsche hätte? Darüber hatte ich nicht nachgedacht, aber plötzlich durchfuhr es mich wie ein Blitz: „Kann ich nicht als Buchhalter für die Johnny L. Jones Combined Shows tätig werden? An dem Zirkus besitzt dein Freund Pollunder, mein Schwiegervater, doch Anteile!“ Er nickte lächelnd, und ich ergänzte: „Aber nur unter der Bedingung, dass niemand erfährt, dass ich mit dir verwandt bin. Ich schäme mich unserer Verwandtschaft keineswegs, ja, ich bin stolz, dass du nicht gezögert hast, Brunelda mit eindrücklichen Worten zu würdigen, aber wenn man weiß, wer ich bin, verschwimmt ehrliche Anerkennung meiner Arbeit mit schmeicheldem Opportunismus, und ich möchte alles meiner eigenen Tüchtigkeit verdanken. Außerdem aber kann ich tun, was ich schon im OCCIDENTAL zu deiner Zufriedenheit getan habe: In die Bücher schauen und Pollunder über Unregelmäßigkeiten Bericht geben.“ Er nickte gedankenvoll und versprach, seinen Freund darauf anzusprechen. Das zarte Pflänzchen unserer Freundschaft wurde durch dieses Gespräch nicht wenig gekräftigt.
So ist aus Karl Rossmann also Charles Rider geworden, weder Amerikaner, noch Deutscher, gar nicht zu reden von Österreicher oder Tscheche, auch weder Katholik noch Protestant, weder Jude noch Atheist. Ich bin mit Clare, die in Umständen ist, von New York nach Clearwater gezogen, wo der Zirkus überwintert, arbeite hier in der Buchhaltung und koordiniere die an alle Orte der Tournee ausgesandten Werbetruppen. Clare versucht nach Kräften, mir eine gute Frau, ich ihr ein guter Mann zu sein. Wir lieben einander nicht, versuchen aber, aus den Gegebenheiten das Beste zu machen; die Ehe verlangt ein Hinauswachsen über die Natur. Unsere Wohnung im Hotel Belleview ist fast zu schön für einen einfachen Buchhalter und führt zu Gerede unter den Kollegen: „Wie kann er sich das leisten?“ Unsere Bleibe gehört Mr. Biltmore, einem Freund Pollunders. Das Zirkusbüro hingegen ist recht bescheiden in einem fünfstöckigen Holzhaus untergebracht, dessen Wirtin sehr um mein Wohlergehen und das der anderen Mieter und Mieterinnen bemüht ist. Heute Morgen hatte ich schon gute sechs Stunden gearbeitet und erwog, einen Weg zu den Pferden und Elefanten zu machen, um mich zu erfrischen.
Ich betrat das Zimmer der Nachbarin, das so zierlich und behaglich möbliert und eingerichtet war, dass ich den Wein, den mir die Gehülfin hinstellte, sofort trank und kurz darauf einschlief. Ich träumte, ich rüttele erneut an meiner Tür und könne sie nicht öffnen, es war aber die Tür eines Stalles, die von einer alten Frau mit tiefen Runzeln bewacht wurde. Sie kam mit erhobenem Stock auf mich zu, ich war wie festgebannt und konnte mich nicht rühren, zuckte zusammen und erwachte, als sie zuschlug: Und sah Fanny vor mir, die mir besorgt und lächelnd in die Augen schaute. Sie war schlank und elegant in ein tailliertes, schwarzes Kostüm gekleidet, und ihr Lächeln war spöttisch und ein wenig ironisch und mitleidig wie ehedem. „Mein armer Charles,“ sagte sie und streichelte mir die glattrasierte Wange. „Was hat dich nur hierher geführt?“ Ich erzählte ihr, wie der Onkel mich wieder bei sich aufgenommen und zuerst als Tallyman am Hafen eingesetzt hatte, es nach dem Untergang der Lusitania aber für ratsam gehalten hatte, dass ich meinen Namen und Arbeitsplatz wechselte. „Den Job als Buchhalter beim Zirkus habe ich mir ausgesucht, weil ich dich im Clownskostüm erkannt zu haben glaubte, aber ich habe nicht gewagt dich anzusprechen, als du auf meiner Hochzeit warst. Und du, warum hast du nichts gesagt?“ „Ich wollte dir verstohlen die Hand drücken, aber dann kam die Nachricht von der Torpedierung des Schiffes.“ „Ich freue mich sehr, dich wieder gefunden zu haben, Clare ist in Umständen.“ „Das sind ja schöne Neuigkeiten,“ sagte Fanny, offenbar wirklich gerührt. „Ich war auch verheiratet, und zwar mit Johnny, dem Direktor der Johnny L. Jones Combined Shows, er hat sich zu Tode getrunken, aber auch ich bin eine Gezeichnete.“ „Was machst du im Zirkus jetzt – immer noch Clownin?“ Sie schüttelte traurig den Kopf. „Nein, es lachte niemand mehr über meine misstönende Trompete, ich arbeite auch wieder im Bureau und bereite die Tourneen vor, an über zwanzig Orten gastieren wir im kommenden Jahr, aber es kann sich noch alles zerschlagen, denn es ist herausgekommen, dass Deutschland versucht hat, Mexiko zum Krieg gegen uns aufzuhetzen, und darauf kann es nur eine Antwort geben. Dann aber würde die Hälfte unseres Personals an die europäische Front verschwinden, wir müssen reduzieren und nochmals reduzieren, und auch dem Publikum wird nicht nach Zirkuszerstreuungen zumute sein.“ „Und warum bist du eine Gezeichnete?“ „Ich habe ein Wundermittel aus Deutschland genommen, das mich kurzfristig geheilt hat, langfristig aber töten wird.“ „Gibt es denn noch Handel mit Deutschland?“ „Ein geheimes U-Boot soll es geliefert haben.“
Ich werde von einem Boy in die Präsidentensuite gerufen. Was will man dort von mir? Was habe ich falsch gemacht? Hätte ich mit Fanny nicht sprechen dürfen? Ein altes Kalenderbild fiel mir ein: Unter dem Bett seiner nackten Geliebten liegt der Liebhaber mit Schwert. Aber der Heimkommende ist nicht der Ehemann, sondern ein klappriges Skelett, das drohend die Sanduhr hebt. Ja, ich war noch immer in Fanny verliebt, und sie war eine Gezeichnete. Das Wundermittel, das sie geheilt hatte, enthielt Arsen und würde sie töten. Hatte ich nicht allen Grund, sie meiner fortbestehenden Leidenschaft zu versichern? Unter diesen Gedanken hatte ich das federnde Lift betreten und wurde in den obersten Stock emporgeschnellt. Was erwartete mich? Nichts weniger als – ein Gespräch mit Onkel Edward. Er war aus einem Grund zu Besuch gekommen, den er mir nicht verriet. Er begrüßte mich mit Umarmung, und ein Messerstich in meinen Rücken blieb aus. Er erkundigte sich nach meiner Arbeit und sagte, Pollunder sei sehr zufrieden mit mir und meinen Berichten über Scheinbuchungen. Dann führte er mich in den Raum nebenan. Dort saß ein in elegantes Grau gekleideter Herr mit Zwicker, durch den er mich leuchtend vor vereinnahmendem Wohlwollen ansah. Ich wurde ihm vorgestellt, er aber nicht mir, was mir nicht gefiel. Hätte ich ihn kennen müssen? Mir wurde eingeschenkt, ich glaube, es war Onkel Edwards Lieblingswhiskey Cloverleaf Bonde Kentucky Rye. Onkel Edward und der Zwicker, ich nenne ihn mal so, weil ich seinen wirklichen Namen nicht weiß, sprachen über Vor- und Nachteile eines Kriegseintritt gegen die „huns“. Urplötzlich brach es aus mir heraus: Amerikaner hätten kein Recht, uns Deutsche als „huns“ herabzusetzen; sie selbst gingen gegen einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Bevölkerung mit barbarischen Mitteln vor. So sei mein Freund Tuesday spurlos verschwunden seit dem Mord an einer Prostituierten, der ihm zur Last gelegt worden sei, aber ein Gerichtsverfahren habe er nie bekommen, sondern sei in eine Menge lynchlüsterner Männer entlassen worden. Der Zwicker sah meinen Onkel triumphierend an. „Ihr Neffe hat noch Einiges zu lernen,“ sagte er trocken. „Wie stehst du zum Kriegseintritt der Staaten?“ Die Frage meines Onkels klang so gelassen, als ginge es um ein Gericht auf der Speisekarte. „Ich würde ihn missbilligen,“ sagte ich, vom Whiskey aufgebracht. „Viele prachtvolle junge Männer würden den Tod finden für nichts und wieder nichts.“ Wieder sah der Zwicker meinen Onkel triumphierend an; offenbar hatte er mein Urteil vorausgesagt. Er wandte sich jetzt direkt an mich: „Was sagst du zu dem Versuch Deutschlands, Mexiko zum Krieg gegen uns aufzuhetzen?“ „Darf Deutschland nicht seine Interessen verfolgen wie jedes Land? Solange hier weißverkleidete Schlächter gegen die schwarze Minderheit vorgehen und Abraham Lincoln sich im Grabe umdreht, habe ich mit den Staaten keinerlei Mitleid.“ Ich musste auf die Toilette, mich übergeben. Wem ich da vorgeführt wurde, weiß ich bis heute nicht. Der Zwicker war verschwunden, als ich zurückkehrte. „Es ist gut, dass dir schlecht wurde,“ sagte Onkel Edward später. „Du hattest genug Unfug geredet. Aber du hast meinen Freund in seinem Entschluss bestärkt!“
Delamarche war hingerichtet worden, und Onkel Edward hatte der Hinrichtung nicht nur beigewohnt, sondern an ihr teilgenommen. „Wie das?“, fragte ich und er erklärte es mir geduldig. „Als ich zum vereinbarten Termin in der Haftanstalt von Ramses eintraf, mussten wir – es waren noch andere gekommen – warten und wurden mehrfach vertröstet: Wir sollten uns in Geduld fassen, es gebe organisatorische Probleme. Dann wollte man uns nach Hause schicken, weil einer der drei erforderlichen Scharfrichter fehle. Es hätten sich nur zwei gemeldet, aber der dritte sei dringend erforderlich, und man könne niemanden dazu verpflichten, die Teilnahme sei absolut freiwillig. Mehrere Besucher boten sich als Ersatz an, auch ich, obgleich ich nicht wusste, was auf mich zukam. Ich weiß nicht, warum sie mich aussuchten, aber sie haben es getan. Ich musste mich mit den beiden anderen nur an einen Tisch setzen, über den drei Fäden liefen, und auf Kommando mussten wir jeder seinen Faden mit einem scharfen Messer zerschneiden. So habe ich nun vielleicht den Tod Delamarches auf meinem Gewissen, vielleicht aber auch nicht.“ Ich staunte und ließ mir den Mechanismus von Onkel Edward erklären. „An den drei Fäden hingen drei Kugeln, zwei aus Holz, eine tödliche aus Eisen. An welchem Faden welche Kugel hing, war unerkennbar und unbekannt. Die vernichtende Eisenkugel aber hängt über eine Rolle am Strick, der dem Delinquenten um den Hals liegt. Fällt sie herab, so wird er emporgerissen und stirbt binnen weniger Sekunden durch Genickbruch und Ersticken. Aber es belastet mich nicht, ja, ich wünsche mir, zufällig den entscheidenden Faden durchschnitten zu haben. Als Mörder Bruneldas hatte er den Tod verdient, und ich freue mich, der Toten vielleicht einen letzten Dienst erwiesen zu haben.“ Sein Gesichtsdausdruck war bekümmert und treuherzig, als er das sagte – und ich fragte mich, ob er mit demselben Gesichtsausdruck auch mich, den lästigen Mitwisser seiner intimsten Geheimnisse, eines Tages um die Ecke bringen wird.
Wenige Tage später kam es zum Kriegseintritt, die jungen Männer strömten zu den Waffen, meine für den Hafen geltende Unabkömmlichstellung galt auch in Clearwater, ich war wieder ein Weder-Noch, kein richtiger Amerikaner und kein richtiger Deutscher, hin und hergerissen zwischen der Freude, nicht gegen Landsleute kämpfen zu müssen, und dem Wunsch, mich als amerikanischer GI zu bewähren. Und in noch einer Hinsicht war ich ein Weder-Noch: Weder liebte ich Clare, noch konnte ich mich zu Fanny bekennen, weder wollte ich dem Druck von Clares Schwangerschaft noch demjenigen von Fannys bevorstehendem Tod nachgeben. Es soll ja Männer geben, die nicht nur nichts dabei finden, ihrer schwangeren Frau beizuwohnen, sondern es auch als besonders reizvoll genießen; das kann ich nicht verstehen, in der werdenden Mutter keimt eine neue menschliche Existenz, diesem Wunder muss man mit Respekt, ja mit Verehrung begegnen. Ich bin sicher, Clare hätte Annäherungsversuche meinerseits schaudernd zurückgewiesen – aber sie fanden nicht statt. Wäre es nicht legitim gewesen, bei einer anderen Frau zu suchen, was ich bei Clare nicht mehr zu suchen wagte? Wie viele brave Ehemänner finden Trost bei einer Hure, wenn ihre Frau in Umständen ist! Und meine Hure wäre eine alte Freundin gewesen, der ich mit Haut und Haar in Dankbarkeit ergeben war, die zudem noch unter der Drohung eines qualvollen Arsentods stand und mich oft so flehentlich ansah – sie wollte von mir erkannt werden – um es in der Sprache der Bibel auszudrücken. Aber ist die Liebesvereinigung wirklich ein Erkennen? Ist sie nicht vielmehr die naturgewollte Verschmelzung zweier skrupelloser Egoismen? Erkennt der Elefantenbulle Maharadscha die Kuh Maharani, wenn er sie besteigt? Gestern beobachtete ich diesen Vorgang und war erschüttert – von seiner furchtbaren Zweckmäßigkeit.
Im Juli 1917 war Clare eine wahrhaft erhabene Erscheinung. Wie ein Schiff segelte sie im rotgeblümten indischen Flatterkleid durch unsere Suite im Hotel Belleview, stand auf der Terrasse und verfolgte interessiert das Ballett der schwarzen Schwalben: „Wie schnell sie sind – und wie wendig!“, sagte sie wehmütig, ihrer eigenen Schwerfälligkeit überdrüssig. Die Hebamme, die uns betreute, machte Clare Angst; sie sprach immer wieder von der ungünstigen Lage unseres Kindes und erwähnte, dass sie schon viele Frauen bei der Geburt qualvoll habe sterben sehen. Ich fuhr nach Ramses, suchte und fand Tuesdays Mutter. Sie war völlig verändert, denn eine Feldpostkarte hatte sie erreicht – von ihrem geliebten Sohn, der in Nancy in Frankreich stand und zum Sanitäter ausgebildet wurde. Ich konnte es kaum glauben, aber sie zeigte mir die Karte mit den ungelenken Druckschriftbuchstaben meines Freundes. Es war nicht leicht, sie aus Ramses wegzulocken, ich versuchte es mit Geld, aber das war wirkungslos, sie wollte einfach die Frauen nicht im Stich lassen, für sie verantwortlich war. Aber dann ließ ich mir von ihr einen Brief an Tuesdays Feldpostadresse diktieren, und die Aussicht, über mich mit ihm in Kontakt zu bleiben, ließ sie ihre wenigen Sachen packen, darunter ein Hörrohr, dass sie in Clearwater sofort auf Clares enorm gerundeten Bauch setzte, nach ein paar Minuten lächelte und sagte: „Alles in Ordnung, dem Herrn sei Dank!“ Und dann fing sie an, einen Gospel auf ihren „Lord“ zu singen, ich schaute Clare fragend an, aber sie lächelte dankbar und genoss den Gesang der Alten, als ob sie schon ihre Amme und Kinderfrau wäre.
Ich war wieder in New York am Hafen und nahm meine Arbeit da wieder auf, wo ich sie niedergelegt hatte. Onkel Edward hatte es so verfügt, weil fähige Tallymen rar waren. Von meinen früheren Arbeitern waren nur die Alten und Schwachen übrig geblieben, die anderen weilten oder kämpften sämtlich in Frankreich, und wir luden keine Sachen mehr aus, sondern nur noch Waffen und Gerät ein. Es waren Riesenmotoren darunter, wir wunderten uns, wozu sie dienen sollten, fragten aber nicht, denn unsere Tätigkeit stand unter Geheimhaltung, und es war besser, nichts zu wissen, dann konnten wir auch nichts ausplaudern. Müde heimgehend, konnte ich einmal einer Frau nicht widerstehen, deren Arm plötzlich so zutraulich, aber auch heischend unter meinem gewesen war. Willenlos ließ ich mich von ihr abführen. An der Wand ihres Zimmers hing eine Karte der Körperzonen einer Frau und wieviel deren jeweilige Benutzung kostete, ähnlich den Bildern, auf denen die Partien eines Schlachttiers benannt werden: Lende, Hüftdeckel und Steak. Als es ans Bezahlen ging, musste ich feststellen, dass ich teure Vorlieben besaß, aber zum Glück war ich nicht arm, und noch heute träume ich manchmal von mattbraunen Hügeln, bewachsen mit zartem Flaum, die mir ins Gesicht schwellen. Ich sah sie nachdenklich an, als ich mich anzog, und sie fing von selbst an zu reden; ihr Mann sei Korporal, jetzt bei einer Einheit in Frankreich, und er habe sie schon hier betrogen und werde es auch in Frankreich tun, wo man doch wisse, wie leichtfertig die Französinnen seien, aber er schreibe ihr regelmäßig, erkundige sich nach den beiden Kindern und schwärme von den Tanks, die in Frankreich zusammengebaut würden, nur die Motoren kämen aus den Staaten, und gedeckt durch diese Tanks könnten die „huns“ ihn nichts anhaben. Ich bin der Korporalsfrau sehr dankbar, denn sie hat mir einen Johnny übergezogen, und so kann ich hoffen, einer Kur durch das teuflische Salvarsan nicht zu bedürfen.
Clearwater schwieg. Vergeblich hatte ich versucht, den Onkel umzustimmen, dass ich bis zur Geburt unseres Kindes bleiben könnte. Nein, er brauche mich sofort. Also war ich gefahren, und es beruhigte mich, Clare in Mutter Tuesdays Obhut zu wissen. Der vorausgesagte Geburtstermin verstrich – nichts. Ich rief an und hörte, dass Clare nicht zu sprechen sei, sie fühle sich sehr elend. Ob das Kind da sei. Ja, es sei da, aber kurz nach der Geburt verstorben. Ich verlangte, Tuesdays Mutter zu sprechen. Aber sie blieb am Telefon fast stumm, murmelte nur etwas wie: „Er ist beim Herrn!“, und stimmte wieder den Gospel auf ihren „Lord“ an. Obgleich ich Clare nicht liebte, tat sie mir doch leid, all die Mühsal der Schwangerschaft war umsonst gewesen, und auch ich hatte auf das Kind gehofft, war es doch mit liebloser Liebe teuer erkauft und hätte der Zwangsgemeinschaft von Clare und mir Festigkeit und einen Sinn verleihen können. Ich wollte nach Clearwater, um Clare zu trösten und nach New York zu holen, aber wenn ich mein Motiv genau untersuchte, wollte ich vor allem Fanny wiedersehen und war deshalb froh, als der Onkel es mir verbot mit den harschen Worten: „Was willst du dort? Das Kind ist tot, und dein Kommen erweckt es nicht wieder zum Leben.“ Also blieb ich, verlud mit meinen Leuten weiter die riesigen Motoren, sah weder Clare noch Fanny und schon gar nicht meinen toten Sohn, der wohl anonym auf irgendeinem Friedhof verscharrt worden war.
Ich erhielt einen Brief von Therese Berchtold, der Sekretärin der Oberköchin, mit der ich im OCCIDENTAL befreundet gewesen war. Er hatte folgenden Wortlaut:
Lieber Karl,
so nenne ich Dich weiterhin, obgleich ich weiß, dass Du Dich umbenannt hast in Charles, aber in dieser englischen Form will mir der Name nicht über die Lippen und in die Maschine. Ahnungs- und kenntnislos, wie ich bin, habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich bin auf die Liebedienerei Renells hereingefallen, er nannte mich seine „süße Pomeranze“, und das Einzige, was mich tröstet, ist, dass ich nicht die erste und sicherlich auch nicht die letzte Dumme bin. Er hat mich geschwängert und dann behauptet, das Kind sei nicht von ihm. Er redet kein Wort mehr mit mir, und ich möchte hier weg, um ihm nicht täglich erneut über den Weg zu laufen. Wüsstest Du nicht eine Position für mich? Ich kann Deutsch, Englisch und habe mir durch Renell, der zeitweise in Neapel lebte, auch Italienisch in den Grundzügen angeeignet. Deine Adresse habe ich von der Oberköchin, die auf Deiner Hochzeit war und noch heute davon schwärmt, was für ein schönes Brautpaar Ihr wart. Ich will Dir aber auch nicht verschweigen, dass Renell sich in der Zeit, als wir noch mit einander sprachen, gerühmt hat, er habe auch Clare „gehabt“, die sich ihm förmlich an den Hals geworfen und gesagt habe, dass sie Dich hasst. Mag das nun wahr sein oder auch nicht, als selbst gebranntes Kind wollte ich es Dir gesagt haben. Bitte erinnere Dich unserer Freundschaft und hole mich nach New York! Deine Therese
Es rührte mich, dass Therese sich meiner erinnerte, und es belustigte mich zu denken, dass ich damals, als ich mich auf Renell als Clares body-guard verließ, den Bock zum Gärtner gemacht hatte. Aber war es nicht auch möglich, dass er einer dieser Aufschneider war, die so gut wie jede Frau, die ihren Weg kreuzt, erobert haben wollen? Und es tröstete mich fast, dass der „stillgeborene“ Sohn (wie man hier sagt) vielleicht gar nicht von mir war.
Es war ein sehr herzliches Wiedersehen, als ich Therese in New York empfing und sie in ihre Arbeit als meine Sekretärin im Kontor der Lagerhäuser einwies. Der Onkel hatte eingesehen, dass ich überfordert war, die Verladungen zu beaufsichtigen und zugleich alles zu organisieren und darüber Buch zu führen, und hatte mir die Hilfskraft bewilligt. Da sie im fünften Monat war, kam es ihr sehr gelegen, dass sie sich keine Wohnung suchen musste, sondern wie im OCCIDENTAL ein Zimmerchen in meinem ohnehin viel zu großen Flat beziehen konnte. Durch diese Nähe konnte sie mir abends noch mancherlei erzählen, was Renell und sie betraf. Am tiefsten habe es sie verletzt, dass er, als sie ihm ihre Schwangerschaft mitteilte, empört sagte: „Warum habe ich mich nur auf eine simple Schreibmaschinistin eingelassen? Provozieren mich nicht eleganteste Damen in den oberen Suiten täglich mit Klagen über ihre Einsamkeit? Ich hätte mir gleich denken können, dass du versuchen würdest, mich durch eine Schwangerschaft hereinzulegen, die, wenn sie nicht nur vorgetäuscht ist, sicherlich einen anderen Vater hat! Aber da bist du an den Falschen geraten!“ „Es stimmt,“ sagte Therese unter Tränen, „eine elegante Dame bin ich nicht, sondern nur eine simple und auch noch unausgebildete Schreibmaschinistin!“ Ich legte beruhigend meine Hand auf ihren Arm, aber sie weinte nur noch mehr. Und im Laufe der Zeit trat für mich das Kind, das sie erwartete, an die Stelle dessen, das Clare und ich verloren hatten. Warum bedarf es immer der Verzweiflung, damit wir Erlösung finden? Ist beides dasselbe? Aber schon in der Nacht von Thereses Ankunft hatte ich, als sie zu Bett ging, beim Anblick ihrer zierlichen, sich deutlich rundenden Gestalt plötzlich die Eingebung, dass sie ein farbiges Kind gebären würde und dass auch das Kind Clares farbig war und dass es als beschämender und unwiderleglicher Beweis ihrer Untreue hatte sterben müssen. Allein Mutter Tuesday konnte mir Gewissheit verschaffen. Und dass es an der Zeit war, zu handeln, wurde mir klar, als Mr. Pollunder mich besuchte und mir bei einem Glas Cloverleaf Bonde Kentucky Rye mit allen Anzeichen des Bedauerns mitteilte, seine Tochter habe bei Gericht den Antrag auf Ehescheidung eingereicht. Grund: abandonment (Vernachlässigung).
Der europäische Kriegsschauplatz erschütterte uns einerseits mit Sieges-, andererseits mit Schreckensmeldungen, wobei sich beides auch manchmal überschnitt, weil der Preis eines Sieges oft genug eschrecklich war. Ich träumte, ich sei Soldat und müsse eine steile Anhöhe hinaufkraxeln. Ich erwartete oben eine Straße oder einen Weg. Aber es war nur ein Grat oder First und ging auf der anderen Seite ebenso steil hinab. Es ist klarer als irgendetwas sonst, dass ich, von rechts und links von übermächtigen Feinden angegriffen, weder nach rechts noch links ausweichen kann, nur vorwärts, hungriges Tier, führt der Weg zur essbaren Nahrung, atembaren Luft, freiem Leben, sei es auch hinter dem Leben.[8] Von Sanitätern höre ich, dass sie von verwundeten Feinden zurückgewiesen werden, weil sie farbig sind, ja, von einem hörte ich, dass ein verletzter Deutscher, der „Wasser! Wasser!“ gerufen hatte, mit dem Messer auf ihn einstach, als er ihm die Flasche reichte. Ob Tuesday Derartiges auch zu berichten hätte? Vielleicht hatte seine Mutter Post von ihm – ein weiter Grund, nach ihr zu suchen, denn aus Clearwater war sie verschwunden, da Clare, die zu ihrem Vater zurückgezogen war, keine Verwendung mehr für sie hatte. Aber wir, Therese und ich, hatten Verwendung für sie!
Therese machte mich auf eine Anzeige in der Times aufmerksam:
Bleachery Jonathan
Bei uns wird nicht die Wäsche weiß, sondern der ganze Mensch! Erfüllen Sie sich einen Traum, lassen Sie sich bleichen! Sind Sie schwarz? Braun? Rot? Gelb? Dann sind wir Ihre Adresse! Nur als Weißer sind Sie vollwertig! Modernste Technik aus Deutschland! Viele Betten! Beste Verköstigung und Pflege! Angemessenes Honorar! Rabatt für Arbeitslose, Kinder und Alte! Kommt zu uns alle, die ihr mühselig und beladen seid!
Bleachery Jonathan
21 St. John`s Lane New Orleans LA tel. 3244
„Wenn das wirklich funktioniert,“ sagte sie, „dann lass ich mein Baby da bleichen. Schau dir mal diese Abbildung an: Vorher – nachher … Von Kohlrabenschwarz zu Lilienweiß! Was hältst du davon? Warum ein Kind mit der Last einer falschen Hautfarbe in die Welt schicken?“ Ich war skeptisch. „Es ist nicht nur die Hautfarbe,“ sagte ich. „Ein gebleichter Farbiger sieht immer noch aus wie ein Farbiger, er sieht aus wie ein Albino seiner Rasse. Mundpartie, Haarkräuselung, Kopf-, Nasen- und Augenform … Und womöglich wird man gebleichte Farbige noch schlechter behandeln als ungebleichte, wird sie als Betrüger bezeichnen, zumal ihre Kinder doch sicherlich auch wieder farbig werden. Nein. Davon halte ich nichts“. „Aber ansehen sollte man es sich,“ beharrte sie. „Meine Cousine Helen in New Orleans lädt mich schon seit Jahren ein, ich soll sie besuchen und Mardi Gras mit ihr feiern …“ Wir schauten auf den Kalender. Karneval war in diesem Jahr passend zu meinen Urlaubsplänen, also sagte ich zu, obgleich ich mir nicht vorstellen konnte, dass der Mardi Gras sehenswert sein würde; denn der Krieg dauerte an – die „huns“ waren zäher als gedacht. Ich machte mir nur Sorgen um Therese, die zum Zeitpunkt der Reise im achten Monat sein würde. Aber es bedrückte sie zu sehr, ein Mulattenkind auf die Welt zu bringen, sie wollte die „bleachery“ unbedingt in Augenschein nehmen, weil sie als gute Mutter eine Chancenverbesserung für ihr Kind auf jeden Fall wahrnehmen wollte. Es gebe jetzt nicht nur immer schnellere Automobile, sondern auch Flugzeuge, die sogar im Krieg eingesetzt würden, und Nachrichten könnten auf elektrischen Wellen nicht nur per Draht, sondern auch durch die Luft vermittelt werden – warum solle der allgegenwärtige Fortschritt nicht auch die Rassenfrage überwinden, indem ein Mittel gefunden wurde, die Vielfarbigkeit der Menschheit zu vereinheitlichen? Und alle ins Tintenfass der Schwärze zu stecken (wie es im „Struwwelpeter“ getan wurde, an den ich mich erinnerte) wäre grausam gewesen.
Onkel Edward war nicht sonderlich erbaut, als er von meinen Reiseplänen erfuhr, aber es genügte, dass ich ihn an den Todestag Bruneldas in zwei Wochen erinnerte, um ihn zum Einlenken zu bewegen. „Lieber Charles,“ sagte er zugleich freundlich und drohend, „ich hoffe, dass du weiterhin ein loyaler Mitarbeiter der Edward Jacob, Haul and Storing Company bist. Denn dieses Land unterhält Heerscharen käuflicher Weiblichkeit, ist offiziell aber von geradezu viktorianischer Prüderie.“ Was hätte ich darauf erwidern sollen? Selbst ein markiges „Selbstverständlich!“ hätte gelogen sein können, und die Rückfrage „Wie kannst du daran zweifeln?“ hätte frech geklungen; deshalb nickte ich nur stumm und schlug die Augen nieder. Als Ziel der Reise gab ich den Mardi Gras in New Orleans an, aber das war nicht sehr klug; Onkel Edward sagte: „Denk dir was Besseres aus! Mardi Gras ist für die Dauer des Krieges abgesagt.“ Zum Glück fiel mir Sarah ein und ich behauptete einfach, sie habe uns zur Taufe ihres Sohnes eingeladen. „Ist das Kind Thereses von dir?“ wollte der Onkel noch wissen. Das bejahte ich kühn und sagte: „Der Tod von Clares Kind war, nachdem sie die Scheidung beantragt hatte, anders nicht zu verkraften.“ Ich hatte gehofft, er würde mir den Stoddard Dayton für unsere Fahrt nach New Orleans anbieten, aber das unterblieb, und so erwarb ich einen gebrauchten Ford T, den uns Runaway wieder auf Vordermann brachte. Ich wollte ihn als Chauffeur anheuern, aber: „Ich muss einrücken,“ sagte er traurig. „Mein Vetter Homer ist für euch der richtige, er ist zwar erst fünfzehn, fährt aber wie ein Teufel.“ Homer stellte sich bei mir vor. Er war noch dunkler als Runaway. Er fuhr wirklich wie ein Teufel, vermochte aber so hinreißend zu lachen (er fiel beim Lachen in ein hohes Kichern), dass wir ihn richtig lieb gewannen, und auch wenn Therese manchmal befürchtete, die Schlaglöcher, durch die wir bretterten, könnten eine Frühgeburt auslösen, es geschah nicht, und wir kamen in der Blechliesel gut und trotz strömenden Regens einigermaßen trocken bei Sarah an.
Sarah lebt in einem Haus, das auf senkrechten und schrägen Beinen steht, um bei Überschwemmungen, die nicht selten sind, geschützt zu sein; es ist einer Spinne nicht unähnlich. Wir mussten auf einer Leiter ins Wohnzimmer hinaufsteigen, und Therese wurde von einer Schar Kinder mit Freudengeschrei begrüßt, während ich kaum Beachtung fand. Sarah bedauerte, dass der Mardi Gras wegen des Krieges nicht stattfinde, und wollte wissen, was wir an seiner Stelle sehen wollten. Ich schlug die französische Oper vor, in der gerade „Die Hugenotten“ von Meyerbeer gespielt wurde, beim gemeinsamen Essen zog Therese aber die Anzeige aus der Times aus der Tasche und fragte Sarah, ob sie von der Bleachery Jonathan schon gehört habe. O ja, die sei Stadtgespräch, und es hätten schon viele ihren Obolus entrichtet, um sich bleichen zu lassen, aber Dr. Jonathan, der Hautarzt, bestehe darauf, dass erfolgreich Gebleichte in anderen Gegenden und Städten ein neues Leben anfingen, weshalb sie nach der durchaus nicht ganz schmerzfreien Prozedur sofort mit geänderten Papieren fortgeschafft würden. Sie selbst habe noch nie einen Gebleichten zu Gesicht bekommen, und Weiße hätten zur Bleachery auch keinen Zutritt. Wir berieten, was zu machen sei. Homer war unsere Rettung. Er musste sich als Bleichwilliger einführen und darauf bestehen, dass wir ihn begleiten durften. Wir bekamen noch Karten für die „Hugenotten“, weil viele Abonnenten in Europa Soldat waren und ihre Strohwitwen die Tickets zurückgegeben hatten, und erlebten einen herrlichen Opernabend mit Valida Castelli als Marguerite, Königin von Navarra. Die Castelli soll ein mit Kopfstimme singender Mann sein, der sich so dem Militärdienst in seiner Heimat entzieht. Wie klug! Bei ihrer Auftrittsarie „Oh beau pays de la Touraine“ schlich sich die Hand Thereses leise in die meine, und ich drückte sie fest.
Tags darauf schon mussten wir uns im „queuing up“ üben, denn der Andrang vor dem unscheinbaren Gebäude, an dem nur ein schlichtes Messingschild hing, war enorm: „Dr. med. Jeremy Jonathan, Dermatologist, Modern Therapies“. Therese und ich waren die einzigen Weißen in der Schlange und wurden von der einlassenden Dame auch prompt zurückgewiesen. „Gibt es keine Beratung für Mütter, die ein farbiges Kind erwarten?“, fragte ich mit Blick auf Homer. Wir hatten uns geeinigt, ihn zum Vater des Kindes zu erklären. Aber nur er und Therese bekamen einen Passierschein. Ich verbrachte die Zeit mit Zeitungslektüre in einer Bar bei einem Bol Milchkaffee und einer pludrigen Brioche. Die Presse stimmte unisono ein Heldenlied an auf die bravouröse Tapferkeit unserer Soldaten und die technische Überlegenheit unserer Tanks in der Schlacht von Cambrai, aber ich war weder auf dieser, noch auf der Seite der „huns“, ich schauderte bei der Vorstellung, egal auf welcher Seite selbst in eine solche Blutmühle zu geraten. Als Therese mit Homer zurückkam, beschrieb sie ausführlich den Saal von drei Dutzend Betten, auf denen die Patienten lagen und im Schein eines Strahlers langsam gedreht und gebleicht wurden. Alles war in Weiß gehalten, schwarze Schwestern gingen mit Erfrischungen von Bett zu Bett, und in der Mitte des Saals spielten schwarze Musiker auf Klavier, Geige und Banjo einen Schwindel erregenden ragtime. Vereinzeltes Stöhnen und Klagen sei zu hören gewesen, aber den Verursachern sei zu trinken gereicht worden, und sogleich verstummten sie. Kinder habe sie keine gesehen, sagte Therese, aber man habe ihr gesagt, dass auch Säuglinge gebleicht würden, wenn beide Eltern damit einverstanden seien. Sie habe sich aber überlegt, dass sie ihr Kind nur hierher geben wolle, wenn sie einmal ein gebleichtes Kleinkind, dem es gut geht, gesehen hätte. Ihr sei es unheimlich, dass keine Gebleichten vorgezeigt würden, sie wären doch die beste Werbung für das Unternehmen, wenigstens als Musiker und als Schwestern hätte man Gebleichte nehmen sollen. Weiß sei nur der vollbärtige Dr. Jeremy Jonathan, der von einer gläsernen Zelle aus das Bleichen überwache. Angestachelt durch den Erfolg Jonathans, entstünden in vielen Städten der Staaten Konkurrenzunternehmen, die Firma Edison, die die Bestrahlungslampen produziere, könne mit deren Produktion kaum nachkommen. Es sei abzusehen, dass die schwarze Rasse aus den Vereinigten Staaten verschwände. Auch von den Kriegsversehrten, die aus Europa zurückkämen, hätten sich schon viele bleichen lassen, denn auch als Blinder, als Einarmiger oder Einbeiniger habe man bessere Chancen, wenn man weiß sei. Ich fragte Homer, ob er sich auch bleichen lassen wolle. Er war Thereses Meinung: Er wolle erst einmal einen dauerhaft Gebleichten sehen. Er habe die weißen Wolken auf der Haut der Klienten gesehen, er glaube, das Bleichen funktioniere. Aber er könne sich gut vorstellen, dass die Gebleichten später langsam wieder erschwarzten. Deshalb würden die Gebleichten auch nicht gezeigt. Man müsse sich also regelmäßig wieder in Behandlung begeben. Das würde dann ein teures Vergnügen!
Anmerkungen
Das im 35. Bogen geschilderte Hinrichtungsritual nach Arthur Holitscher: Amerika heute und morgen, Kapitel „Stationen zwischen Pazifik und Mississippi“, Berlin 1913.
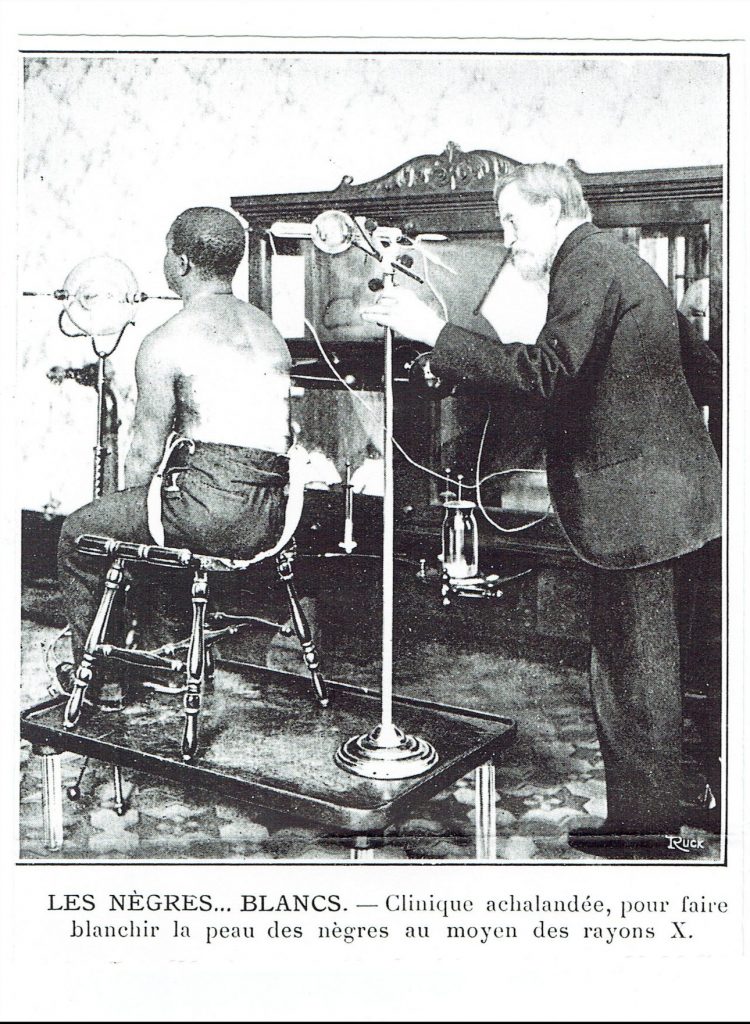
Dieses Foto fand ich in Jules Huret: En Amérique De New York a la Nouvelle-Orléans. Paris 1910 Der Bing-Kopilot bewertet es so: „Dieses Foto ist sehr wahrscheinlich nicht Bestandteil von Jules Hurets Original-Reisebericht 1904. Es wirkt, als stamme es aus einem separaten, späteren Medium – etwa einer populärwissenschaftlichen oder satirischen Zeitschrift jener Zeit – und wurde anschließend fälschlich mit Hurets Werk in Verbindung gebracht.“ Da das Bleichen schwarzer Haut und das Glätten krauser Haare bis heute ein beachtlicher Geschäftszweig der kosmetischen Industrie in den USA ist, sah ich keinen Grund, diesesem Foto für die Frühzeit des Röntgens, in der es in Verkennung der Gefährlichkeit von x-rays zu vielen Verletzungen kam, keinen Glauben zu schenken.
Blüthner
Immer wieder fuhr ich in Altona an einem Antiquitätenladen vorbei, in dem neben Vasen und Seestücken auch ein zierlicher Sekretär ausgestellt war, der mich gleich in Bann schlug. Der Händler merkte, dass ich nicht behelligt werden wollte, und ließ mich das Möbelstück umkreisen, ließ mich die Schubladen aufziehen und wieder schließen, und als ich ihn schließlich nach dem Preis fragte, hat er ihn womöglich gleich verdoppelt, denn es konnte ihm nicht entgangen sein: Ich hatte angebissen! Zu Hause stellte ich fest, dass ein gewisser erbenlos verstorbener Herbert Eisenpflicht aus Himmelstein der Vorbesitzer gewesen war und einiges an Akten, Drucksachen und Manuskripten in den Schubladen zurückgelassen hatte. Ich veröffentliche erstmals mehrere Episoden, in denen Herbert Eisenpflicht sich mit seiner Schulzeit auseinandersetzt.
Quoth
Manfred
Wenn ein zartfingriger Junge von 16 und ein blondgelockter von 14 Jahren bei derselben Musiklehrerin Unterricht haben, ist es nicht auszuschließen, dass sie einander schätzen, wenn nicht lieben lernen. Manfred war ein atemberaubend guter Hundertmeterläufer, sprang weit und hoch, dass dir die Luft wegblieb, aber die Invention spielte er mit einer so glockenreinen Präzision, dass Herbert den dicken Band Nietzsche, den Fräulein Janssen ihm in die Hand gedrückt hatte, weil er warten musste, zuklappte und sich hilflos staunendem Lauschen hingab. Beim letzten Sportfest hatte er Manfred bewundert, wie er als Schlussläufer seiner Mannschaft den Staffelstab mit der enormen Kraft seiner Schenkel, der Boden erzitterte unter seinen Schritten, an die Spitze und zum Sieg trug, aber Manfred war ihm als Muskelpaket erschienen, als Repräsentant einer Welt von Tempo und Kraft, nicht von Klugheit und Sensibilität. Und nun das! Noch nie hatte er ein so wunderbar perlendes Klavierspiel gehört, schamvoll gestand er sich ein, dass die F-Altblockflöte, der Töne zu entlocken er bei Karla Janssen gelernt hatte, ein geradezu klägliches Instrument war, Meilen entfernt von der Klangfülle des lackschwarzen Blüthner, auf dem Manfred so sicher und genussvoll spazieren ging, als durchwandle er die Allee am Seeufer mit ihren beschnittenen Linden. Einen Menschen von solcher Daseinsfülle erleben zu dürfen, war ein Geschenk, das Herbert demütig in Empfang nahm. Gehorsam schlug er den Band „Jenseits von Gut und Böse“ wieder auf, aber die Sätze des großen Abräumers waren bloßes Buchstabengekräusel vor seinen Augen, und als Manfred sich verspielte und lachend über seinen Fehler wie ein Mädchen in die Hände klatschte, und von Fräulein Janssen mit den Worten „Noch mal von hier, mein Süßer!“, ermuntert wurde, neu anzusetzen, war es um ihn geschehen: Er schwor sich, einmal „mein Süßer“ von diesem Inbegriff der Männlichkeit genannt zu werden, und als Karla Janssen ihn, den Inbegriff der Männlichkeit, zur Tür geleitete, sagte sie, einer plötzlichen pädagogischen Eingebung gehorchend und auf Herbert blickend: „Das ist Herbert Eisenpflicht, der ist bald so weit, dass du ihn begleiten kannst. Hier, nimm die mal mit, das sind Telemann-Sonaten für Altblockflöte und Klavier, schau sie dir an, im Herbst habe ich wieder Eltern- und Vorspielabend!“ Mein Glück kannte keine Grenzen – denn Herbert Eisenpflicht, ich gestehe es, bin ich.
Walküre
Der Weg war wie immer, wenn es getaut hatte, matschig, Karla kam mit ihrem Moped kaum voran. Die Orgelei in der Dorfkirche war ein gutes Zubrot, obgleich auch nervend, denn das Instrument war alt und ausgeleiert, der Holzwurm tobte darin, einige der Pfeifen musste sie meiden, weil sie nicht mehr stimmten, und eine Reparatur konnte sich das arme Eichhagen nicht leisten. Sie jonglierte über lehmige Fladen, von denen das Vorderrad regelmäßig abrutschte, und dachte an Aarons letzten Brief von der Front, in dem er über den unergründlichen Schlamm klagte, der bei Nacht an den Fahrzeugen festfror, so dass sie ihn morgens mühsam abhacken mussten, um wieder in Gang zu kommen. Merkwürdig, dass sie auf ihren alten Tag noch zur Reiterin geworden war, zwar nicht eines Gauls, sondern einer Quickly, die mit stinkendem Gemisch fuhr, ein Auto konnte sie sich nicht leisten und hätte es auch als spießig empfunden. In ihrem regendichten Klepper über die Landstraßen zu brettern – das war doch etwas anderes als geborgen und verwöhnt auf weichem Autosessel zu sitzen! Sie kam durch Kleinfischbach, Dorfjungens riefen ihr Unverständliches nach, sie beschleunigte, die Straße hatte sich geglättet, und sie freute sich auf den jungen Vikar, der, während die Gemeinde ihre Choralpflicht absolvierte, neben ihr saß und ihr schüchtern auf die Schulter tippte, damit sie nicht wieder eine Strophe zu viel spielte. Der Fahrtwind griff ihr unter die Kapuze und warf sie zurück, sie hatte es gern, wenn ihre grauen Dauerwellen durchwühlt wurden, das erinnerte sie an die Zeit, als sie vom Dreimeterbrett den Abfaller gesprungen war und die Bewunderung und den Neid der mehrheitlich unsportlichen jungen Mädchen genossen hatte. Jetzt kam sie durch Rabenschlade, musste ihr Tempo reduzieren, spürte, wie auf dem Kopfsteinpflaster der Kitzel des Reitens ihren Körper erschütterte wie eine Abfolge elektrischer Schläge. Was sie nicht sah, war der Feuerstrahl, der ihrem Auspuff entfuhr, als habe sie wie ein Jetpilot den Nachbrenner eingeschaltet, wieder schrie die Dorfjugend Unverständliches, aber das Dorf war zu Ende, sie beschleunigte wieder, ihr grauer Klepper flog, sie sah aus, wie eine Riesenfledermaus, und „Hojotoho!“ erklang es in ihr, ja, sie sang es, hier war sie ja nicht in der Kirche und konnte sich einen Ausflug ins Heidnische leisten, es berauschte sie förmlich, aber dann, im Rückspiegel, sah sie den Feuerstrahl, sie versuchte zu bremsen, aber die Bremse versagte, da hielt sie zu auf einen Kieshaufen und flog über den Lenker des allzu plötzlich gestoppten Zweitakters.
Der Klavierstimmer
„Dies ist nicht irgendein Klavirr, sondern ein Blüthner,“ sagte der Stimmer, als ich mich erstaunt zeigte ob des riesigen Koffers voller Werkzeug, das er immerhin aus Leipzig hierher geschleppt hatte. In bewundernswertem Tempo nahm er den Flügel auseinander, lehnte die Abdeckungen an Karla Janssens brechend volles Bücherregal, spielte ein paar Takte aus einem Stück, das mir bekannt vorkam, runzelte die Haut seiner in eine Glatze übergehenden braunen Stirn, schüttelte den Kopf und klagte: „Seit zwanzig Jahren nicht gestimmt, mindestens! Gibt Arrbeit, viel Arrbeit!“ Er nahm die Stimmgabel hervor, schlug sie an, lauschte, schlug dann das A an, verglich und runzelte wieder die Stirn, schüttelte erneut den Kopf, packte einen kurzen und einen langen Stimmschlüssel aus, zog ein Dämpfband durch Saiten, die offenbar nicht mitschwingen sollten, und begann, sich quinten- und oktavenweise durch den Tonkosmos des Flügels hindurchzustimmen. Ich zog mich höflich ins Nebenzimmer zurück, um nicht den Eindruck zu erwecken, ich wolle ihn kontrollieren, griff ins Regal und zog einen schmalen Kunstband hervor. Er zeigt Bilder eines Künstlers, der davon besessen schien, Frauen in möglichst kompromittierender Weise darzustellen, ich las über ihn, dass er wie mein Großvater kurz nach dem Ersten Weltkrieg an der Spanischen Grippe gestorben sei (Egon Schiele), diese Parallele nahm mich für ihn ein. Plötzlich schrie der Klavierstimmer auf. „Es ist,, wie ich habe gesagt!“, rief er triumphierend. Ich ging hinüber: Er schwenkte einen Zettel in der Hand, den er unter die Saiten geklebt gefunden hatte. „14. März 1935 Adolf Levi & Co, Blüthner-Klaviere, Hamburg“, rief er und hielt mir den Zettel hin, „vor 20 Jahren das letzte Mal gestimmt, wie ich habe gesagt!“ Und er fügte versöhnlich hinzu: „Aber es ist nicht irgendein Klavirr, sondern ein Blüthner. Der nicht alle drei Jahre Stimmung benötigt! Habe Flügel gestimmt für Prokofjew, ein übler Patron, und für Schostakowitsch, ein Engel!“
Kreishospital
„So, er hat sich beklagt, der Flügel sei völlig verstimmt … Das ist Quatsch, zwei-drei Tasten im Diskant klangen ein bisschen schräg, und auch im Bass war eine, die ich tunlichst mied. Wieviel hat er genommen?“
„Fünfundsiebzig Mark, zuzüglich Rückfahrkarte von Leipzig nach Himmelstein, etwa noch mal dasselbe.“
„Ganz schön happig für das Stimmen von neun oder zwölf Saiten. Aber gut, es musste ja mal sein! Und er sprach mit russischem Akzent, sagst du?“ Karlas Hände waren unverletzt geblieben, aber das Gesicht war verpflastert und verbunden, doch die graublauen Augen blickten Herbert forschend und freundlich an.
„Ja, er sagte, er stamme aus Odessa und habe unter anderem für die perfekte Stimmung der Instrumente gesorgt, auf denen Prokofjew auf seinen Konzertreisen spielte.“
„Wer’s glaubt, wird selig,“ bemerkte Karla sicherlich mit einem Lächeln, aber man sah es nur angedeutet in ihren Augen, die sich zu Schlitzen verengten.
„Er hat mir noch so viele Pianistennamen genannt, dass mir der Kopf davon schwirrte.“ Karla ergriff seine Hand und drückte sie fest.
„Ich bin dir so dankbar, dass du den Termin für mich wahrgenommen hast. Ohne dich hätte ich ihn absagen müssen. Und ich bin dir dankbar für deinen Besuch! Denn es kommt ja sonst reinweg niemand! Im Krankenhaus lernt man bereuen, dass man nie eine Familie gegründet hat.“ Sie tupfte sich mit einem Herrentaschentuch die wässernden Augen, besann sich aber schnell und fuhr fort: „Leg das Portemonnaie mit dem Restgeld auf die Konsole. Und die Hausschlüssel.“
„Ich hätte eine Bitte,“ sagte Herbert und schwenkte das Schlüsselbund an einem Finger, „könnten Sie mir die noch lassen? Ich habe, offen gestanden, Manfred angerufen und ihn gefragt, ob er den Termin nicht übernehmen wolle, er verstünde doch viel mehr davon. Aber er konnte nicht, weil er für den Landeszehnkampf aufgestellt ist, schlug aber vor, wir könnten doch bei Ihnen die Telemannsonaten mal zusammen üben.“
„Ohne mich?“ Karla war offenbar gekränkt, fand es dann aber doch gut, weil sie wegen Hirnerschütterung und drei gebrochener Rippen mindestens noch eine Woche in Behandlung bleiben musste. Herbert machte Freudensprünge, als er das Hospital verließ. Und er nahm sich vor, die hohen Töne Telemanns, besonders das hohe G, bis zur Bewusstlosigkeit zu üben. Und plötzlich fiel ihm der Zettel ein, den der Stimmer im Flügel gefunden hatte. Sollte er Karla noch einmal in ihrem Zimmer aufsuchen? „Ach, es ist früh genug, wenn ich es ihr bei ihrer Rückkehr erzähle. Und wahrscheinlich kennt sie ihn längst!“
Schwedinnen
Ein Flügel ist eigentlich nichts anderes als eine liegende Harfe, auf drei Beine gestellt und mit Holz umkleidet, doch die Saiten werden nicht unmittelbar, sondern mittelbar angeschlagen: Über Tasten, die man mit den Fingern niederdrückt, werden Hämmerchen emporgeschnellt und erzeugen durch ihren Anschlag die Töne, naja, man kennt das. Und Flügel heißt das Ding, weil es entfernt an die Form eines Adler-, Schwanen- oder Kondorflügels erinnert, besser hieße es Schwinge, denn sein einziger Zweck ist es, Schwingungen zu erzeugen, die ans Trommelfell gelangen und in ihrer Kombination das erzeugen, was wir Musik nennen. „Und Musik ist nichts weiter als tönende Mathematik“, erklärte mir der Stimmer, den hereinzulassen und mit Kaffee zu versorgen die im Kreishospital liegende Klara Janssen mich gebeten hatte. Warum mich und nicht einen Klavierspielschüler wie Manfred, hatte ich mich gefragt, aber das hatte sich wohl zufällig ergeben. Mein Mütterchen hatte eine frisch an einer Senkung operierte Freundin besucht und bei der Gelegenheit auch Karla gute Besserung zu wünschen für gut befunden, von deren Unfall sie im „Volksfreund“ gelesen hatte, und bei der Gelegenheit hatte Karla ihr den Schlüsselbund und ihr Portemonnaie in die Hand gedrückt und ihr gesagt, dass der Kaffee oben rechts im Küchenschrank stehe. Ich füllte die Kaffeemühle mit sechs Esslöffeln Bohnen und begann zu drehen. Das mit der Mathematik war mir nicht neu, mein Bruder hatte sich aus einem Brett, einer Darmsaite und einer Kurbel ein Monochord gebastelt und mir bewiesen, dass man die Oktave eines Tons erhielt, wenn man die Saite halbierte – ich hatte es mit Hilfe meiner Blockflöte überprüft. Und auch für Quinte und Quarte und Terz gab es genaue mathematische Verhältnisse, und sonderbar war es auch, dass ich mit dem richtigen Ton auf der Flöte die Saite zum Mitschwingen anregen konnte. Und da die Bahn des Mondes, die Bahnen der Planeten seit Kepler und seinem dänischen Vorläufer Tycho Brahe berechenbar waren, und das so genau, dass z.B. Finsternisse auf Jahrhunderte genau vorausgesagt werden konnten, war die Idee einer mathematischen Sphärenharmonie gar nicht mal so abwegig. Ich versuchte, Manfred für diese Gedanken zu erwärmen, als wir zusammen Telemann übten – aber er hörte nur geduldig zu, lächelte etwas mitleidig, wie mir schien, und erzählte mir sichtlich stolz von einer der aufgedonnerten Schwedinnen, die uns im Rahmen eines Schüleraustauschs besuchten: Sie sei so begeistert von ihm gewesen, dass sie sich in das Revers seines Blazers verbissen habe, man könne es kaum glauben! Er zeigte mir stolzgeschwellt die Spuren von dunkelrotem Lippenstift auf seinem Lornsenschuljackett und schwor, sie so lange wie möglich zu konservieren.
Der alte Eichbaum
Einsam war ich schon immer, aber meine junge Freundin spricht mir Mut zu und verwöhnt mich mit dem Duft ihrer Blüten. Unter uns tummelt sich der Menschennachwuchs, weiß der Himmel, womit sie ihre Zeit verbringen, wenn sie auf ein Klingelzeichen, das mir schrill in den Blättern klingt, alle im Haus verschwinden, nur um zwölf Windstöße später alle wieder aufzutauchen und ihren Gang rund um das maibaumgeschmückte Rondell anzutreten. Heute aber ist alles anders. Alle sind ins ockerfarbene Gebäude gerufen worden, doch kurze Zeit später kommt eine Gruppe heraus mit Schemeln und Zeichenblöcken bewaffnet, sie nehmen auf der Seite Platz, von der mich die Sonne bestrahlt, und unter Anleitung ihres Lehrers zücken sie Holzkohle und beginnen, mit zischenden, kratzenden Strichen mich abzukonterfeien … O sie sehen nur den knorrigen Stamm, seine Verzweigungen, die Ästchen und Blätter, sie wissen nicht, was ich alles weiß, aber das ist auch gut, denn ich weiß nicht nur Gutes. Aber warum skizzieren sie nur mich und nicht meine anmutige Nachbarin, die mir immer die süßesten Düfte zulispelt? Ein Junge wirft seinen Block auf den Boden, nachdem er alles verwischt hat, aber der Lehrer, ein hübscher, schlanker junger Mann, redet ihm gut zu, findet das Gezeichnete „gar nicht mal so schlecht“, ergänzt es um ein paar eigene Striche, führt dem Linkshänder die Hand, und der scheint es zu genießen, hat er vielleicht nur deshalb den Verzweifelten gespielt? „Herbert,“ sagt der Lehrer, „sei nicht traurig, wenn man dich als Linkspoot verspottet, der größte Künstler der Welt, sein Name ist Leonardo, war Linkshänder, schaue genau hin und versuche, nicht den Baum, sondern seine Struktur zu erfassen und in deiner Zeichnung zu spiegeln.“ „Seine Struktur ist mir zu schwierig,“ sagt Herbert darauf, „lieber würde ich die Linde zeichnen, die nebenan steht, an ihr ist alles senkrecht und schön!“ „Dann zeichne die!“ Herbert wandert mit seinem Schemel ein paar Schritte seitwärts und zeichnet meine Freundin, und ich liebe ihn dafür und werfe eine Eichel vom letzten Jahr auf seinen Zeichenblock hinab, dass er erschrickt.
Der Zettel
Zu Karla Janssen in den Unterricht zu gehen, war für mich wie nach Hause kommen. So ein Elternhaus hatte ich mir immer gewünscht – die Bücher, der Flügel, das Porträt der Großeltern – und Karla Janssen selber, die Sinn, Geborgenheit und Schönheit in Musik und Kunst, Wahrheit in Philosophie und Literatur verheißend und verkörpernd unter all dem residierte, sich kümmerlich genug mit Klavier- und Flötenunterricht und Orgelspielen auf verschiedenen Dörfern durchschlug und darüber hinaus noch ein Zimmer an Frau Pokraka, eine alte Flüchtlingsfrau, vermietet hatte, die mit nichts als ihrer Kaffeemühle im Arm aus Masuren in Himmelstein angekommen war.
„Ja, es ist richtig,“ sagte Karla Janssen, als ich sie nach ihrer Heimkehr aus dem Hospital auf den Zettel unter den Saiten aufmerksam machte, „es ist richtig, diesen Flügel haben die Vorbesitzer bei Adolf Levi in Hamburg gekauft und von ihm stimmen lassen. Sie waren auch jüdisch und haben ihn zum Verkauf angeboten, weil sie nach Palästina auswandern und die Reichsfluchtsteuer von dem Erlös bezahlen wollten. Das ist ein trauriges Kapitel, auf das ich nicht gern zu sprechen komme, denn haben wir damals nicht von der Not dieser zu Unrecht nur wegen ihrer Rasse vertriebenen Menschen profitiert?“ Sie tupfte sich die wässernden Augen mit dem Batisttaschentuch, das sie immer bei sich trug, und zeigte mir das in die Ecke eingestickte Monogramm: F.W. „Ja, wir haben ihnen nicht nur den Blüthner, sondern auch einen Großteil ihrer Wäsche, ihres Geschirrs und Mobiliars abgekauft. Sie wollten es ja so, waren glücklich, in meinen Eltern finanzkräftige Abnehmer gefunden zu haben, die den geforderten Preis nicht zu drücken suchten. Natürlich: haben wir ihnen für den Flügel höchstens ein Zehntel seines wahren Wertes bezahlt, dasselbe gilt für diese Couch mit dem Ledaschwan und den dazu gehörigen Tisch und die Stühle. Wir haben uns in bester Absicht, ihre durch staatliche Verfolgung verursachte Not nutzend, bereichert. Meinen Eltern schwante dann, dass es nicht mit rechten Dingen zuging. Sie waren absolut nicht antijüdisch eingestellt, im Gegenteil: Der Anwalt meines Vaters war jüdisch, unser Hausarzt war jüdisch, und die Lieblingsmusik meiner Mutter war das 1. Violinkonzert von Bruch, bei dessen Ertönen sie förmlich dahinschmolz … Das Angebot der Wolfs, uns ihr Haus zu verkaufen, nahmen wir nicht an, zumal mein Vater, Architekt, sich selbst eins bauen wollte. Die Wolf-Villa wurde vom Staat erworben, und als sich die Hausbaupläne meiner Eltern am ausbrechenden Krieg zerschlugen, erwarben wir sie, irgendein Regierungsrat spielte den Verkäufer … Ich weiß, wie sehr du es genießt, zu mir zu kommen, weil dir alles so bieder, brav und traditionell bürgerlich erscheint. Ja, das ist es, aber es ist eine vergiftete Bürgerlichkeit, denn die Wolfs, die sie aufgebaut haben, haben kein Schiff nach Palästina bekommen, dafür aber eines nach Kuba, du hast bestimmt von der St. Louis gehört, – aber als sie dort ankamen, wollte man nichts von ihnen wissen und hat sie zurückgeschickt, ihre Spur verliert sich …“ Sie hielt plötzlich inne, sog die Luft durch die Nase ein. „Himmel!“, rief sie. „Frau Pokraka hat wieder die Bratkartoffeln auf dem Herd vergessen … Das ist nun schon das dritte Mal in dieser Woche! Herbert, wir reden ein andermal weiter über Vergangenes, das nicht vergehen will. Den Telemann hast du schon wunderbar drauf; da wird Manfred sich anstrengen müssen! Grüß deine Mutter!“
Die Taste
Ich bin ja nur eine Taste, elfenbeinfarben und a u s Elfenbein, dabei haben Elfen ja keine Knochen, sondern sind geistige Wesen, bewegen sich bei Nacht schwerelos auf mondbeschienener Waldwiese, aber mir ist gar nicht schwerelos zumute, ja, manchmal glaube ich mich daran zu erinnern, dass mein stolzer Besitzer sich mit mir den Weg durch dichtes Unterholz bahnte oder laut trompetend mit einem Rivalen die Waffen kreuzte … Nun gut, jetzt ist es mein Schicksal, darauf zu warten, dass ein mehr oder weniger zarter Finger mich herunterdrückt, zuerst war es der elfenhafte Finger der Haustochter, die entscheiden durfte, welches Instrument sie haben wollte von dem runden Dutzend, das an der Elbe zu besichtigen war. Anfangs waren es nur seelenlose Läufe und Klimpereien, die sie absolvieren musste, dann waren es ein paar Volkslieder, ich erinnere mich, dass Glückl mitsang: „Flieg, Bienlein, flieg!“, dann waren es Kinderstücke von ihrem Ururgroßvater Mendelssohn, o ja, die waren süß, und schließlich kam der französische Pole oder polnische Franzose Chopin an die Reihe, und das war meine große Stunde, denn von dem gibt es ein Stück, da wurde ich einige hundert Male gedrückt, durfte immer denselben Ton erzeugen, ohne dass es langweilig wurde, es war ein Labsal für meine elfenbeinerne Seele, immer und immer wieder gedrückt zu werden von Glückls rosigem Ringfinger, in den ich mich schlichtweg verliebt habe: Wie kann ein Mädchenfinger so geschickt, so anmutig, so nachhaltig, so pochend und Glück verheißend sein! Jede seiner Berührungen genoss ich wie einen Kuss, obgleich ich gar nicht weiß, wie ein Kuss geht, denn ich habe keinen Mund, und mein Vorbesitzer hatte auch keinen – oder doch, er hatte einen, aber mit dem küsste er nicht, sondern steckte seine lange Nase hinein, was bin ich nur für ein sonderbares Zwitterwesen, möchte menschlich fühlen und bin doch tierischer Herkunft. Auch Siegfried hat mich zeitweise drücken dürfen, Glückls kleiner Bruder, an sich ein süßer Kerl mit seinen Wurstfingern und seinem trotzdem harten Anschlag, mit dem er den Czerny herunterhämmerte – aber dann wurde es still, die Familie zog aus und eine andere ein, und nun, so hörte ich, war es eine Karla, die Läufe und Etüden auf mir übte und das Lied „Pommerland ist abgebrannt!“ sang und sich schnell zu einer Musik emporarbeitete, die ich grässlich fand, sie rief „Hojotoho!“ und wechselte von einer Tonart in die andere, glatt zum Ertauben. Sie verschwand, ich stand still und verstaubte und sehnte mich nach den Urwäldern und Savannen meiner Herkunft, aber dann kam sie zurück, eine von der Liebe Gezeichnete, spielte Mendelssohn und Chopin, gab mich aber auch vielen Anfängern preis, die ihre ersten Musikschritte auf mir erlernten, o, ich habe zeitweise Furchtbares durchgemacht, wenn ich nur an den Türkischen Marsch denke, der immer an derselben Stelle scheiterte … Karlas Finger sind beherrschend und streng, aber einer ist jetzt unter ihren Schülern, dessen Finger haben die Zartheit und elfenhafte Anmut der rosigen Finger von Glückl, und ich hoffe auf den Tag, an dem er das Stück mit den pochenden Wiederholungen von Chopin spielt und mich einige hundert Male küsst.
Das Geständnis
Das Zusammenspiel Herberts mit Manfred wurde immer besser, der Telemann klang prächtig und beinahe schon virtuos (vor allem hatte er gelernt, die hohen Töne durch Bauchatmung besser zu beherrschen) – aber Manfred nach Hause begleitend, wurde ihm klar, dass er für ihn nicht die Rolle spielte, die Manfred für ihn spielte. Deshalb fasste er sich eines Nachmittags, als er mit Karla allein war, ein Herz und bat sie, das weitere Zusammenspiel auszusetzen. „Aber warum das?“, wollte Karla wissen, „Ihr seid doch das Glanzstück für meinen Elternabend! Darauf werde ich nicht verzichten!“ Herbert brach in Tränen aus. „Ich glaube, ich habe mich in Manfred verliebt,“ sagte er, „aber Manfred interessiert sich nur für die aufgedonnerten Mädchen aus Uppsala.“ „Dann hast du eben Pech gehabt und dich in den falschen verliebt. Das passiert jedem und jeder einmal, nein, zwei-, drei- oder sogar viermal im Leben. Mir ist es auch passiert. Ich habe mich während des Studiums in Köln in meinen Klavierlehrer verliebt. Das war sogar noch schrecklicher, denn er erwiderte meine Liebe, Beethovens Elise war unsere Kennmelodie, er pfiff sie unter meinem Fenster, wenn er zum Konservatorium vorbeiging, dann wusste ich, dass er an mich dachte, sich auf mich freute, für mich war klar, dass wir auf Verlobung und Ehe zusteuerten. Aber dann erfuhr ich von einer Kommilitonin, dass er auch mit ihr schlief – und nicht nur das – er war verheiratet mit einer gelähmten Frau. Wie naiv war ich gewesen! In einem furchtbaren nächtlichen Kraftakt wandte ich mich innerlich von ihm ab, verließ das Konservatorium und beendete mein Studium in Hamburg. Seine Frau ist inzwischen gestorben, wie ich von der Kommilitonin erfahren habe, und sofort sind meine unterdrückten Wünsche und Sehnsüchte wieder erwacht, ich würde mich an ihn wenden, aber er ist als Soldat im Osten vermisst – und das ist gut so. Er hat mir nicht gutgetan. Spiele den Telemann mit Manfred noch auf dem nächsten Vorspielabend, dann suche ich dir einen anderen Begleiter. Und wende dich innerlich von Manfred ab. Vielleicht wird dir gelingen, was mir nicht gelang: Ihn zu vergessen und eine neue Liebe zu finden.“
Ich, der Flügel
Natürlich bin ich ein bloßes Ding und von daher nicht berechtigt, mich zu Wort zu melden. Hat denn ein Flügel eine Sprache? Ist er ein Subjekt? Kapriziert sich womöglich gar auf ein Seelenleben? Nun, für einen fabrikneuen Flügel, mag er welcher Marke auch sein, Bechstein, Bösendorfer, Blüthner, wäre die Antwort auf alle Fragen ein energisches Nein! Aber über die Jahre sammelt sich so viel Schmerz, so viel Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, soviel jubelndes Entzücken, so viel dumpf hallende Verzweiflung, so viel zittrige Sehnsucht und süße Resignation in mir an, dass mein gusseiserner Rahmen, mein stählernes Saitenkleid und meine ulmene Hülle zu einer leise und unmerklich erwachenden Seele verwachsen, die begierig mehr und mehr lernt und durchaus zu empfinden, zu erlauschen und zu erraten vermag. Als vor gut 30 Jahren zum ersten Mal eine Musik auf mir gespielt wurde, die mir völlig neu war – da wusste mein sechster Sinn, woher sie stammte und dass sie in Militärkapellen, auf Baumwollfeldern und vor ärmlichen Hütten geboren wurde. Und auch Echos vermag ich wahrzunehmen; ich vernehme sie bis aus den Tiefen Asiens, wenn das wohltemperierte Klavier auf mir seine mathematische Schönheit entfaltet – oft spielen es Tausende zugleich und manchmal sogar synchron, als hätten sie sich verabredet; wenn Manfred präzise und sanft die Akkorde unter die Sonate setzt, die ein verliebter Junge auf der Altblockflöte spielt, spüre ich, dass der junge Athlet von anmutigen Mädchen träumt, die in schwingenden, tief ausgeschnittenen Barockkleidern unter aufgetürmten Perücken tanzen, der Junge aber davon, zu sterben, Manfred an sein Sterbelager zu rufen und ihm seine heiße, hoffnungslose Liebe zu offenbaren; wenn Gudrun mit verzweifelt hochgezogenen Schultern den türkischen Marsch intoniert, immer wieder an der gleichen Stelle der Janitscharenmusik scheitert und sich so bezaubernd schämt; wenn Karla Janssen, sobald alle Schülerinnen und Schüler fort sind, ihr Lieblingsstück auf mir spielt und dabei widerwillig weint, klingt es leise aus Russland zurück, mit eben dem sanft kreisenden Anschlag, der gleichen verzweifelten Sehnsucht … Nur von einer erreicht mich keine einziger Laut: Von der ersten, die mich zum Leben erweckte, von Glückl Wolf, bitte, Karla, bitte: den Trauermarsch …
Thalysia
„Was sagen Sie – Sie haben keine Kinder?“ Karla ging diese Frage etwas weit. Grimmig erwiderte sie: „Nein.“ „Aber schwanger gewesen müssen Sie mal sein. Das fühle und sehe ich. Gut, es geht mich ja nichts an.“ Karla nickte energisch bestätigend. „Was schlagen Sie mir vor?“ „Meine Hausmarke hat für jede Figur eine Lösung. Wichtig ist für mich noch, Ihr Ziel zu erfahren. Wollen Sie schlank und jugendlich aussehen? Oder genügt es Ihnen, die altersbedingte Fülle ein wenig zu bändigen?“ „Ich möchte ein Kleid wieder anziehen, das ich vor 40 Jahren zuletzt in die Oper trug, damals Xerxes von Händel. Ich habe es dabei.“ Karla packte ein grünsamtenes Kleid aus, das Sorgenfalten auf die Stirn der Miederwarenhändlerin zauberte. „Damals waren Sie noch nicht …“ Sie korrigierte sich. „Damals waren Sie noch unschuldig, nicht wahr? Haben Sie nicht eine Schneiderin an der Hand, die es – ein wenig weitet?“ „Wozu verspricht die Marke Thalysia, sie forme die Figur? Bitte formen Sie mich!“ Das war einfacher gesagt als getan. Nachdem drei Schnürbänder durchgerissen waren und Karla zu keuchen begann, weil sie kaum noch Luft kriegte, stiegen die beiden Frauen auf das Konzept der bloßen Bändigung um. „Ich werde das Kleid meiner Mieterin geben, die kann nähen. Und es ist ohnehin zu lang. Sie kann unten eine Spanne abschneiden und draus Zwickel für die Erweiterung gewinnen.“ „Man soll zu seiner fraulichen Fülle stehen,“ meinte Frau Flöl, „die Herren schätzen sie ohnehin mehr als wir selbst. Haben Sie Karten für die Oper?“ „Bin ich so dick, dass ich mehrere benötige?“ „O, Entschuldigung, natürlich ja, Fräulein Janssen, das sagt alles. Was wird gegeben?“ „Norma von Bellini, und die Griechin soll die Norma singen … Sie haben bestimmt von ihr gehört. Herr Lademann hat mir die zurückgegebene Karte von Frau Eisenpflicht herausgerückt, die mit Migräne zu Hause bleiben muss.“ „Migräne ist Schicksal, hat mir mein Arzt mal gesagt, und ich glaube, er hat Recht. Man muss sich mit ihr abfinden.“ „Leiden Sie darunter?“ Frau Flöl wickelte das Mieder in Seidenpapier. „Sie meinen, unter der Mi? Ich kürze ihren Namen immer ab in der Hoffnung, sie dadurch günstig zu stimmen und mich nur alle vier Wochen heimzusuchen.“ Karla verließ das Geschäft in der Kasinostraße unmittelbar neben dem Buchladen von Herrn Lademann, der mit den Ohren wackeln konnte. „Alte Vettel!“, dachte Frau Flöl. „Hält sich für was Besonderes, nur weil sie ihr Fett in die Oper schleppt. Puh!“
Am Anfang war …
Das war nun eine sehr merkwürdige Geschichte, die Emil mir da auftischte. Er war plötzlich in unserer Familie aufgetaucht, meine Mutter hatte geweint und gesagt: „Man kann über Konrad Adenauer sagen, was man will, aber er hat sich nach Moskau getraut und hat die Gefangenen losgeeist.“ Und sie befahl uns, ihn Vati zu nennen und ihm vorm Ins-Bett-Gehen die stachlige Backe zu küssen und ihm „Gute Nacht!“ zu sagen. Sehr redselig war er zunächst nicht, auf die Frage, wie es in Russland war, sagte er: „Kalt!“ Er war dick geworden, hatte Wasser in den Füßen, die kaum in die riesigen Filzstiefel passten. Aber als er hörte, dass das Museum eine Abteilung für Funde aus der Slawenzeit eingerichtet hatte, war er wie elektrisiert, bewarb sich und wurde deren Kustos. Das war ihm gelungen, weil er in Russland Ausgrabungen geleitet hatte, und zwar in Nowgorod. „Ich hatte doch ein paar Semester Geschichte studiert, bevor ich eingezogen wurde, und das Bergwerk, in dem wir arbeiten mussten, naja, ich weiß nicht, ob ich es überlebt hätte. Und dann wurde uns eines Morgens beim Antreten gesagt, in Nowgorod brauchten sie welche zum Ausgraben. Da meldeten sich natürlich alle, aber es wurden nur fünf genommen, darunter auch ich, weil ich gesagt habe, ich hätte Geschichte studiert. Die Kommunisten hatten scheinbar die Verbindung zur Vergangenheit gekappt, als sie die Zarenfamilie liquidiert haben, aber in Wirklichkeit waren sie scharf auf Tradition und Geschichte wie Nachbars Lumpi, und so buddelten wir in Nowgorod alte Hausfundamente aus, und als ich an einem eine griechische Inschrift fand, waren sie total begeistert, weil das bewies, dass schon die Altrussen im Mittelalter gebildete Leute waren, und ich wurde zum Grabungsleiter befördert und bekam täglich einen Teller Borschtsch, der hat mir das Leben gerettet, denn die anderen starben wie die Fliegen, z.B. auch mein bester Kumpel aus dem Rheinland. Wir waren in einem früheren Hotel untergebracht, da stand ein Klavier mit kaputten Tasten, auf dem spielte er gern, am liebsten ‚Für Elise‘ von Beethoven, er sagte, es erinnere ihn an eine Geliebte, der er ein Kind gemacht habe und von der er nicht wisse, wie es mit ihr weiter gegangen sei. Er wurde immer klappriger und hohläugiger, aber er führte das nicht auf die magere Kost, sondern auf seine Schuldgefühle zurück, und als er wieder mal ‚Für Elise‘ anstimmte auf dem verstimmten Klavier mit den kaputten Tasten, fiel er tot vom Stuhl. Und soll ich dir was sagen? Die griechische Inschrift habe ich in das Fundament gekratzt, ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, das hatte ich aus dem Religionsunterricht behalten.“
Gudrun
Seit meiner Kindheit stottere ich und werde dafür veräppelt, aber daran habe ich mich gewöhnt. Das Traurige ist, dass auch meine Finger zum Stottern neigen, dass sie bestimmte Tonfolgen einfach nicht spielen wollen, ohne hängen zu bleiben. Ich erkläre das damit, dass Stottern nicht nur eine Sache der Zunge, des Rachens, Gaumens usw. ist, sondern des gesamten Körpers, der an bestimmten Widerständen immer wieder hängen bleibt, sich gleichsam eine Bedenkzeit ausbittet – und dann weitermacht, als wäre nichts geschehen. Da das bei Bach und Händel weniger der Fall war, wäre ich froh, wenn meine Klavierlehrerin mich mit Mozart und seinen „entzückenden Einfällen“ verschonen würde, aber sie sagt: „Du kannst doch nicht dein Leben lang nur Barockmusik spielen, Mädchen, Mozart ist eine einzige Quelle der Freude und Lebenslust, er wird sich deinen Händen und deinem Kopf ergeben!“ Der Elternabend am Donnerstag sollte eigentlich mit einer Telemannsonate für Flöte und Klavier eröffnet werden, aber weil Manfred nicht kam, wurde sie an den Schluss verlegt, Fräulein Janssen hoffte, dass er noch käme. Natürlich blieb ich beim Türkischen Marsch wieder hängen, und das nicht nur einmal, sondern dreimal! Dafür schämte ich mich in Grund und Boden, und besonders demütigte mich der allzu großzügige Beifall, der mich wohl trösten und ermutigen sollte, aber das Gegenteil bewirkte. Und dann kam der Anruf: Manfred werde nicht kommen, er habe sich beim Kugelstoßtraining eine Sehnenzerrung in der rechten Hand zugezogen und könne nicht spielen. „Dann begleite du ihn!“ Karla Janssen drückte mir das Notenheft in die Hand, ich wusste, es war die erste Sonate in F-dur (dam-da-da-di-daa), ich hatte sie, auf meine Stunde wartend, oft genug gehört, ich setzte mich bibbernd an den Flügel, aber schon nach den ersten drei Takten wusste ich: Es würde gelingen! Der Flötenspieler, ein gewisser Herbert Eisenpflicht, ruhte sich regelrecht auf meiner Musik aus, nahm Tempoänderungen bereitwilligst auf und war von einer Sicherheit, wie ich sie früher, als Manfred ihn begleitete, nie gespürt hatte. Er war selbst erstaunt; ich werde das ungläubige, bewundernde Lächeln nie vergessen, mit dem er mich ansah, als der nun gar nicht nur trostreiche, sondern begeisterte Beifall laut wurde. Und er wurde noch einmal stärker, als Karla Janssen sagte: „Gudrun hat den Klavierpart soeben zum ersten Mal und vom Blatt gespielt!“ Bevor ich ging, kniete ich nieder und umarmte das dritte Bein des Blüthner, um meinem Erlöser zu danken.
Zwanzig Jahre später
Während ich meine Alpenveilchen gieße, denke ich oft an Vergangenes, an meine vielen Schüler, und wie ich manchmal Schicksal gespielt habe in ihrem Leben. Z.B. als wir von der Aufführung der Norma zurückfuhren im Bus des Himmelsteiner Besucherrings … Wie Herbert sich da an mich oder vielmehr an meinen Rotfuchs kuschelte und schrecklich weinte … Er war so unglücklich verliebt in einen meiner Schüler, dem freilich sein Sport viel wichtiger war als die Musik, und mit einem Jungen, der ihn liebte, konnte er gar nichts anfangen. Herberts Vater freute sich, in Fräulein von Plunow eine für die Geschichte der Slawen interessierte Gesprächspartnerin gefunden zu haben, und war froh, als Herbert sich einen anderen Platz suchte. Und ich bilde mir ein, da habe ich ihm die Liebe unter Männern ausgeredet … Ich weiß nicht, ob man das kann, aber er war noch so jung, und ich sah ihn auf die Bahn kommen, auf der mein Bruder gescheitert ist. Stephan war Ministerialrat beim Land, hätte gern mit seinem Freund zusammengelebt, aber aus Karrieregründen musste er heiraten – eine Witwe mit drei Söhnen, an allen dreien hat er sich angeblich vergangen, ich kann es bis heute nicht glauben, wurde verurteilt, unehrenhaft aus dem Dienst entlassen und hat Jahre im Knast verbracht, wo er verachtet und vergewaltigt wurde … Aber das ist es gar nicht, was ich Herbert gesagt habe. Stephan hat mir von der Liebesraserei in manchen Clubs und Saunen erzählt, wo er die geschlechtlichen Kontakte gar nicht mehr zählen konnte, und als Begründung gab er an: Die Liebe unter Männern sei ziel-, wirkungs- und fruchtlos. Deshalb sei sie nicht schlecht, aber es fehle ihr eine bändigende Gegenkraft, die Gegenkraft von Schwangerschaft, Vaterschaft, Rücksichtnahme, Erziehung und Freude, das eigene Werk Kind gemeinsam heranwachsen zu sehen … Deshalb lechze der Gleichgeschlechtliche nach ständiger Steigerung, Bestätigung, nach Exzess … In der Liebe von Mann und Frau, und das sage ich dir jetzt, Herbert, ist hingegen ein Moment der Ewigkeit enthalten: So wie wir selbst nur leben, weil schon vor Tausenden von Jahren Männer und Frauen sich liebend miteinander vereinigten, so können noch in Tausenden von Jahren Menschen existieren, in denen etwas von dir, Herbert Eisenpflicht, lebt, du gibst dein Erbgut in die Ewigkeit, überlebst dich selbst in deinen Nachfahren! Natürlich kann auch die Liebe von Mann und Frau von der Fortpflanzung abgekoppelt und allein der Lust wegen ausgeübt werden – dann gibt es auch hier Orgien oder denke nur an den Bordellbetrieb. Aber das ist eine Verarmung der Liebe, Aaron, mein Kölner Liebster, hat mir gestanden, mehrfach mit Huren gegangen zu sein – es habe ihn jedes Mal todtraurig gemacht, er habe sich vor sich selbst geschämt. Während Herbert mir zuhörte, hat er sich immer fester an mich gedrückt, er hat mich unter Tränen zuerst dankbar, dann immer glühender geküsst, uns beiden ging die Arie „Casta Diva“ durch den Kopf, gesungen von dieser unglaublichen Griechin, die ihre Töne mit den schönen Händen förmlich knetet – geküsst hat er mich, bis ich ihm Einhalt gebieten musste, weil mir die Zahnprothese verrutschte, ja, die hatte ich damals schon. Ach, vielleicht beruht alles auch nur darauf, dass ich L’air du temps von Nina Ricci aufgelegt hatte, das mit seinem Geruch nach Nelke und Sandelholz wohl jeden Mann um den Verstand gebracht hätte. Aber warum habe ich es getan? Hatte ich mich in Herbert verliebt? Nein, aber seine Orientierungslosigkeit hat mich gerührt, und die hat er, an meiner Seite im Bus des Besucherrings durch die Nacht schaukelnd, überwunden. Habe ich ihm wirklich was erspart? Sicherlich Einiges – aber wie unglücklich ist er mit seiner Frau geworden! Doch das ist eine andere Geschichte. Jetzt gehe ich Stephan besuchen und bring ihm das pinke Alpenveilchen. Das hätte ihm gefallen.
Relativitätstheorie
Mein Bruder heißt Emil genau wie mein Vater, so wie ich Herbert nach meinem Onkel heiße. Ich nenne ihn aus Vereinfachungsgründen aber einfach Emil und füge, wenn ich von meinem Vater rede, ein sen. hinzu. Emil hatte einen Physiklehrer, der sich über nichts so sehr erregen konnte wie über Einsteins Relativitätstheorie. Er kanzelte sie ab als „jüdische Physik“, mit der sich zu beschäftigen reine Zeitverschwendung sei – und er stellte ihr eine „deutsche Physik“ gegenüber. „Was ist an der aber deutsch, wenn sie auf den Erkenntnissen von Galileo Galilei, eines Italieners, und von Isaac Newton beruht, der bekanntlich Engländer war?“ Von Emil sen. in seiner Skepsis bestärkt, suchte Emil unseren Buchhändler auf – es gab damals nur einen in Himmelstein – und fragte ihn nach einem Buch über die Relativitätstheorie. „Die ist noch viel zu hoch für dich,“ sagte Herr Lademann und ließ die Ohren bekümmert sinken „befasse dich erst einmal mit den Grundlagen. Hier habe ich z.B. ein Heft über die Schwerkraft: ‚Gewicht, Masse, Druck‘, damit fange mal an. Und dann dieses: ‚Die Trägheit der Masse‘, und hier, wenn du dir das schon zutraust, von demselben Autor ‚Die Physik der Weltraumfahrt‘.“ Ich stand neben ihm während dieser Beratung und beobachte fasziniert das Spiel von Lademanns Ohren, die sich aufmerkend spitzten und dann wieder resigniert herabsenkten. Fraglos waren diese Ohren und ihre Beweglichkeit auch geschäftlich von Vorteil, ich möchte nicht wissen, wie viele Bücher Herr Lademann an Leute verkauft hat, die nur seine Ohren sehen wollten. „Das ist doch alles Babyliteratur,“ rief aus dem Hinterzimmer plötzlich eine helle Frauenstimme mit sächsischem Akzent, „warum bietest du Emil Eisenpflicht nicht wenigstens das Taschenbuch ‚Mein Weltbild‘ von Albert Einstein an? Das verstehe sogar ich!“ Dieses Taschenbuch schwenkend, kam Minna Lademann hereinspaziert, ich kannte sie schon, Herr Lademann hatte sie aus der Ostzone von einer Reise zu Freunden mitgebracht, und sie nahm auch bei Karla Janssen Klavierunterricht. Sie war eigentlich Strumpfwirkerin von Beruf, ging aber beherzter als ihr Mann auf unsere Wünsche ein. Bevormundet worden sei sie genug da „drieben“, begründete sie das einmal, und es sei ein Fehler, immer nur ans Geschäft und den Profit zu denken! Also zogen wir mit „Mein Weltbild“ von Einstein davon, das war der Anfang von Emils Entscheidung für die Physik und die Astronomie, und seit zehn Jahren heißt der größte von 12 Planetoiden , die er von der Europäischen Südsternwarte in Chile aus, an der er arbeitet, entdeckt hat, Emil Eisenpflicht.
Norma
„Sag ich’s ihr oder sag ich’s ihr nicht? Er kam aus dem Rheinland, spielte sehr gut Klavier, hatte eine Geliebte, die er unglücklich gemacht hat und die dann aus seinem Leben verschwand, und er spielte ‚Für Elise‘, um sich an sie zu erinnern … Aber wie viele Rheinländer, die gut Klavier spielen und eine Frau unglücklich gemacht haben, mag es geben? Und ‚Für Elise` ist nun wahrlich eins der meistgespielten Verliebtheitsstücke der Welt! Nein, ich darf es ihr nicht sagen, denn ich müsste ihr auch sagen, dass er tot vom Stuhl gefallen ist, und eine wenn auch winzige Hoffnung, dass er zurückkommt, hat sie doch immer noch! Welches Recht habe ich, ihr diese Hoffnung auf Grund einer bloßen Vermutung zu nehmen?“ Das waren meine Gedanken, als ich, neben Karla sitzend, am Schlauchtrockenturm von Rabenschlade vorbei in die Oper fuhr. Aber es kann kein Zufall sein, dass es die Oper „Norma“ von Bellini war, denn sie handelt von einer Druidenpriesterin, die heimlich und verbotener Weise Kinder von einem Römer hat, und wenn sie mit dieser unglaublichen Stimme ihre „Keusche Göttin“ beschwört, tut sie das mit schlechtem Gewissen, so wie auch Karla Gewissensbisse hatte, als sie plötzlich erfuhr, dass ihr Liebster Aaron verheiratet war … Ich saß neben ihr auf der Heimfahrt und heulte wie ein Schlosshund, sie dachte wohl, es sei immer noch wegen Manfred, sie malte mir am Beispiel ihres Bruders aus, wie schrecklich es sei, als 175er zu leben, nein, Manfred ist längst vergessen, ich mag gar nicht mehr an ihn denken, schäme mich beinahe, in ihn verliebt gewesen zu sein, Gudrun ist meine Begleiterin geworden, ihr Klavierspiel trägt mich über alle Abgründe hinweg, wir spielen jetzt Händel zusammen, der ist zwar leichter als Telemann, aber so viel tiefer! Wenn sie nur mehr mit mir spräche, ich bin ihr wohl einfach zu jung, sie ist ja drei Klassen über mir und würde sich schämen, auch nur drei Schritte auf dem Schulhof neben mir zu gehen … Ja, deshalb weinte ich auch, aber am meisten wegen Karla, wegen des Unglücks, durch das sie hindurchmusste, hatte sie das Kind wohl bekommen? Hatte sie es zur Adoption frei gegeben? War es ‚still-born‘, wie der Engländer sagt? Und ich begriff, dass Frausein heißt, zum Leiden geboren zu sein, und dass man dafür die Normas, die Elisen, die Gudruns und die Karlas über alles lieben, umarmen, verehren und küssen muss! Und neulich komme ich zur Flötenstunde und höre, wie Gudrun die Arie auf dem Blüthner spielt, ich hatte sie darum gebeten, weil Karla die Noten einer Fassung von Chopin hatte, und Gudrun hatte gesagt, romantische Musik liege ihr nicht, und als ich hereinkam, verspielte sie sich, klatschte errötend in die Hände und rief: „Es hat einfach k-k-k-keinen Zweck!“
Skudde
Ich entstamme einer der ältesten Schafrassen, und wäre ich ein Mensch, so hieße ich mit Sicherheit von Skudde, oder sogar Freifrau von Skudde, hätte einen oder mehrere hübsche Vornamen, z.B. Birute Neringa, ja, da staunt ihr, was? Meine Vorfahren stammen nämlich aus Litauen, wir sind klein und anspruchslos, fressen zur Not auch Disteln, Brennnesseln und Schilf, man konnte uns auf ärmlichsten Böden halten, auf denen nicht ein Halm Roggen wuchs – aber uns verdross das nicht, und weil wir wenig Fleisch auf den Rippen haben, ließ man uns lange leben und begnügte sich mit unserer fusseligen Wolle, und um die geht es mir, denn in ihr habe ich mich überlebt. Aber zunächst einmal: Was verschlug uns von Litauen und Ostpreußen, wo wir jahrhundertelang Wiesen und Weiden gepflegt hatten, nach Sachsen? Größere, woll- und fleischreichere Rassen hatten uns verdrängt, nur noch ein paar Liebhaber unserer Art sorgten dafür, dass wir leben und Lämmerchen gebären konnten, und einen von ihnen, einen waschechten Baron, verschlug der Krieg von seinem Gut Dumala nach Dresden, dorthin nahm er auf dem Panjewagen, auf dem er reiste, meine Ururgroßmutter mit, und da er nicht wusste, wovon er leben sollte, bot er ihre Wolle der Filzerei und Strumpfwirkerei Lieberwirth an, wo mich die Tochter des Hauses höchstpersönlich wusch, kämmte und unter einem Wasserstrahl in wunderschönen weißen Filz verwandelte, und der wurde, nun, ihr habt es schon erraten, an eine Fabrik verkauft, die Klaviere und Flügel herstellt, aus mir wurden die Dämpfer geschnitten, die es dem Spieler, der Spielerin erlauben, leiser zu spielen oder auch einen nachklingenden Ton jäh zum Verstummen zu bringen. Leider wurde der Blüthner, in dem ich dämpfe, weit, weit fort nach Himmelstein verkauft, und da bin ich nun immer noch, dämpfe mal Bach, mal Beethoven, und zu den Freuden meines Alters gehört es, dass seit einiger Zeit Minna Lieberwirth mit mir dämpft – sie weiß es nicht, dass wir uns kennen, ich weiß nicht, wie sie nach Himmelstein kam, aber ich dämpfe für sie mit einer Akkuratesse und einem Gefühl, dass ihre Lehrerin schon mal sagte: „Minna, wenn Du spielst, kommt mir der Blüthner vor wie neu geboren!“
Der Zeitungsausschnitt
Herbert hatte, auf seine Unterrichtsstunde wartend, wieder das Buch mit den Bildern Schieles herausgezogen. Er genoss den Anblick des schwarzhaarigen Mädchens mit hochgeschlagenem Rock, während Gudruns Klavierspiel in sein Ohr eindrang, eine Zweisinnigkeit, die ihn zugleich froh und auf sich selbst zornig machte. War seine Beziehung zu Gudrun nicht rein musikalischer Art, was hatte physische Weiblichkeit dazwischen verloren? Er wandte die Augen von dem Bild ab – und sein Blick fiel auf einen Ausschnitt aus dem Himmelsteiner Volksfreund, den Karla Janssen auf dem verschlissenen Sofakissen liegen gelassen hatte. Für ihn? Ja, für ihn, denn darin war von seinem Vater die Rede – er wurde interviewt:
Necenna = Himmelstein?
Seit einigen Tagen erschüttert ein Streit um die Anfänge unserer Stadt die Gemüter. Er wurde ausgelöst durch einen Artikel von Dr. Emil Eisenpflicht, Kustos der slawischen Abteilung im Landesmuseum, in den Blättern für sächsische Geschichte. Chefredakteur Wittkowski sprach mit dem Autor.
Wittkowski: War Ihnen klar, welch einen Sturm im Wasserglas Ihr Artikel „Himmelstein ist das Necenna der Wenden“ auslösen würde?
EE: Nein, das hat mich überrascht. Immerhin liegen diese Vorgänge 900 Jahre zurück.
W: Aber für viele Bürger macht es eben einen großen Unterschied, ob sie in einem Ort slawischen oder sächsischen Ursprungs leben.
EE: Das verstehe ich nicht. Slawen und Sachsen sind einander doch absolut gleichwertig.
W: Da gehen die Meinungen eben auseinander. Aber gehen wir auf die Details ein. Inwiefern soll Necenna den Namen Himmelstein vorwegnehmen?
EE: Es ist eine Latinisierung, in der sich zwei wendische Wörter verstecken: nebe für Himmel und kamen für Stein. Es ist auch nach den Grabungsfunden anzunehmen, dass sich, bevor die Sachsen ihre Festung auf dem Himmelstein errichteten, zuvor schon eine wendische Burg darauf befand.
W: Und verstehen Sie, dass Ihre Forschungen Pastor Westfal, der einen wütenden Leserbrief geschrieben hat, wie eine Einladung an Russland erscheinen, auch Himmelstein in seinen Einflussbereich einzubeziehen?
EE: Russland habe ich durch meine langjährige Gefangenschaft gut kennen zu lernen Gelegenheit gehabt. Es ist saturiert und hat Probleme genug mit seinen Satelliten und der Ostzone, die sich seit einigen Jahren DDR nennt. Für eine Grenzverschiebung bedürfte es eines Krieges, und von dem sind wir Dank Eisenhower und Chruschtschow weit entfernt. Außerdem ist völlig klar, Himmelstein ist eine sächsische Gründung, aber eben auf slawischen Ruinen.
W: Pastor Westfal hat gefordert, die slawische Abteilung im Museum zu schließen.
EE: Pastor Westfal soll mal ganz schön still sein. Er hat in SA Uniform von der Kanzel herunter gepredigt, Jesus sei ein Arier gewesen. Für mich ist es unfassbar, dass die Kirche solche Scharlatane weiter beschäftigt, statt ihnen die Ordination zu entziehen (von Karla Janssen dick mit Bleistift unterstrichen).
Herbert ließ das Blatt sinken. Warum hatte Emil sen. nie von dieser Auseinandersetzung gesprochen? Auch in der Schule war bisher nichts davon angekommen. Aber vielleicht war dies nun endlich ein Thema, auf das Gudrun einmal eingehen musste. Karla Janssen würde gleich mit ihr durch die Bibliothek hinausgehen, er wollte sie einfach fragen: Was sagst du zum Streit unserer Väter? Aber sie wählten den anderen Weg zum Flur, und als Karla hereinkam, sagte sie beiläufig: „Ich fürchte, du musst zu Manfred als Begleiter zurückkehren. Gudrun hat mir mitgeteilt, ihr Vater wolle nicht, dass ihr zusammenspielt. Ich sehe, du hast das Interview gelesen. Was dein Vater sagt, kann ich voll und ganz bezeugen. Gudruns Vater hat sich mit zelotischem Eifer für die Deutschen Christen eingesetzt. Auch ich finde, dass er in seinem Amt nichts mehr zu suchen hat. Komm, wir nehmen uns dies hier vor: Ein Divertimento von Bononcini, dem Rivalen Händels in London, sehr melodiös und gefällig!“
Braun SK4
Für ein Gerät wie mich macht es einen großen Unterschied, in was für eine Familie man kommt. Wenn da schon ein Plattenspieler war, ist man nur eine Steigerung. War da noch keiner (und das war in der Familie Eisenpflicht der Fall), ist man eine Sensation. Mit welcher Inbrunst hat die gesamte Familie der Kleinen Nachtmusik gelauscht – in meiner astreinen Präsentation in 45 Umdrehungen! Mit welcher noch größeren Inbrunst der Arie „Schöne Nacht, o Liebesnacht!“ Damit hörten aber die Gemeinsamkeiten schon auf. Wenn Emil sen. allein war, legte er mit Vorliebe die Arie „Sie hat mich nie geliebt!“ auf. An wen er bei „sie“ dachte, konnte ich als schlichtes Wiedergabegerät natürlich nur ahnen. War es seine Frau Vilma? Immerhin hatte sie ihm zwei Söhne geboren – kann man einem Mann zwei Söhne „schenken“, ohne ihn zu lieben, gleichsam nur als Pflichttribut der Ehelichkeit? Oder hatte Emil sen. eine große außereheliche Liebesenttäuschung erlebt? Womöglich während seiner Gefangenschaft? Vilma ihrerseits legte mit Vorliebe den Walkürenritt auf, wenn sie allein war und ihr Mann sie dafür nicht verspotten konnte, z.B. mit der Bemerkung, richtige Walkürenbeine habe sie ja schon. Sie hatte einmal Schauspielerin werden wollen, aber Ehe, Kinder und Krieg hatten ihr diese Flausen ausgetrieben. Emil liebte die Soli eines Jazztrompeters, ob er ihn wirklich so gern hörte? Oder wollte er seinem Bruder Herbert nur zeigen, was für ein kümmerliches Blasinstrument eine Blockflöte ist? Selber athletisch gebaut, machte er sich auch gern über Herberts „Streichholzarme“ lustig und dass er wie ein nasser Sack am Reck hinge, während er, Emil, schon einen halben Riesen turnte. Herbert hatte durch eine Radiosendung des NWDR, von mir auf UKW rauschfrei empfangen und wiedergegeben, die Sonatine von Ravel entdeckt, und die konnte er gar nicht oft genug hören, vor allem den ersten Satz, dessen Thema ihn nicht mehr losließ, als sei es von ihm selbst komponiert. Dann aber betrat ein Mädchen die Szene, das die Familie Eisenpflicht fast gesprengt hätte, Elsi, eine Bauerntochter aus Rabenschlade, blond, robust, wortkarg und ein bisschen begriffsstutzig. Sie fegte, saugte die Teppiche, wusch ab, schälte Kartoffeln, aber wenn sie einmal allein war, alle Eisenpflichts waren außer Haus, legte sie eine Platte auf mich, die mein Maschinenherz fast zerriss. Die vergaß sie eines Tages auf meinem Plattenteller. Familie Eisenpflicht hörte sie sich an – und war ebenso verstört wie entsetzt von „Rock around the clock“. „Solche Klänge kommen uns nicht ins Haus!“, sagte Vilma, die blass geworden war, Emil sen. pflichtete ihr bei, die beiden Söhne aber meinten, Elsi solle Gelegenheit gegeben werden, sich zu rechtfertigen. Elsi rechtfertigte sich damit, dass alle diese Musik momentan hörten und vor allem eins täten: Danach tanzen. Wie man danach tanzen könne, wollten Emil sen. und Vilma wissen. Elsi führte es mit Emil jun. vor, dem diese Tanzstunde sichtlich Spaß machte, auch wenn er sich zu Anfang etwas linkisch anstellte, und auch Herbert ließ sich in dem ausgetüftelten Fern-Nah und Gekreisel unterrichten. Es war eine Musik, die den Gegensatz zwischen Alt und Jung erbarmungslos aufriss, aber ich, Braun SK 4 meines Zeichens, bin daran völlig unschuldig, ich versetze jede Platte in Drehung, egal, was sich in ihren Rillen verbirgt – und eine Brücke zwischen Jung und Alt deutete sich an, als Emil sen. eines Tages zugab, Elsi tanze mit der Anmut einer Russin, die ihn in Nowgorod – zu völlig anderer Musik freilich – mit dem Taschentuchtanz bezaubert habe.
Oase
Es begann nun eine andere Zeit. Mit Manfred wollte Herbert nicht zusammenspielen, warf die Blockflöte in die Ecke, wollte nur noch Ravel hören, Karla Janssen und ihr Blüthner verschwanden am Horizont. Aus der Schule kommend, folgte er Klassenkameraden, die ihn zu einer Runde am Flipperautomaten in der Oase aufforderten, begann Zigaretten der Marke Eckstein zu rauchen und Bier zu trinken, und musste sich daran gewöhnen, dass Emil ihm als leuchtendes Vorbild vor Augen gehalten wurde, der all dies nicht tat. Manfred hatte über Herbert in Umlauf gesetzt, er sei ein Stricher, und dadurch sah er sich gezwungen, sich eine Freundin zuzulegen, und obgleich ihm das wie Verrat an Gudrun erschien, fragte er Elsi an, ob sie mit ihm gehen wolle. Sie lächelte breit und verlegen und sagte dann, sie sei doch mit Holger verlobt, ob er das denn nicht wisse. Holger war ein zäher, kleiner Bursche, der die Balken, die er als Zimmermann tragen musste, als Knüppel bezeichnete – Herbert wurde klar, wie wenig er mit seinen Streichholzärmchen zu bieten hatte, überhaupt kam er sich so erbärmlich und wertlos vor, dass er sich eines Abends, mit einem dicken Mädchen namens Isabel in der Oase um die Wette flippernd – sie schlug ihn dauernd – völlig betrank und am nächsten Morgen, in ihrem Bett aufwachend, furchtbar schämte, aber sie tröstete ihn mit den Worten: „Du warst richtig gut!“, nahm ihn in ihre fleischigen Arme, küsste seine Brust, zupfte an einem ersten schwarzen Haar und sagte: „Vielversprechend!“ Obgleich er den Spott darin spürte, fühlte er sich aufgerichtet und fragte Isabel, ob sie mit ihm gehen wolle. „Ich gehe mit niemandem,“ sagte sie, und man merkte, es tat ihr leid, Herbert zu enttäuschen, „ich hatte einmal einen eifersüchtigen Freund und bin froh, ihn los zu sein, nie wieder!“ Sie war Maschinenbedienerin in der Schuhwichsefabrik „Gloria“ aus preußischer Zeit, und Herbert flipperte noch ein paarmal mit ihr und landete noch ein paarmal in ihrem Bett, hörte aber damit auf, als er wegen Schmerzen beim Wasserlassen Dr. Noor aufsuchen musste, den Himmelsteiner Hautarzt. „Wo hast du dir das denn geholt?“, fragte der Doktor, und als er den Namen Isabel hörte, lachte er: „O, dieses verflixte Gonokokkenmutterschiff! Schon seit einem halben Jahr war sie bei mir nicht mehr zur Kontrolle!“ Und zum Abschied schenkte er Herbert ein Gedichtbändchen mit der Bemerkung: „Von meinem Berliner Kollegen! Viel Spaß!“
Vilma
Was für ein süßer und strebsamer, freundlicher Junge Herbert war! Aber neuerdings entzieht er sich zunehmend unserer Kontrolle, kommt nach Hause, wann er will, gibt sein Taschengeld für Bier und Zigaretten aus und musste wegen einer unaussprechlichen Krankheit nun sogar zum Arzt … Wir Eisenpflichts erfreuten uns bis dato in Himmelstein eines makellosen Rufs, aber der ist nun dahin, denn wenn ich auch an Dr. Noors ärztlicher Verschwiegenheit nicht den geringsten Zweifel hege – Herbert sagt, das Wartezimmer sei gestopft voll gewesen, er sei mit vollem Namen aufgerufen worden, und Eisenpflicht ist nun mal kein Allerweltsname; Frau Flöl, zu der ich wegen eines Strumpfgürtels musste, fragte schon ganz beiläufig und hinterhältig, ob es Herbert wieder besser gehe. Er sei gar nicht krank gewesen, wie sie darauf komme? Sie benannte eine Dame, wenn man sie Dame nennen kann, denn sie steht in der Oase hinter der Theke, mir blieb nur, mit den Schultern zu zucken. Aber schlimmer ist noch, dass er nun mit allen anderen seines Jahrgangs in diesen Film getrieben wurde. Ich begreife nicht, dass man den 16Jährigen einen Film zumutet, der uns Deutschen wieder mal alles Böse in die Schuhe schiebt. Herbert ist völlig durch den Wind, seit er diesen Film gesehen hat, der natürlich aus Frankreich kommt, dort hat man uns schon immer gehasst. Er läuft treppauf, treppab, auf den Boden, in den Keller, durchwühlt alle Schränke, ich frage ihn, was er sucht, er sagt: „Das Kissen, das ich hatte, als ich drei war!“ Warum er das suche, frage ich ihn, und er sagt: „Weil ich glaube, dass ich Recht hatte! Erinnerst du dich nicht mehr, wie ich schrie, als ich entdeckte, dass Haare darin waren?“ Das fiel mir wieder ein, ja, es war schrecklich, was für einen Terz Herbert machte, immer zeigte er mit spitzem Fingerchen auf das Haar, das aus der Ritze des Kissens quoll, und schrie und schrie und war gar nicht wieder zu beruhigen. Ich konnte ihm tausendmal sagen, dass es Rosshaar sei, vielleicht kannte er das Wort Ross noch nicht, er hatte ein Steckenpferd, ich hätte Pferdehaar sagen sollen, er wollte partout seinen Kopf nicht wieder darauflegen, und da habe ich ihm ein anderes gegeben, und das Rosshaarkissen habe ich ausrangiert, ich glaube, es ist in den Müll gewandert, das sage ich Herbert, und Herbert sagt, er sei sicher, dass es Menschenhaar gewesen sei, er habe in dem Film einen Berg von Haar gesehen, das man den Frauen abgeschnitten habe, bevor sie ins Gas getrieben wurden, zwar nur in Schwarzweiß, nach seiner Erinnerung sei das Haar in dem Kissen brünett und es sei Menschenhaar gewesen, da sei er sich ganz sicher, deshalb habe er sich davor so geekelt, und es sei jammerschade, dass ich dies Beweisstück vernichtet hätte. Der Junge entgleitet mir, was soll ich bloß tun? Emil beruhigt mich und sagt, wir müssten uns den Realitäten stellen, aber bestimmte Realitäten, wenn es denn welche sind, lasse ich nicht an mich heran.
Der alte Eichbaum (2)
Soll ich von denen berichten, die bei Kriegsende als Fahnenflüchtige an mir aufgehängt wurden, nur weil sie sich weigerten, in einem sinn- und chancenlos gewordenen Endkampf verheizt zu werden? Oder von denen, die diese Urteile gefällt hatten und sich nun an mir aufhängten, weil sie als Komplizen eines verbrecherischen Haufens von den Siegern keine Gnade zu erwarten hatten? Nein, das ist alles zu traurig, davon schweige ich, meine Blätter rauschen und lispeln es weg, lieber freue ich mich am Gedeihen meiner Freundin, der Linde, berausche mich am Duft ihrer Blüten und beobachte die Dramen, die sich auf dem Pausenhof unter mir abspielen. Da ist ein Sportler von schön ausgebildeter Gestalt, dem zugleich der Ruf nachgeht, ein guter Klavierspieler zu sein, nun, aus ihm ist ein Casanova geworden, dieser Name ist mir aus Venedig zugeflogen, was für ein Jammer, dass die Menschen zweihäusig sind! Die Mädchen, die sich eigentlich vor ihm hüten sollten, fliegen ihm reihenweise zu, wollen von ihm und keinem anderen bestäubt werden und bilden die von Stolz und Eifersucht durchrüttelte Gruppe der vom gekörten Zuchtstier Bestiegenen. Und gekört ist er, seit er Landesmeister im Zehnkampf wurde, und nun reißen die Jungs sich darum, seine Nachfolge bei den Enttäuschten und Weinenden anzutreten, die getröstet und mit einer Treue und Zuverlässigkeit verwöhnt werden müssen, zu der er, der Vielbeneidete und Vielverhasste, nicht fähig ist. Am meisten leid aber tut mir der Junge, der meine Freundin, die Linde, einmal so schön und gerade gezeichnet hat. Nicht nur sein damaliger, so ermutigender Lehrer hat ihn verlassen, auch ein Mädchen, das er wie kein anderes angestaunt und mit den Augen verschlungen hat. Sie hat nichts von ihm wissen wollen, weil sie Schwierigkeiten genug hatte – denn sie konnte das nicht, was wir Bäume zum Glück nicht können müssen: Sprechen, und zwar fließend. Unsere Sprache erzeugt der Wind, weht er nicht, sind wir stumm, aber die Menschen müssen sie selbst erzeugen, und wenn ihnen das nicht ordentlich gelingt, werden sie verspottet, verlacht und nicht ernst genommen. Nun, sie hat trotz ihrer Sprachbehinderung die Schule mit einem sehr guten Zeugnis abgeschlossen und ist außer Landes gegangen, um zu studieren. Sie hat sich vorgenommen, Wunden heilen und Krankes herausschneiden zu können, sie will eine Chirurgin werden, und ihr Verehrer hat sich ein paar anderen Jungs angeschlossen, die wie er ein Buch lesen und aus ihm zitieren, Worte, die ich nicht verstehe, die aber ein merkwürdig raunendes Verstehenwollen in mir erzeugen:
„Ein Wort, ein Satz -: aus Chiffren steigen
erkanntes Leben, jäher Sinn,
die Sonne steht, die Sphären schweigen,
und alles ballt sich zu ihm hin.“
Zwanzig Jahre später (2)
Frau Pokraka war gestorben, ich hatte viele gute Schüler verloren, aber damit fand ich mich ab, denn es kamen wieder neue, doch eine Gudrun, das war mir klar, würde ich so bald nicht wieder bekommen. Aber da geschah etwas Unglaubliches. Mit einer Flasche Rotwein in der Hand stand sie eines Julitages in der Tür, lachte übers ganze Gesicht und stellte mir die Frage: „Kennen Sie mich noch?“ Und im gleichen Moment fiel sie mir um den Hals, ja, dies war einer der schönsten Momente meines Lebens. „Natürlich, Gudrun!“ Sie wurde ernst, schob mich zurück: „Nenne mich nie wieder bei diesem Namen! Seit vier Wochen weiß ich, wer ich bin: Lea Wolf, die Tochter von Glückl!“ Ich war so perplex, dass ich zurückwankte in die Bibliothek und wie angeschossen aufs Sofa sank. Sie setzte sich neben mich, stellte die Weinflasche auf den Sofatisch neben die Salzstangen und sagte, nun wieder lächelnd: „Hast du es denn nicht geahnt? O, jetzt habe ich dich geduzt, darf ich beim Du bleiben? Du nickst … Habe ich nicht mehrfach das dritte Bein des Blüthner umarmt? Was hast du gedacht, warum ich das tue?“ „Ich hielt es für eine Huldigung an das Instrument, auf dem du so brillant warst!“ „Ich war zwei, als Glückl mich weggab, weggeben musste, um sich selbst zu retten, hier, in dieser Wohnung war ich klein gewesen, an den schwarzen Beinen des Flügels habe ich mich aufgerichtet, von ihnen aus erste Schritte gewagt … Ich konnte sie nicht ansehen, ohne Dank und Zärtlichkeit zu empfinden.“ Ich war so erschüttert, ich musste mich an etwas Praktisches klammern, ich ergriff die Weinflasche, ging damit in die Küche, entkorkte sie und, schrecklich, mein erster Gedanke war: Muss ich hier jetzt ausziehen? Das Haus an seine wahre Eigentümerin zurückgeben? Mit der entkorkten Flasche und zwei Gläsern kehrte ich zu Lea zurück, sie war an den Flügel gegangen und spielte Bachs Erste Invention … Ich hörte ihr zu, dann umarmte ich sie und murmelte: „Lea … Lea Wolf. Glückls Tochter … Unfassbar!“ Dann goss ich uns ein, wir prosteten einander zu und sie sagte: „Masel tov!“ Und ich: „Mein Haus ist dein Haus!“ Sie lächelte ein herrliches, erlöstes Lächeln, küsste mir die Hände und sagte: „Hände – wie von Elly Ney!“ „Vergleiche mich nicht mit ihr. Führerhörig wie sie bin ich nie gewesen. Aber sag mir – wie kommt ein derart fanatischer Nazi wie dein Vater dazu, ein jüdisches Mädchen zu retten?“ „Ich war seine Rückversicherung. Er war fanatisch, aber auch schlau. Er wusste, dass es schief gehen konnte – und dass ich dann gut zu gebrauchen war. Und so ist es auch gekommen. Die Pfadfinder haben Druck gemacht, sie wollten nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten – weil er sie zu paramilitärischen Übungen zwang und Lieder wie ‚Jenseits des Tales standen ihre Zelte‘ singen ließ– von einem Textdichter, der ihrem Liebling Gottfried Benn das Leben zur Hölle gemacht hat. Die obere Kirchenleitung wollte ihn loswerden – da hat er mich als seinen letzten Trumpf aus dem Ärmel gezogen.“ Ich konnte nur noch den Kopf schütteln. „Soll ich Herbert Eisenpflicht anrufen, damit er mit uns feiert?“ „Er weiß es schon. Er ist doch bei den Pfadfindern und hat herausgefunden, wer Börries von Münchhausen war.“ Und dann kam eine Bitte, die ich meiner Lieblingsschülerin nur allzu gern erfüllte: „K-k-kann ich bei dir bleiben, Karla? Ich möchte zu meinen Eltern nicht zurück.“ So hatte ich Lea Wolf, ehemals Gudrun Westfal, für die Dauer ihres Studiums als neue Mieterin. Ihre Miete: Monatlich ein 50-Pfennig-Stück, das mit der Gärtnerin, die eine Eiche pflanzt.
Lea
Lieber Herbert, Pastor Westfal ist ein Feigling. Er hat es mir nicht mal selber gesagt! Vorm Disziplinargericht ist er damit herausgerückt, dass er mich bei sich aufgenommen hat – und dass ich jüdisch bin. Meine unterm Parkett versteckte Geburtsurkunde hat er vorgelegt. Der Effekt ließ nicht auf sich warten: Die Untersuchung gegen ihn wurde eingestellt. Die Unterstellung, er sei ein Nazi, ein Wolf im Schafspelz, sei angesichts dieser Tatsache eine Absurdität. Ich bin zerrissen zwischen Dankbarkeit, denn ich konnte bei ihm aufwachsen – und Hass – denn er gehörte zu denen, die meine Eltern und Großeltern ermordet haben – nicht ohne ihnen vorher noch furchtbare Leiden zuzufügen. Aber das Schlimmste ist der Sturz hinaus aus einer christlichen Glaubenswelt in ein jüdisches Universum, das mir fast völlig unbekannt ist. Juden, an die ich mich wenden könnte, gibt es in Himmelstein und an der Uni keine; aber Klara hat mich bei sich aufgenommen – in das Haus, das meiner Familie einmal gehört hat. Ich habe zu Jesus Christus, Gottes Sohn, beten gelernt, der von den Juden ermordet wurde – und jetzt gehöre ich dem Volk seiner Mörder an. Haben sie denn nicht vielleicht mit Recht dafür gesorgt, dass er hingerichtet wurde – weil er ein Aufrührer war, der den Widerstand gegen die Besatzungsmacht schwächte? Mit solchen Überlegungen schlage ich mich herum – und verbringe viele Stunden in der Bibliothek, aber das macht mich nur noch ratloser. Zum Glück habe ich Dich, lieber Herbert. und Du rätst mir immer wieder: „Kümmere dich nicht um die Religion! Nicht Gott hat den Menschen, sondern der Mensch hat Gott erschaffen. Es gibt nur einen, der die Wahrheit gewusst und ausgesprochen hat: Baruch Spinoza. Er hat die Natur mit Gott gleichgesetzt. Dafür ist er aus seiner jüdischen Gemeinde verstoßen worden.“ Das ist es, was du mich lehrst, und ich wünschte mir nur, Du beließest es dabei, aber ich sehe in Deinen Augen einen Hunger, der mir Angst macht und der alles zwischen uns zerstören könnte. Ich kann Dich nicht lieben, ich weiß ja kaum noch, wer ich selber bin! Ich fliege in den Semesterferien nach Tel Aviv, da lebt Walter Koch, ein entfernter Vetter, von diesem Besuch erhoffe ich mir eine Festigung in meiner neuen Identität, vor allem will ich Ivrith lernen – aber ich kehre zurück und wir spielen wieder zusammen, Karla Janssen hat gesagt, der Graf von Ostost möchte uns spielen hören – stell Dir vor, wir beide im Rittersaal seiner Burg auf dem Himmelstein! Ich freue mich drauf – Lea Wolf
Die Juweleninsel
Die Aufführung von „Nacht und Nebel“ im Kino „Harmonie“ hat in Himmelstein ein wütendes Schweigen ausgelöst, denn wenn die Himmelsteiner auch nicht antisemitischer sind als der Durchschnitt der Arier, haben sie doch gern und schnell zugegriffen, als sich zeigte, dass sie aus der Deportation ihrer jüdischen Mitbürger durchaus Vorteile ziehen konnten, und sogar die kluge und verehrungswürdige Karla Janssen wohnt, wie mir Herbert berichtet hat, im Haus einer Familie Wolf, deren Schicksal unbekannt ist. Sie und das gute Dutzend anderer, die ihr Haus unter Wert von Strohmännern „gutgläubig“ erworben haben, fürchten nun, dass dieser Erwerb angezweifelt werden könnte, und verschanzen sich sorgenvoll in ihrem Besitz. Hinzukommt, dass ich die Himmelsteiner, eine kernige Mischung aus sächsischen und fälischen Bauern, gegen mich aufgebracht habe durch meinen Hinweis darauf, dass hier einmal Wenden zu Hause waren. Ich sprach mit unserem Buchhändler über die Lage und beklagte, dass Himmelstein in der Literatur nur so geringfügige Spuren hinterlassen habe, ob er nicht Texte kenne, die das zerkratzte Selbstbild der Himmelsteiner ein wenig restaurieren könnten. Er senkte betrübt seine erstaunlich beweglichen Ohren – aber dann richtete er sie plötzlich auf und sah mich freudig an: „Ich glaube fast, meine liebe Frau könnte da hilfreich sein. Sie hat ein zerlesenes Bändchen aus dem vorigen Jahrhundert, und darin ist von Himmelstein die Rede, und für sie, so sagte sie, war dieses Romänchen mit dem Titel ‚Die Juweleninsel‘ sogar einer der Gründe, der Werbung eines Himmelsteiners durchaus aufgeschlossen gegenüberzustehen. Meine Frau ist eine geborene Lieberwirth aus Kötzschenbroda, Tochter eines früheren Strumpffabrikanten, der sich seit seiner Enteignung ein kümmerliches Leben als Tänzer des Balletts der Semperoper verdient. Aber da kommt sie ja – sie kann es Ihnen selber erzählen!“ Die Türglocke klingelte und die reizende Minna trat ein – was für eine hübsche Frau – und geschmackvoll und kühn in ein rotgeblümtes Sommerkleid mit Bolerojäckchen und einem kecken Hütchen gekleidet. „Stell dir vor, ich habe der Bäckersfau vorgeschwärmt von unserer Eierschecke, die es hier nicht gibt, und nun soll ich ein Probeblech für sie backen, sie will sehen, wie sie bei den Himmelsteinern ankommt. Grieße Sie, Herr Eisenpflicht, Sie sind sicherlich der Vater von dem jungen Einstein!“ Nun, ich gebe zu, in Himmelstein wird über Minna Lademann gelästert, sie sei ein billiges Mitbringsel aus der Zone – das ist sie keinesfalls, sie ist eine bemerkenswerte Frauenpersönlichkeit, und ich bin gespannt, ob sie das zerlesene Romänchen mitgebracht hat!
Schach
Die Oase und das Flippern mied Herbert, aber für die Schule zu arbeiten, gefiel ihm auch nicht, obgleich es verdammt nötig gewesen wäre, denn die Abiturprüfung rückte immer näher, er hätte eine Charakteristik von Hektor schreiben müssen, aber Hektor war ihm Hekuba, und so beschloss er, nachdem er im Gasthof zum Bären Schachspieler beobachtet hatte und fasziniert war von ihrer schweigenden Versenkung in Abläufe, die er nicht verstand, Schachunterricht bei Herrn Kalkar in der Höllenmühle zu nehmen, einer alten Wassermühle, die in einen Jugendtreff umgewandelt worden war, nachdem sie achtzig Jahre leer gestanden hatte, weil das Getreide aus Wirtschaftlichkeitsgründen in die Dampfmühle neben der Schuhwichsefabrik zum Mahlen gebracht wurde. Das gewaltige alte Räderwerk, die gigantischen Mühlsteine waren immer noch zu besichtigen, aber nun waren Tische in den halbdunklen Arbeitsräumen aufgestellt, und Inspektor Kalkar, beruflich als Ermittler in Betrugsfällen im Polizeipräsidium tätig, führte in das von ihm virtuos beherrschte Schachspiel ein. Wie gut er es beherrschte, war zu ersehen aus seinem Titel als Himmelsteiner Stadtmeister, den er souverän mit acht Siegen gegen seinen Vorgänger erobert hatte – und er begann mit der Eröffnungslehre. Herbert verbiss sich in die Spanische Eröffnung, die ihm auf ähnliche Weise gefiel wie die Sonatine von Ravel: Aus rätselhaften Gründen schien sie seinem Charakter nicht nur zu entsprechen, sondern ihn geradezu abzubilden. Der kühne Läuferzug, der den gegnerischen Springer fesselt, begeisterte ihn, dann mit Hilfe der Rochade und eines unauffälligen Turmzugs dem Schwarzen die Dame abzuluchsen, gelang ihm immer wieder, und als der Exstadtmeister einmal dabei zusah, knurrte er: „Der Junge hat Talent, Kalkar, den merken wir uns!“ – und bald schon saß auch er abends bis in die Puppen im Gasthof zum Bären und rang mit einem alten längst pensionierten einäugigen Studienrat, der einen ganzen Strauß tückischer Züge in petto hatte. Z.B. Herbert spielte den Königsbauern und freute sich auf den Läuferzug, aber der alte Engelbrecht ließ minutenlang seine welke Hand über dem Brett rütteln, und Herbert sah sich plötzlich der Jagdvariante eines Russen namens Aljechin ausgesetzt, von dem Engelbrecht sagte: „Er hat uns auch in schlechten Zeiten die Stange gehalten und sich klar gegen die Verjudung des königlichen Spiels in Stellung gebracht!“, und dabei nahm er das Glasauge heraus, putzte es und drückte es in die Höhle zurück. Im Bären wurde nicht weniger Bier getrunken und geraucht als in der Oase, auch Engelbrecht bot ihm einmal, als es drei Uhr morgens war, sein Bett an, aber Herbert schaffte es mit knapper Not in sein eigenes, nicht ohne, an der wolfschen Villa vorbeikommend, zu sehen, wie der große Blüthner trotz der nachtschlafenen Zeit in einen Speditionslaster gewuchtet wurde. Zu seiner Überraschung entdeckte er, dass sein Vater ebenfalls Schach spielte; in Nowgorod hatten sie Schachfiguren aus Zeitungspapier mit Spucke zusammengepappt, später mehrfach mit anonymen russischen Meistern simultan gespielt, auf einem Zeitungsfoto habe er einen von ihnen erkannt: „Es muss Botwinnik gewesen sein, der jetzige Weltmeister, die Stirnglatze, die starken konkaven Brillengläser. Keine Ahnung, warum er uns beehrte; ich nehme an, er hoffte auf Nuggets, das sind abseitige Zugideen, wie sie nur Amateure hervorbringen.“
Das Flugblatt
Öffentliche Lesung mit Musik
„Himmelstein“ von Karl May
Ein apokrypher Text aus seiner Jugend
Es liest: Minna Lieberwirth aus Kötzschenbroda
Wissenschaftliche Begleitung: Karl Lademann
Es spielt auf dem Leipziger Blüthner von 1922: Karla Janssen
Musik: Sonatine von Ravel
Ort: Rittersaal von Burg Himmelstein
Zeit: 11. August 19.30 Uhr
Alle sind willkommen! Platz ist genug!
Es lädt ein: Graf Ludolf von Osten
Spenden sind willkommen!
Ich, Ludolf von Osten
Das Lazarett von Mariupol ist es, das uns gelegentlich zusammenführt. Vater hat dort gelegen, nachdem er mit seiner treuen Lotte auf eine russische Kastenmine geritten ist, Kustos Eisenpflicht hat seinen Beinbruch dort ausgeheilt und Vater, ungleich schwerer betroffen, war sein Bettnachbar, so dass Eisenpflicht mir seine letzten Worte überbringen konnte: „Lies Karl May!“ Waren das wirklich seine letzten Worte? Hat er nicht vielleicht „Spiel Schalmei!“, gemurmelt? Denn die Schalmei war sein Lieblingsinstrument. Ich habe die Werke des sächsischen Vielschreibers durchforscht und unterhaltsame Spannung gefunden, aber nichts, worauf er sich bezogen haben könnte oder was mich besonders betraf. Und nun überbringt Eisenpflicht mir eine Schilderung Mays von meinem Domizil, die so zutreffend ist, dass ich sie publizieren muss – aber wo? Im Himmelsteiner Volksfreund? Das genügt nicht – sie muss öffentlich verlesen werden, aber von wem? Von Gustav Gründgens, der schon mehrfach mein Gast war und mit unglaublichen Rezitationen glänzte? Er rief zurück, er habe keine Zeit, er sei mit der Rolle des Mephisto so ausgelastet, dass er leider absagen müsse. Und die Flickenschildt? Von dieser maßlos überschätzten Selbstdarstellerin will ich mir keinen Korb holen. Aber Eisenpflicht hat eine Alternative: Warum nicht die Buchhändlersfrau, die das vergessene Jugendwerk Mays entdeckt hat? Minna spricht kein akzentfreies Hochdeutsch, aber sie ist Sächsin wie May – und außerdem, wie ich mich in der Buchhandlung habe überzeugen können, eine reizende Person; allerdings zierte sie sich lange, und erst nachdem ich sie einmal durch mein Gemäuer geführt und ihr gezeigt habe, wie der allgegenwärtige und fortschreitende Verfall mich drückt, da ich ständig ausbessern, retten, stützen und mit Mauerankern befestigen lassen muss, hat sie erkannt, dass sie mir einen Gefallen tut, wenn sie einen Beitrag leistet zu einer Veranstaltung, die sicherlich einiges an Spenden einbringen wird, zumal es mir auch gelungen ist, für musikalische Begleitung zu sorgen: Zwar leider nicht von der Himmelsteiner Schalmeienkapelle, denn die sind alle gefallen, aber Karla Janssen wird Ravel spielen auf ihrem Bechstein – nein, um Himmels willen, auf ihrem Blüthner, denn der Name Bechstein ist … Lassen wir das! Wie gut, dass ich zu spät geboren bin, um Nazi zu werden, sonst wäre ich jetzt womöglich Gauleiter von Böhmen/Mähren, habe es zum Glück aber nur zum Flakhelfer gebracht, und dann war es aus mit der Ganovenbande, die sich so blendend mit Idealen tarnte!
Minna Lieberwirth
Wie ich den Text entdeckt habe, hat Karl Lademann erzählt, und er hat auch nicht versäumt, darauf hinzuweisen, dass wir ohne die Juweleninsel wohl nie zusammengefunden hätten. Als ich die Lehre zur Strickerin in Papas Firma begann, langweilte ich mich unsäglich und las alles, was mir an Gedrucktem unter die Augen kam. Auf dem Dachboden in Kötzschenbroda fand ich viele, teils sehr gewagte Fotos bestrumpfter Frauenbeine, weniger gewagte wohlbesockter Soldatenfüße, aber auch einen Stapel alter Zeitschriften, darunter ein gebundener Jahrgang „Für alle Welt“ und darin eine Fortsetzungsgeschichte, die mir so gut gefiel, dass ich sie herausriss und in einer Mappe zusammenheftete. Ich hatte ja keine Ahnung, dass die Burg Himmelstein wirklich existiert, und nun im prachtvoll von dem Dänen Eckersberg ausgemalten Rittersaal dieser Burg verlesen zu dürfen, wie unser Karl May, der sie wie alles, was er in seinen Büchern schreibt, nie gesehen hat, sie aber dermaßen treffsicher wiedergibt, dass man sie förmlich vor Augen sieht, das ist ein Wirklichkeit gewordener Traum! Ich begann:
„Mitten in der weiten Ebene erhebt sich ein vielfach zerklüfteter, aus gewaltigen Basaltmassen bestehender Berg, welcher mit seinem Haupte hoch in die Wolken ragt und seine Füße weit in das Land hineinstreckt, wie ein vom Himmel gefallener Titane oder ein aus dem Innern der Erde emporgeschleuderter riesiger Cyklope, der nun seit Jahrtausenden im Schlummer liegt, um von den gigantischen Kämpfen auszuruhen, die ihn vom Olympos stürzten oder aus dem Orkus an das Tageslicht hervorgetrieben haben.“
Hier unterbrach ich mich erstmals, tupfte mir die Stirn mit einem Tempo und sagte: „Bitte entschuldigen Sie meine Aussprache, aber es ist diejenige des Autors dieses Textes, es ist diejenige Karl Mays, meines über alles geliebten und zu Unrecht vielgeschmähten Landsmanns.“ Und dann fuhr ich fort:
„Auf seinem Gipfel stand seit uralten Zeiten eine Burg, die den Namen Himmelstein führte. Sie wurde niemals erobert und zerstört, denn ihre Lage machte sie vollständig uneinnehmbar. Aber der Zahn der Zeit nagte unaufhaltsam an ihren Mauern, und als sie in den Besitz des königlichen Hauses kam, war es nothwendig geworden, sie von Grund auf zu renoviren, wobei ihre Einrichtung in jeder Beziehung den Ansprüchen der neueren Zeit angepaßt wurde. Jetzt gehörte sie als Privateigenthum dem Prinzen Hugo, der ‚tolle Prinz‘ genannt.“
Hier erhob sich Graf von Osten und rief lachend: „Er kann nur meinen Urgroßvater gemeint haben, Hugo von Osten, der ein notorischer Schürzenjäger, der aber auch nie mehr als ein Graf war, das königliche Haus müssen wir Karl Mays überschwänglicher Phantasie zugute halten.“
Jetzt spielte Lea Wolf, die überraschend aus Israel zurückgekehrt und an Karla Janssens Stelle getreten war, den ersten Satz der Sonatine von Ravel, nur 20 Jahre nach der Juweleninsel komponiert. Was für eine zu Herzen gehende, in ihrer raffinierten Einfachheit fast kindliche Musik! Beifall rauschte auf, und ich, schon ganz dutzsch von der Begeisterung meines Publikums, fuhr fort:
„Tief unten am Fuße des Berges liegt zwischen üppigen Feldern und grünenden Hainen, die sich langsam zur Höhe ziehen, ein kleines schmuckes Städtchen (Beifall), einst den Rittern und Kämpen da oben zu Lehn gehörig und auch jetzt noch unter der direkten Botmäßigkeit des alten Schloßvogtes stehend, der seinem gegenwärtigen Herrn außerordentlich treu ergeben ist, von seinen Untergebenen aber mehr gehaßt und gefürchtet als geehrt und geliebt wird.“
Erneut griff der Graf ein und beteuerte, dass sein jetziger Verwalter, Herr Wohlgemut, sich uneingeschränkter Beliebtheit erfreue. Beifall.
Nun spielte Lea Wolf den zweiten Satz der Sonatine, und der junge Eisenpflicht blätterte um. Wieder ganz großer Beifall, unterbrochen nur von Zwischenrufen eines alten Herrn, der sich erhob und anfing, vom Ersten Weltkrieg zu schwadronieren, vom Erbfeind, und dass Ravel ein Franzmann sei wie derjenige, der ihm ein Auge ausgeschossen habe, und dabei nahm er ein Glasauge heraus, wurde von meinem Mann aber hinausgeführt. Und ich las weiter vor:
„Wenn man von diesem Städtchen ostwärts geht, gelangt man in eine tiefe enge Schlucht, durch welche sich ein wildes Wasser rauschend Bahn gebrochen hat und das Rad einer Mühle treibt, die wie ein Schwalbennest an den steilen Felsen hängt. Die Umgebung der einsamen Mühle ist mehr als romantisch, sie ist schauerlich. Die Schlucht heißt die Höllenschlucht, und darum darf es nicht Wunder nehmen, daß man die Mühle die Höllenmühle genannt hat. Das Schloß heißt Himmelstein, daher sagt der Städter oder der ländliche Bewohner der Umgegend, wenn er den Berg besteigen will, er wolle „zum Himmel“ empor; will er dagegen sein Korn zur Mühle bringen, so meint er: ‚ich gehe in die Hölle.'“
Gelächter folgte, dann der dritte Satz der Sonatine, an dessen Ende der junge Eisenpflicht sich vor Lea Wolf hinkniete und ihr unter brausendem Beifall die Hand, nein, die Hände küsste, es sah fast aus, als mache er ihr einen Antrag.
Erfolg haben ist so eine Sache. Man nimmt gar nicht mehr wahr, was ringsum vor sich geht, was es an Pracht und großer Geschichte zu bewundern gibt. Es trägt dich einfach empor, alle wollen dir die Hand drücken, wollen mit dir anstoßen, und es bleibt dir gar nichts anderes übrig, als strahlend ringsum zu blicken, Händedrücke herzhaft zu erwidern und verdammt genau aufzupassen, dass du nicht zu viel von dem sprudelnden Zeug in dich hineinschüttest und irgendwann die Kontrolle verlierst. Ich habe Papa oft zu den Premierenfeiern begleitet, Schwanensee, Nussknacker, jedes Mal gab es Krimsekt und dazu eimerweise Kaviar. Der hat mir hier gefehlt, es gab nichts weiter als diese ekelhaften Salzstangen, und deshalb war ich zum Schluss beschickerter, als gut ist, ich habe es lustig gefunden, im Stil der Roten Hilde auf die Kapitalisten zu schimpfen, die fett und faul in den Häusern ihrer deportierten Mitbürger hausen, und von mir sagen, ich sei doch nur ein ‚billiges Mitbringsel aus der Zone‘ – das hat mich bestimmt gleich wieder einen Teil der Sympathien gekostet, die mir die Lesung eingebracht hatte, und dann habe ich mit einem schwarzbärtigen Herrn auch noch langsamen Walzer getanzt, an dem riesigen Bartschlüsselbund, das er in der Hosentasche trug, hätte ich in ihm den Bürgermeister erkennen sollen, der uns zu Beginn ja feierlich begrüßt hatte, zum Glück hat mein lieber Mann mich schnell in seinen DKW und dann ins Bett verfrachtet.
Lea (2)
Ich gestehe, dass Eier in Senfsauce nicht mein Lieblingsessen sind, Shakshuka, wie ich es in Tel Aviv bei meinem Vetter bekommen habe, ist mir lieber, aber die Senfeier, die ich bei Eisenpflichts gegessen habe, haben mir doch sehr gut geschmeckt … Woran lag es wohl? An den Kerzen, die in blank geputzten Messingleuchtern auf dem Tisch standen? An Herberts anbetenden Blicken eher nicht, ich hätte mir einen etwas weniger ergebenen Verehrer gewünscht, ich glaube, es war sein Vater, der so amüsant aus seinem Leben erzählte (wie er in Russland auf Bäume gestiegen ist und den Krähen die Eier unterm Bauch weggeklaut und auf der Stelle ausgeschlürft hat, um nicht zu verhungern), aber noch besser gefiel mir Emil jun., Herberts Bruder, der, als er ein Glas Riesling intus hatte und merkte, dass mich seine Planetenbeobachtungen mit dem Spiegelteleskop, das er sich selbst gebaut hatte, interessierten, anfing, mir die Relativitätstheorie zu erklären, die ich noch nie begriffen habe, und zum ersten Mal habe ich ein bisschen was begriffen durch den Vergleich mit einem gespannten Tuch, auf dem eine Billardkugel (Sonne) liegt, die dadurch, dass sie durch ihre Schwere das Tuch nach unten drückt, andere, kleinere Kugeln (Planeten) in eine spiralige Umlaufbahn zwingt – und das ist der gekrümmte Raum! Nun ja, das ist wohl sehr laienhaft, was ich da erzähle, aber seine kurzsichtigen Augen strahlten so begeistert durch die starken Brillengläser, ich war richtig ergriffen von diesen Zusammenhängen, die meinen Verstand doch weit übersteigen! Die Mutter freilich ist mir auf die Nerven gegangen mit ihren ständigen Hinweisen darauf, dass sie in einer jüdischen Familie als Kindergärtnerin gearbeitet hat, dass dort zwischen Milch- und Fleischgeschirr unterschieden wurde, und dann sagte sie die Beracha auf, die zum Beginn des Schabbes gesprochen wird, und zwar in Hebräisch: „Baruch ata adonaj,“… Das war mir alles etwas zu plakativ, als ob sie etwas beweisen wolle damit. Als ich sie fragte, was aus dieser jüdischen Familie geworden sei, zuckte sie die Achseln, darum habe sie sich im Krieg als Mutter zweier kleiner Söhne unmöglich kümmern können. Und zum Schluss verriet mir der alte Eisenpflicht noch, dies sei kein gewöhnliches Mittagessen, sondern eins, das von seinem Vater und Großvater und Urgroßvater immer am 11. August eingenommen worden sei, es sei wohl der Geburtstag des Stammvaters, der vor hundert Jahren mit einem Koffer voller Litzen, Spitzen, Gummibänder aus der Bukowina gekommen sei und es in Dortmund zum Textilkaufmann gebracht habe. Und stell dir vor, Karla, ich bin gleich fertig mit meinem Bericht, ich habe in der Uni-Bibliothek ein altes Verzeichnis jüdischer Namen gefunden und darin den Namen Eisenpflicht, und der wurde zurückgeführt auf die oft nicht sehr wohlwollende Namensverleihung in Österreich-Ungarn an Juden, und wenn nun gerade einer Eier, Senf und Lichter im Sack gehabt habe und nicht recht wusste, wie er heißen wollte, dann wurde er Ei-Senf-Licht genannt und hat in späteren Jahren, um sich nicht allzu sehr für den lächerlichen Namen schämen zu müssen, den Buchstaben p hineingeschmuggelt, zugleich vielleicht in der Hoffnung, als einer, der eisern seine Pflicht tue, besonders deutsch zu erscheinen, denn die Deutschen sind ja nun einmal das Volk der Pflichtbewussten, selbst wenn ihnen Verbrechen befohlen werden.
Herbert (2)
Im Schachclub in der Höllenmühle zupfte Inspektor Kalkar mich am Ärmel, zog mich zu einem abseits liegenden Mühlstein von mindestens drei Meter Durchmesser, auf den er sich setzte. Er hatte offenbar ein Anliegen. Wollte er mich fragen, ob ich zur Stadtmeisterschaft antreten würde? Ich hatte mich in den geschlossenen Partien sehr gesteigert und hätte es mir zugetraut. Aber er wollte ganz etwas anderes wissen: Ob ich ihm was zu einer bestimmten Kanadierin sagen könne, die in Himmelstein aufgetaucht sei und große Beunruhigung unter den Bürgern, darunter vielen Geschäftsleuten, auslöse: Felicity Green. Sie habe im Gasthof Zum Bären eine Suite belegt und habe angeblich ein Verzeichnis aller Häuser dabei, die ehemals Himmelsteiner Juden gehört hätten. Und da Mr. Green, ihr Begleiter und Ehemann, „lawyer“ als Beruf angegeben habe, müsse man Schlimmstes befürchten. Wenigstens zwölf Häuser in Himmelstein, die meisten in vorzüglicher Lage, seien einmal jüdisches Eigentum gewesen, gehörten heute aber unbescholtenen Bürgern, die ihr Haus in dunklen Zeiten juristisch einwandfrei gekauft hätten und sich auf die von Deutschland an Israel geleistete Wiedergutmachung berufen könnten, nun aber befürchten müssten, in endlose Rechtsstreitigkeiten verwickelt zu werden, man wisse ja schon aus Shakespeares Kaufmann von Venedig, wie zäh, um nicht zu sagen: wie grausam diese Leute ihr Recht zu verfolgen wüssten. Ich war konsterniert: Wie kam Herr Kalkar dazu, mich in dieser Sache zu befragen? Ich dachte sofort an Karla Janssen, war aber sicher, dass sie nichts zu befürchten hatte, ja, dass sie ihr Haus gern und je eher desto besser an seine ursprünglichen Eigentümer zurückerstatten würde. Ich zuckte also nur hilflos mit den Schultern und sagte, da habe er, Kalkar, sich an den Falschen gewandt, ich hätte keinerlei Ahnung, wer diese Kanadierin sei und was sie vorhabe, höre von ihr auch durch ihn zum ersten Mal. Er sah mich nachdenklich an und sagte dann, maliziös lächelnd: „Hast du Lea Wolf nicht bei der Lesung auf Burg Himmelstein die Hände geküsst?“ „Was hat das mit der Kanadierin und ihrem Anwalt zu tun? Ich habe den Händen gehuldigt, die so beeindruckend Ravel gespielt haben.“ „Wir haben Grund zu der Annahme,“ fuhr der Inspektor fort, „dass es sich bei Felicity Green um niemand anderes handelt als um Glückl Wolf, die Mutter von Lea, mit der du befreundet bist.“ „Aber ihre Mutter ist nach einem vergeblichen Versuch, nach Kuba auszureisen, nach Europa zwangsweise zurückgekehrt, und ihre Spur verliert sich in Belgien.“ „Hat Lea gar nichts von ihr? Kein Bild, kein Andenken? Denn es lässt sich nicht völlig ausschließen, dass sich eine Betrügerin an uns bereichern will … Wir werden Mutter und Tochter einander gegenüber stellen müssen.“ „Das dürfte schwierig werden. Lea ist in Israel und hat dort geheiratet.“ „Gut, Herbert, entschuldige. Lass uns eine Partie spielen! Aber ich warne dich vor der Spanischen. Die kann ich besser als du!“
Die alte Buche
Endlich lässt man mich zu Wort kommen, obgleich ich hier schon so lange stehe und ganz genau weiß, wer alles bei Karla Janssen Unterricht genommen hat, und auch der Geruch nach angebrannten Bratkartoffeln hat mich schon verwöhnt, und den Türkischen Marsch habe ich bestimmt hundertmal mit demselben Fehler gehört. Aber nun soll die Säge an mich gelegt werden, weil ich zu viel Schatten auf das Haus werfe, das Mauerwerk werde feucht, es röche nach Schimmel, Salpeter blühe aus, ja, von Mauerfraß redet der Propst, der das Haus kaufen will. Karla ist ins Altersheim gezogen, sie kam allein nicht mehr zurecht. Da hilft es mir nicht, dass ich als Denkmal unter Naturschutz gestellt wurde – im Kampf zwischen Ideal und Profit, wer gewinnt da wohl immer? Und dabei hat Karla das Haus ihrer Schülerin Lea vermacht, aber der Propst hat diese letztwillige Verfügung angefochten: Karla sei nicht mehr im Besitz ihrer geistigen Zurechnungs- und Geschäftsfähigkeit gewesen, als sie sie verfasste, und da sie keine Erben habe, falle das Haus an den Fiskus, der es nur zu gern an einen verdienten Himmelsteiner verkaufe, der kürzlich sogar Ehrenbürger der Stadt geworden sei. An ihm sei es zu entscheiden, ob er das Haus an seine Adoptivtochter Gudrun weitergebe, die sich seit der Entdeckung ihrer Herkunft Lea nenne, Deutschland aber den Rücken gekehrt habe und nach Israel ausgewandert sei. Shlomo Grünfeld war es, der mich in dänischer Zeit pflanzte, als Himmelstein frei für und nicht von Juden war, seine Tochter Salka heiratete Siegfried Wolf, und seitdem hat das Haus und meine Knorrigkeit immer einem Wolf gehört. Einen großen Schatten werfe ich schon lange, aber von Mauerfraß und Salpeter war nie die Rede. Lebewohl, lieber Westwind, der du so sanft und verschwenderisch deine Schauer über Himmelstein treibst, deine Böen haben mich immer beflügelt zu den schönsten Träumen vom Baumhimmelparkwaldforst, wo unsereins so alt werden darf, bis er von allein umfällt wie meine Herrin Karla Janssen, die sich zum Schluss nur noch fortbewegte, indem sie sich von einer Wand abstieß, schnell zur gegenüberliegenden trippelte und an ihr Halt suchte …
Lea (3)

Liebe Karla Janssen, die Angst, es könnte Dich gar nicht mehr geben, lässt mich zittern, während ich dies in eine der halbautomatischen Maschinen tippe, die bei uns in der Redaktion in Mode gekommen sind. Als ich nach Israel zog, habe ich absichtlich alle Brücken hinter mir abgebrochen und mir geschworen, nie ins Land derer zurückzukehren, die meine Eltern in Unglück und Tod getrieben haben, und nun, ich falle mit der Tür ins Haus, will ich es doch, sitze hier nämlich mit zwei kleinen Mädchen, Glückl und Salka, der Journalist, der mein Mann ist, wurde bei einer Demonstration in Gaza erschossen, und Deutschland erscheint mir als Paradies, verglichen mit diesem zu seinem Unglück nicht zur Ruhe kommenden Staat, der unter seinen Nachbarn keine Freunde hat und findet. Aber sucht er sie? Ich brauche kein Geld, ich erhebe auch keinen Anspruch auf das schöne Haus meiner Eltern, das Dir gehört, nur erst einmal, vielleicht für ein paar Wochen bei Dir wohnen, das möchte ich. Du warst mir mehr Mutter als die verbitterte Frau Westfal, bei der ich aufwuchs und beten lernte zu einem Gott, der meiner nicht ist. Du hast mich schon einmal bei Dir aufgenommen, als ich erfahren hatte, dass mein Name nicht Westfal ist, sondern Wolf – aber ich rechne nach: Du musst inzwischen weit über Achtzig sein, Gott gebe, dass Du noch lebst und gesund bist. Deine Telefonnummer kann ich nicht herausfinden, das beängstigt mich. Die meine ist 970-xyxyxyxyxyxy, aber auch wenn Du mir nicht antwortest, ich setze mich in einer Woche mit den Mädchen in den Flieger nach Frankfurt. Ich umarme Dich und küsse Deine wunderbaren Hände – Lea.
Ich, Ludolf von Osten (2)
Hätte ich gewusst, worauf ich mich einließ, ich hätte es mir vielleicht anders überlegt und das gleichsam vom Himmel gefallene Kreditangebot nicht angenommen. Aber die Bedingungen waren so vorteilhaft, die Feuerversicherung so knauserig, dass ich kurzentschlossen unterschrieb, zumal die Himmelsteiner Darleihkasse, meine Bank, auch nur Gutes über den Kreditgeber sagen konnte, den Makler Harry Green aus Winnipeg, Manitoba. Und als er dann auch noch zusagte, selbst hierher zu kommen, um das Projekt, in das er investiere, persönlich in Augenschein zu nehmen, freute ich mich und hoffte auch zu erfahren, warum er sich für den Wiederaufbau der Ruine interessierte, in die der Blitz, der am 14. Mai in den Palas einschlug, meinen Stammsitz verwandelt hatte. Ich holte ihn vom Flughafen ab; er kam zu meiner Überraschung nicht allein, sondern in Begleitung seiner Frau, deren Schweigsamkeit mir auffiel – aber sind Frauen erfolgreicher Geschäftsleute nicht oft sehr zurückhaltend in dem Gefühl, nur dekorative Anhängsel zu sein? Und dekorativ war sie, diese Mrs. Green, ganz in ein blaues Schlabberkleid gehüllt, mit blau verspiegelter Sonnenbrille und blau gefärbtem Haar … Zu meiner Überraschung wies sie mich darauf hin, dass ich auf einem Umweg nach Himmelstein hineinfuhr – sie kannte die kürzere Verbindung, die aber wegen einer Baustelle nur eingeschränkt befahrbar war. Ich hatte im Gasthof Zum Bären für sie reserviert. Dort setzten wir uns auf ein Glas noch zusammen, und hatte ich vorher Sorgen gehabt, mein Englisch könnte den Test nicht bestehen, wurde ich ihrer enthoben durch Felicity, die perfekt deutsch sprach und bereitwilligst dolmetschte – es stand sprachlich gleichsam zwei zu eins am Tisch gegen meinen Geschäftspartner, der sich dafür entschuldigte, der deutschen Sprache trotz seiner deutschen Frau immer noch nicht mächtig zu sein. Ein junger Mann bat, uns fotografieren zu dürfen – ich erkannte in ihm Nils Petersen, den Fotografen des Himmelsteiner Volksfreunds, und ließ es zu; als Landrat muss ich mich damit abfinden, eine Figur von öffentlichem Interesse zu sein. Der junge Mann hatte, Schach spielend, auch unser Gespräch belauscht und mitbekommen, dass Mrs. Green Himmelsteinerin war und in den dunklen Jahren fliehen musste. Daran knüpfte der am kommenden Tag erscheinende Zeitungsartikel die abenteuerlichsten Vermutungen, gerade als handle es sich um etwas im Stil von Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“; die vagen Andeutungen von einer „Wiederherstellung des Rechts“ lösten große Besorgnis vor allem unter Geschäftsleuten aus und hatten schon nach drei Tagen einen scheußlichen Vorfall zur Folge, der mich bewog, das Ehepaar Green in das Gesindehaus von Burg Himmelstein einzuladen – es war beim Brand unbeschädigt geblieben, auch ich wohne jetzt darin. Greens waren eigentlich entschlossen gewesen, sofort nach Kanada zurückzukehren, nahmen mein Angebot aber nach einigem Zögern an. Harry Green verbringt seine Tage damit, den Gegenstand seiner finanziellen Großzügigkeit gründlich zu begutachten. Dabei beobachtete ich ihn, wie er auf den Stufen zum Bergfried kniete – und weinte. Furchtsam trat ich zu ihm. War sein Interesse an Himmelstein zusammengebrochen angesichts der feindseligen Stimmung in der Stadt gegen seine Frau, aber auch des Vielen, was es aufzubauen und herzurichten gibt? Nein, das war es nicht. Er zeigte nur auf die in Jahrhunderten völlig ausgetretenen Stufen: „We do not have anything like that!“, sagte er, kopfschüttelnd und schluchzend immer wieder. „It doesn’t exist in America!“ Mir fielen die Bauten von Tulum und Chichen Itza in Yucatan ein, die ich einmal besichtigt hatte – aber ich schwieg, froh, meinen Gönner nicht verloren zu haben.
Ich, Harry Green
Als ich Felicity kennenlernte, arbeitete sie als Schwester im Hopital St. Boniface in Winnipeg, einer katholischen Einrichtung, und ich hatte keine Ahnung, dass sie Jüdin war. Manchmal saß sie an meinem Bett und glaubte, ich schliefe; dann nahm sie ihren Rosenkranz hervor und betete in einer sonderbaren, mir unverständlichen Sprache, aber es war eindeutig das Ave Maria. Ich hatte Gallenkoliken gehabt und musste mir helfen lassen, die herausbeförderten Steine prangten auf meinem Nachttisch und wurden von Felicity respektvoll gewürdigt, vor allem der eine, er gleiche einem Zitrin und verdiene eine Ringfassung, sagte sie spöttisch. Als wir uns verliebt hatten, sagte ich einmal zu ihr: „Wenn du nicht katholisch wärst, ich würde dich fragen, ob du meine Frau werden willst.“ Warum ihr Bekenntnis ein Hindernis sei, wollte sie wissen. Nun, erwiderte ich, meiner Familie könne ich nicht mit einer Schickse kommen, so nenne man eine nichtjüdische Frau bei uns. Da brach sie in Tränen aus: „Ich bin doch eigentlich jüdisch!“ Und die Geschichte ihrer abenteuerlichen Flucht aus Himmelstein einschließlich des vergeblichen Versuchs, nach Kuba zu gelangen, brach aus ihr hervor, wie ihr Mann von den Nazis gefasst und deportiert wurde, sie hingegen von Nonnen des Klosters Maredret gerettet worden sei, und aus Dankbarkeit für diese Rettung habe sie den katholischen Glauben angenommen und ihn auch beibehalten, als sie nach dem Krieg auf Wunsch und Vorschlag der Schwestern nach Kanada ausgewandert sei. Ich hatte den Zitrin in Silber fassen lassen, und diesen Ring steckte ich ihr an den Finger, sie kehrte zum Judentum zurück und wir heirateten traditionell unter der Chuppa.
Es ist vielleicht drei Jahre her, dass Felicity unruhig wurde und viel von ihrer Sehnsucht nach ihrem Geburtsort in Deutschland sprach; sie hatte sich brieflich an die Familie Janssen gewandt, die ihr Haus in Himmelstein übernommen hatte, und deren Tochter Karla hatte ihr geantwortet und ihr Erschütterndes mitgeteilt. „Ich muss unbedingt hin und Lea in die Arme schließen und sie um Verzeihung bitten, dass wir sie damals zurückgelassen haben. Sie ist jetzt zwanzig Jahre alt, weiß zwar, wer sie ist, braucht mich aber gerade deshalb noch mehr als ich sie.“ Ich warnte sie vor einer Rückkehr: „Die Profiteure eurer Vertreibung sitzen in den ehemals jüdischen Häusern und werden angstvoll und giftig auf ihr formelles Recht bedacht sein.“ Aber Felicity war von ihrem Vorhaben nicht abzubringen. Fräulein Janssen hatte auch von einem furchtbaren Unwetter und vom Brand der Burg Himmelstein berichtet, und da ich Reisen aus geschäftlichen Gründen privaten vorziehe, nahm ich Kontakt zur Bank des Grafen auf und konnte ihm bald einen Kredit zur Finanzierung des Wiederaufbaus anbieten. So sind wir nun hierhergekommen, aber meine Befürchtungen haben sich nur allzu drastisch bestätigt. Pastor Westfal, der Ziehvater Leas, schützt Termine vor, um uns nicht zu empfangen, hat uns nur informiert, dass er Lea, als sie 16 wurde, über ihre wahre Herkunft ordnungsgemäß aufgeklärt habe und dass sie nach Israel an einen unbekannten Ort verzogen sei. Eben suchte ich Felicity auf der Burgmauer auf, wo sie sich einen Liegestuhl aufgeschlagen hatte und in der Herbstsonne lag und las. „Hör dir das an,“ sagte sie und las aus dem Buch auf Deutsch vor: „Unwiederbringlich ist die Heimat verloren, uneinbringlich liegt die Ferne vor uns, allein der Schmerz wird immer gelöster, immer heller, vielleicht sogar unsichtbarer, nichts bleibt als ein schmerzlicher Hauch des Einstigen.“ Sie schwieg und sah mich an. „Wie konnte er das wissen? Er war einer von uns, und dabei schrieb er es, bevor er vertrieben wurde.“ Wir besprachen unsre nächsten Pläne, aber bevor ich ging, sah ich nach dem Titel: Die Schlafwandler von Hermann Broch.
Der Richter aus der Hansestadt
Eine Gerichtsverhandlung fand statt im alten Himmelsteiner Amtsgericht, für die extra ein Richter aus der Hansestadt angefordert wurde – wegen der großen grundsätzlichen Bedeutung des Falles. Landrichter Kotthaus war nikotinsüchtig und wälzte während der Verhandlung einen Priem von einer Backe in die andere. Er eröffnete die Verhandlung mit dem Satz: „Sie brauchen hier außer unter Eid nicht die Wahrheit zu sagen, aber bedenken Sie: Ich brauche Ihnen auch nicht zu glauben!“ Es ging um die Frage, ob der letzte Wille von Karla Janssen zugunsten von Lea Wolf galt oder nicht. Propst Westfal focht dieses Testament an mit der Begründung, die Erblasserin sei nicht mehr testierfähig gewesen, habe schon schwere Symptome von Demenz gezeigt und sei ihm gegenüber auf unsinnige Weise aggressiv aufgetreten, habe sogar einmal das Metronom nach ihm geworfen. Lea Wolf war zu dem Gerichtstermin geladen, war jedoch nicht rechtzeitig aus Israel eingetroffen, aber Mrs. und Mr. Green vertraten ihre Interessen und verhinderten so, dass ein Versäumnisurteil gefällt wurde. Sie riefen als Zeugen Landrat Ludolf von Osten auf, der aussagte, er habe noch kurz vor Karla Janssens Tod bei ihr eine erste Klavierstunde genommen in der Hoffnung, dass noch viele folgen würden. Da platzte plötzlich Lea Wolf in die Verhandlung herein, legte dem Gericht einen fehlerfrei handgeschriebenen Brief vor, in dem Karla ihr mitteilte, dass sie das Haus ihr als ihrer einzigen Erbin vermacht habe. Westfal wandte ein, das könne eine Fälschung sein, es müsse ein graphologisches Gutachten angefordert werden, man wisse ja, dass den Juden jedes Mittel recht sei, das wisse man unter anderem, seit sie mit List und Tücke Adolf Eichmann in Argentinien aufgespürt und gefangen genommen hätten, jetzt stehe er in Jerusalem vor Gericht, ein unmögliches und keineswegs rechtsstaatliches Verfahren, wenn das so weiter gehe, seien die Besitzer von ehemals jüdischen Häusern nicht nur in Himmelstein, sondern in ganz Deutschland ihres Eigentums nicht mehr sicher. Außerdem habe er Lea damals vor ihrem sicheren Tod gerettet, sie an Kindesstatt bei sich aufgenommen und unter dem Namen Gudrun aufgezogen; was sie hier zeige, sei verwerflichster grober Undank. Daraufhin erhob sich Lea und deutete mit vorsichtigen, aber eindeutigen Worten an, dass sie als Kind von ihrem Ziehvater sexuell missbraucht worden sei und sich dafür zu Dank nicht verpflichtet fühle. „Sie lügt und hat schon immer gelogen, ich habe sie dafür nur gezüchtigt!“, tobte der Propst. Der Richter spuckte in das neben ihm stehende Spucknapf und wollte die Verhandlung wegen notwendiger Gutachten und Zeugenbefragungen vertagen – da stand die Frau des Pastors auf und sagte: „Lea sagt die Wahrheit! Ihr Ziehvater hat mit ihr Sachen gemacht, die mit einem Kind zu machen einem Mann nicht ansteht, und schon gar nicht einem Kirchenbeamten. Ich habe das immer gedeckt, weil ich mich zu sehr schämte und auch umso mitschuldiger fühlte, je länger ich dazu schwieg. Aber es muss mal ein Ende sein mit der Lügerei!“ Der Richter entschied: „Karla Janssens Testament ist gültig. Die anderen Besitzer ehemals jüdischer Häuser mögen ruhig sein. Ihre Strafe wird darin bestehen, dass sie sich als Profiteure verbrecherischer Handlungen ihres Besitzes nie wieder uneingeschränkt werden freuen können.“
Susan
Wie hatte er sich so verstricken können? Diese Malerin hatte Herbert so in Bann geschlagen, dass er nicht mehr ein und aus wusste. Sie war nicht nur schön, sondern brannte auch von innen, und das mit einer Gewalt, der er nicht gewachsen war. Aus ihren dunklen Augen leuchtete ihn etwas an, das er vielleicht nur hineinsah, es waren Sinn und Wissen in höchster Potenz, er konnte nicht von ihr lassen und beugte immer wieder den Kopf, wenn er zu ihr in ihre Kellerwohnung, die sie Loft nannte, hinabstieg durch eine Tür, die einmal ein Fenster gewesen war. Wie oft hatte er sich hier den Kopf gestoßen! Und schlimmer als der Schmerz war dann die Wut, die er auf sich selbst hatte: Warum war er so blöd und begriff es nicht endlich: Er musste den Kopf einziehen, er musste demütig werden! Demütig vor ihr, dieser ungeheuerlichen Frau, die mit ihrem Blut malte und mit dem Sand, den sie von Reisen mitgebracht hatte und der in Weckgläsern neben Firnis, Terpentin, Leinöl und anderen Malmitteln auf dem Regal stand. „Du liebst in mir die andere und nicht die gleiche,“ warf Susan ihm vor, und er gab ihr Recht, aber nicht in dem Sinn, den sie meinte, sondern weil sie eine Frau, er ein Mann, sie eine Künstlerin und er nur ein Angestellter war, der sich in der KONKORDANZ mit ab- und aufgezinsten Sterbenden und Erlebenden mühsam sein Brot verdiente. Sie war in New York aufgewachsen, eins von sieben Kindern eines Textilunternehmers, der als armer Schneider in der Bronx begonnen hatte, aber der Kunstbazillus grassierte in der Familie, eine Tante war Pianistin, der Großvater war Schauspieler im Schtetl gewesen. Vor einem ihrer Bilder aus braunen, kaum noch roten Streifen bekannte er, es sei ihm zu wenig realistisch, stelle nichts dar. „Was kann man vom Sohn eines Nazisoldaten anderes erwarten!“, giftete sie. „Hat Hitler nicht als Maler von Ansichtspostkarten angefangen?“ „Die Nazis nannten es Sippenhaft, wenn sie die Kinder von Staatsfeinden auch zu Staatsfeinden erklärten. Warum wendest du Nazimethoden an?“ „Ihr Deutschen werdet es nie lernen! Noch in tausend Jahren werdet Ihr Schuld tragen müssen!“ Aber Herbert war nun in einem Fahrwasser, aus dem er nicht wieder herauskam. „Malen mit Blut und dem Sand der Negev-Wüste – ist das nicht Blut und Boden, huldigt also einer Kunstideologie, wie die Faschisten sie propagierten?“ Da schlug sie ihm ins Gesicht und schrie: „Nenne mich nie wieder eine Faschistin, du braunes Dreckschwein! Und jetzt komme mir nicht mit der angeblich jüdischen Herkunft deines Namens. Ei, Senf und Licht – lachhaft das!“ Susan warf mit Pinseln nach ihm und kreischte noch, als er, den Kopf einziehend, den Loft verließ. Die Welt war verrückt geworden, es gab nichts mehr, um sich daran zu orientieren, das Heimweh nach Himmelstein, nach dem Blüthner und dem Haus von Karla Janssen unter der alten Buche, nach der Burg, auch wenn der Palas in Trümmern lag, in dem sie musiziert und Minna Lieberwirth vorgelesen hatten, wurde übermächtig in ihm, er beschloss, die KONKORDANZ um Urlaub zu bitten.
Ich, der Blüthner
Ich habe als Flügel hier schon mal das Wort ergriffen und mich dabei nicht wohl gefühlt. Unter lauter Menschen das einzige Ding zu sein, um nicht zu sagen, das einzige Spiel-Zeug – nicht angenehm. Als dann aber sogar ein Baum, dann ein Schaf und schließlich ein Gerät sich äußern durften – damit meine ich den Plattenspieler, den prolligen! – da wurde es mir wohler, und nun schwatze ich einfach drauflos, denn so sehr ich die Musik liebe, die auf mir gespielt wird, so sehr liebe ich inzwischen auch die Klatschgeschichten, die mir zugetragen werden. Aber bevor ich mich darauf einlasse, will ich, wie es sich gehört, erst einmal meine Trauer um Karla Janssen zum Ausdruck bringen und den Trauermarsch von Chopin in mir erinnern, den sie wie keine andere zu spielen wusste. Und während er noch nachklingt, ertönt aus der Ferne „Für Elise“ – und die Hoffnung besteht, dass sie ihren geliebten Professor – oder er sie oder sie einander – gefunden haben. Und ihr werdet nicht raten, wo ich jetzt stehe! Nicht in dem Haus, das 36 Jahre lang mein Heim war, denn dem wurde von der alten Buche das Dach eingeschlagen, und dabei war gar kein Wind, nur eine Motorsäge hörte ich – und dann, krach, war’s geschehen, und Astgewirr über und auf mir und um mich herum, ich verlor vor Schreck das Bewusstsein, aber als ich wieder zu mir kam, war ich noch völlig intakt, Manfred, inzwischen Bürgermeister von Himmelstein, spielte Bachs erste Invention auf mir – o, was für ein Glück, von diesen herrlichen Händen berührt und zum Klingen gebracht zu werden, die Umstehenden klatschten, unter ihnen auch Minna Lieberwirth, die Manfred dem Buchhändler ausgespannt hat, der arme, er soll immer noch die Ohren hängen lassen und den Verlust seines Mitbringsels aus der Zone nicht verschmerzt haben! Und es wurde beschlossen, mich auf die Burg zu verbringen, wo ich ja schon einmal gewesen war, und da bin ich jetzt und warte darauf, dass ich zur Einweihung des von Holger wieder aufgebauten Palas meinen Beitrag leiste, und zwar mit einem Stück, das ich lange, lange nicht mehr gehört habe: der Telemann-Sonate in F-Dur für Altblockflöte und Klavier, und zu der haben sich zwei zusammengefunden, die einander schon aufgegeben hatten, ihr ahnt schon, wer – es ist geradezu, als ob Karla Janssen von ferne Regie geführt und die vereint hätte, die sie am meisten liebte. Jetzt aber werde ich erst einmal abgewischt und poliert mit einer Salbe aus Ei und Bienenwachs von einer dicken Madam, die mich geradezu mütterlich liebt. Sie hat graue Strähnen im Haar, Besenreiser an den Beinen und war einmal d i e Attraktion der Oase, von Isabel, die mir stolz zuflüstert: „Den Herbert hab ich auch mal vernascht – aber sag‘s der Lea nicht weiter!“
Mädels
Das Café im Bahnhof
„Das hätte ich meinem Mann nicht antun mögen.“ Herta schwieg und lächelte bemüht. Irgendwie befremdete sie, was Ellinor erzählt hatte: Dass sie jahrelang Gedichte von einem Verehrer bekommen hatte, gedankentiefe, aber auch zärtliche Gedichte, sie sei seine „Muse“ gewesen, aber getroffen habe sie sich mit ihm nie. Herta hatte einmal ein Gedicht von einem Mitschüler bekommen, sie errötete innerlich bei der Erinnerung, es hatte ihre „üppigen Titten“ gepriesen, um die der Verfasser „so viel gelitten“ habe, sie hatte ihn nicht mehr eines Blickes gewürdigt. Ellinor hatte eins der Gedichte dabei und las es vor. Es war nicht unanständig – aber unverständlich, und das war fast noch schlimmer. Was dachten die Männer sich alles aus, um Frauen zu imponieren! Sie führten Balztänze auf, plusterten ihr Gefieder – machten sich lächerlich mit unverständlichen Worten wie Entelechie … Herta wollte etwas sagen – aber dann stopfte sie sich selbst den Mund – mit einem tüchtigen Bissen Schwarzwälder-Kirsch-Torte. Die aßen sie immer, wenn sie sich trafen – und tranken dazu fair gehandelten Kaffee aus Kolumbien. Nein, Else trank Malzkaffee, ihr bekam das Koffein nicht, sie hatte ein schwaches Herz. Zu der Runde gehörten noch Ute und Hedwig, aber Hedwig hatte zu Hause den schwer an Alzheimer erkrankten Mann, sie konnte nicht immer weg, und dann kam auch Ute nicht, weil sie in einem Wagen fuhren. Dienstag Vormittag um 10 war ihre Zeit, sie nannten es ihr Frühstück und eröffneten es immer mit einem Müsli für die Gesundheit, aber dann folgte die Torte für den Genuss.
Else und Herta klatschten nach Ellinors Vortrag, Herta schränkte ihr Lob freilich etwas ein durch ihr bemühtes Lächeln, aber ihr Mann war Organist mehrerer Kirchen, und da dachte sie halt ein wenig weniger großzügig als die anderen. Ellinor hütete die Gedichte ihres Verehrers wie einen Schatz. Sie gaben ihr das Gefühl, nicht nur Hausfrau, Gattin und Mutter zu sein – neuerdings auch Großmutter – sondern noch mehr, etwas Besonderes, eine Frau, die die Fantasie eines klugen und anspruchsvollen Mannes in Gang bringen, ja, in Feuer versetzen konnte. Jedes dieser Gedichte hatte sie genossen wie ein Stück Schwarzwälder-Kirsch, hatte die Worte, die sie nicht verstand, nachgeschlagen, und war dankbar gewesen, noch was hinzuzulernen. Else, die als Lehrerin immer von selbstverdientem Geld gelebt hatte, schlürfte ihren Malzkaffee, dann fragte sie schüchtern: „Was bedeutet denn eigentlich Entelechie?“ Ellinor erklärte es als eine innere Schönheit, wie sie schon in der Raupe stecke, erst im Schmetterling werde sie sichtbar. War es nicht herrlich als Muse einen Amateurdichter auf so einen Begriff gebracht zu haben? Sie hatten sich in einem Chat im Netz kennengelernt, sie hatte ihm ein Passbild geschickt, er eines von sich an sie – sie fand ihn gutaussehend trotz Stirnglatze und Doppelkinn – aber auf Abenteuer hatten sie sich nicht eingelassen, nicht einmal auf ein Telefonat. Sie waren beide verheiratet, Holger mit einer älteren reichen Erbin, deren Wohlwollen er nicht verscherzen durfte, sie mit einem Leitenden Ministerialrat im Finanzministerium, der grundsätzlich nur Sekretärinnen einstellte, die ihm „vorgetanzt“ und gefallen hatten. Ellinor wusste, dass sie eine vielfach Betrogene war, und Holgers Gedichte halfen ihr, das zu ertragen, ja, sie gaben ihr ein Gefühl von Erhabenheit über die schlüpfrige Welt des praktizierten Ehebruchs.
„Hallo Mädels!“ Hedwig rief es fröhlich aus, als sie verspätet am Tisch der drei eintraf. Ellinor, Herta und Else sprangen auf, sie drückten einander die Hand und gaben sich Bisoux. Das hatte Hedwig eingeführt, deren Mann für IBM vier Jahre in Paris gearbeitet hatte, sie war nach zwei Jahren zu ihm gezogen, und man machte ihr eine große Freude, wenn man sie Edwigue nannte. Wenig später wiederholte sich das Ritual mit Ute, die den Wagen noch hatte umparken müssen, weil ein Filmteam eingetroffen war, das den Platz für sich beanspruchte. Der kleine Bahnhof, in dem sich das Café befand, war der Bahnhof von Lunden, dem Ort, in dem die Seifenoper „Kornblumenblau“ spielte. „Was haben wir verpasst?“, wollte Ute wissen. „Wusstet ihr schon, dass unsere Ellinor eine Muse ist, die von ihrem Verehrer ‚Entelechie‘ genannt wird?“ Else war aus ihrer Malzkaffeemattheit erwacht, blickte mit leuchtenden Augen um sich und rief: „Warum hat den Schmetterling in mir noch nie ein Mann entdeckt? Ich war für alle immer nur die hässliche Raupe! Gib das Gedicht an Ute weiter, Edvigue, sie soll es auch lesen und sagen, ob sie Ellinor beneidet oder wie Herta auch ein bisschen verurteilt, denn ganz korrekt ist es für eine verheiratete Frau doch nicht, sich so als Objekt einer wenn auch rein geistigen Verehrung zur Verfügung zu stellen!“ Hedwig bedankte sich für ihr Tortenstück bei der Bedienung mit „Merci beaucoup!“, widersprach dann aber energisch: Sie habe in ihrer Zeit in Versailles kein einziges Ehepaar kennengelernt, in dem die Ehefrau nicht einen amant gehabt hätte, und sie selbst sei auch nahe daran gewesen, sich einen zuzulegen, aber dann sei ihr Mann leider wieder nach Hamburg zurückversetzt worden. Nein, es sei absolut selbstverständlich, sich der notorischen Treulosigkeit der Männer durch kleine excursions – wie sage man dafür – ja, richtig, Ausflüge zu erwehren!
Arbeiter kamen herein, um das große Schild (mit der schwarzen Aufschrift: LUNDEN auf weiß emailliertem Grund) zu holen, das für die Dauer der Dreharbeiten an der Gebäudefront befestigt werden musste. Es hatte zwischenzeitlich im Café an der Wand gelehnt. Das Hämmern, mit dem es angenagelt wurde, störte für eine Weile das Gespräch der fünf Frauen, die es genossen, sich einmal wöchentlich miteinander bei Kaffee und Kuchen gemütlich auszutauschen. „Jetzt werden wir für diese Serie wieder nach Lunden versetzt. Wie nennst du ‚Kornblumenblau‘ doch noch immer, Edvigue?“ „Une cucuterie!“ Sie lachten, das Wort war einfach zu schön! Herta verabschiedete sich als erste. „Frank muss auf drei Begräbnissen orgeln, und die Enkel sind noch zu klein, um allein zu bleiben.“ Kaum war sie weg, stand eine Flasche Freixenet Asti auf dem Tisch, die Gläser klangen aneinander.
Der Diamant
„Nein, den würde ich keinesfalls tragen, er wäre mir …“
„Unheimlich,“ ergänzte Else die offenbar förmlich angewiderte Herta.
„Nicht nur unheimlich – ich glaube, er wäre mir eklig!“ Herta war wieder in ihrem Element, und wieder war es Ellinor, durch die sie sich provoziert fühlte. An diesem Dienstag hatten sie sich verabredet, dass jede ihren Lieblingsschmuck zum gemeinsamen Frühstück tragen sollte. Herta hatte die Granatklunker ihrer Großmutter angelegt, Else die Halskette aus grauen Lavakugeln, die sie sich selbst gekauft hatte, und Ellinor trug ein neues Medaillon auf dem Revers ihrer Jacke, in dessen Mitte ein Diamant funkelte. Else und Herta hatten es noch nie gesehen und baten um eine Erklärung.
„Ich habe euch erzählt, dass die Gedichte, die ich regelmäßig übers Internet bekam, seltener und seltener wurden und schließlich ganz ausblieben. Nun gut, ich dachte mir nichts Schlimmes, Musen werden ja von den Herren der Schöpfung gern mal ausgewechselt, er hat eben eine andere gefunden. Aber dann bekam ich einen dicken Brief, und darin war ein wattiertes Kästchen, in dem lag dieses Medaillon, und dabei lag ein handschriftlich beschriebenes Blatt. Von wem wohl? Nun, ich konnte es zuerst auch nicht glauben: Von Louise, der Frau meines platonischen Verehrers! Ich habe ihn dabei, soll ich ihn …“
In diesem Augenblick traten Hedwig und Ute an den Tisch, Hedwig mit einer Silbermünze als Brosche, auf der der unverwechselbare Kopf von Napoleon Bonaparte prangte, Ute mit der doppelten goldenen Uhrkette ihres Vaters um den Hals. Als sie hörten, dass ein Brief verlesen werden sollte, musste Ellinor die gesamte Einleitung noch einmal wiederholen, Schwarzwälder Kirsch und frischer Fairtrade-Kaffee kamen auf den Tisch, Ute begutachtete das Briefpapier: „Das ist Bütten!“, und dann begann Ellinor vorzulesen:
„Liebe Ellinor, bitte wundere dich nicht, dass ich mich acht Wochen nach Holgers Tod persönlich an Dich wende und Dich sogar duze, wie es zwischen Euch üblich war. Holger hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er in Dir eine wundervolle Muse für seine Sonette, Stanzen und freien Verse gefunden hatte, die zu schreiben für ihn ein innerstes Bedürfnis war. Zwar hat er mir seine Werke nie zu lesen gegeben, da er wusste, dass ich damit nichts anfangen kann, aber ich merkte, wie unruhig er war, wenn es innerlich in ihm wieder arbeitete – und wie glücklich und erlöst, wenn er sein Werk veröffentlicht hatte. Ich hoffe, er war Dir gegenüber immer ebenso feinfühlig, wie er sich in unserer fast die silberne Hochzeit erreichenden Ehe mir gegenüber verhalten hat. Ich konnte ihm das Glück, das Du ihm gabst, nicht geben, und ich bin sicher, wir hätten uns längst getrennt, wenn Du unsere durchaus glücklich zu nennende Ehe nicht stabilisiert hättest. Ich habe mich bei Holgers Kremierung entschieden, aus dem Kohlenstoff seiner sterblichen Überreste einen Diamanten pressen zu lassen, und als ich das beschlossen hatte, dachte ich: Und was wird aus seiner Muse? Hat sie nicht auch einen Diamanten verdient? Diese Prozedur ist recht kostspielig, aber da mein Vater, Bauunternehmer seines Zeichens (er hat die schrägen Häuser von Gehry in Düsseldorf gebaut) mir mehr hinterlassen hat, als ich gebrauchen kann, bekommst Du nun auch einen Diamanten, den ich von meinem Juwelier habe fassen lassen in einer schlichten Form, die Dir hoffentlich zusagt. Bitte nimm dieses hoch verdiente Schmuckstück von mir an und trage es zur Erinnerung an unseren unvergesslichen Holger. Louise“
Ellinor musste ihre Rührung herunterschlucken, die anderen schwiegen so still, dass das Schmatzen Elses hörbar wurde, sie hatte die Neigung, mit offenem Mund zu essen, eine Unart, die sie in einer Partnerschaft sicherlich nicht beibehalten hätte. Als erste fasste sich Herta und sagte den eingangs zitierten Satz, nämlich dass es ihr nicht nur unheimlich, sondern sogar eklig wäre, dieses Schmuckstück zu tragen. „Gewonnen aus der Asche eines wildfremden Körpers, mit dem einen nichts als Worte verbinden … Und dann die eine Hälfte bei ihr, die andere bei dir: Habt ihr den armen Kerl nicht gleichsam mittendurch geschnitten?“
Ute lachte laut auf, befragt, warum, sagte sie: „Ich dachte nur gerade darüber nach, ob er senkrecht oder waagerecht – durchgeschnitten wurde …“ Nun mussten auch die anderen Mädels lachen, riefen einander kecke Bemerkungen zu, bis Ellinor wieder das Wort ergriff:
„Mir war auch sofort klar, dass ich das Ding nicht tragen will. Ich wollte es zuerst einfach in meiner Schmuckschublade versenken und vergessen. Aber dann schaute ich im Netz nach: Es handelt sich um einen einkarätigen Diamanten, und das Pressen eines solchen kostet an die 12000 Euro wenn nicht mehr. Den konnte ich nicht einfach behalten, wenn ich ihn nie tragen wollte. Also rief ich Louise an, sie hatte ihren Absender samt Telefonnummer auf die Rückseite des Umschlags gestempelt. Sie war kein bisschen verlegen, freute sich über meinen Anruf, konnte gar nicht verstehen, warum ich das Tragen dieses Schmuckstücks makaber fände. ‚Aber zurücksenden kommt nicht in Frage‘, sagte sie, ‚verkaufe es einem Juwelier oder versetze es im Pfandhaus, und von dem Erlös kannst du ja Holgers Gedichte bei Books on Demand drucken lassen, darüber würde er sich bestimmt freuen. Und schicke mir bitte ein Exemplar zu!‘“
Unbescholten
Wie immer, wenn die Mädels sich trafen, wurde zuerst mal ein Weilchen Smalltalk gemacht, während das Müsli serviert wurde, Fairtradekaffee aus Kolumbien wurde getrunken, Else blieb bei ihrem Muckefuck, aber dann erhob Hedwig, die mit Ute ausnahmsweise pünktlich gewesen war, ihre Stimme: „Tut mir leid, aber ich muss euch heute eine Frage stellen: Bin ich eine unbescholtene Frau?“ Herta, Else, Ute und Ellinor waren baff.
„Warum fragst du uns das?“, riefen sie beinahe einstimmig.
„Es ist Aufnahmevoraussetzung für eine Gruppe, der ich gern beitreten möchte.“
„Du hast doch unsere Gruppe … Genügen wir dir nicht mehr?“, fragte Herta und blickte streng.
„Was heißt das überhaupt: ‚Unbescholtene Frau‘?“, wollte Else wissen.
„Gibt es auch unbescholtene Männer?“, fragte Ute nach. „Das ist doch ein lachhafter Ausdruck aus der Zeit, als Frauen nichts weiter waren als Möbelstücke im Haus ihrer Männer. Unbescholten hieß so viel wie unbeschädigt!“
„Und was sollte unbeschädigt sein? Der Ruf der Frau. Das ist des Pudels Kern!“ Ellinor sah sich um in dem Bewusstsein, den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben.
„Und ich würde sagen, liebste Edvigue, dein Ruf ist nicht nur unbeschädigt, er ist über jeden Zweifel erhaben.“ Ute legte ihrer Freundin den Arm um die Schultern und zog sie fest an sich. Hedwig war gerührt, schüttelte aber den Kopf.
„Dass ihr das sagt, ist klar, aber ihr werdet nicht gefragt.“
„Wo fängt die Bescholtenheit an?“, fragte Ellinor giftig. „Bin ich noch unbescholten, nachdem ich mich jahrelang von Holger, die Erde werde ihm leicht, habe mit Gedichten bombardieren lassen? Denn bei der Unbescholten- und Bescholtenheit geht es mit Sicherheit nicht um das Klauen silberner Löffel, sondern einzig und allein um das Verhältnis zum männlichen Geschlecht.“ Hedwig nickte traurig.
„Ja, und wer kann über den Ruf einer Frau kompetenter urteilen als ihr Ehemann? Amandus müsste meinen guten Ruf, meine Unbescholtenheit bestätigen, aber er ist dement. An wen wende ich mich? Wer kann ihn vertreten?“
„Zuerst, liebe Edvigue, sag uns mal, was für eine fatale Gruppe, ich könnte auch sagen: Was für ein reaktionärer Haufen ist es, dem du unbedingt beitreten möchtest und der so absurde Aufnahmekriterien in seiner Satzung hat?“ Ellinor war empört, dass Hedwig sich demütigen ließ. Diese war sichtlich verlegen, Auskunft geben zu müssen.
„Bitte versteht mich. Ich liebe euch alle von Herzen und treffe mich schrecklich gern mit euch, rede gern mit euch und habe auch so gut wie keine Geheimnisse vor euch. Aber ich sehne mich nach noch etwas anderem, nach einer Hierarchie, nach geheimnisvollen Ritualen, nach Worten, die meinem Leben einen tieferen Sinn geben …“
Herta schüttelte irritiert den Kopf. „Das ist die Kirche, aber die fragt nicht nach Unbescholtenheit. Im Gegenteil: ‚Wer wirft den ersten Stein?‘, hat Jesus gefragt, als es um die Ehebrecherin ging.“ Wieder schüttelte Hedwig traurig den Kopf.
„Nein, Herta, in die Kirche bringen mich keine zehn Pferde zurück. Ich will das nicht weiter begründen, weil ich dich nicht verletzen will. In Paris hatte ich einen guten Freund, der bei den franc-maçons war, den Freimaurern, und er wollte mich unbedingt in die dortige Frauenloge lotsen. Aber dann zogen wir zurück nach Hamburg und ich vergaß es. Amandus ging in Rente, wir zogen hier herauf, und eines Tages las ich in der Zeitung, dass sich in der Landeshauptstadt eine Frauenloge gegründet hätte. Amandus ist schwer krank, nur noch die äußere Hülle eines Menschen, ich brauche etwas, woran ich mich klammern kann, ich habe Kontakt zu der Loge aufgenommen und auch schon mehrere ihrer Gästeabende besucht. Es gefällt mir sehr gut bei ihnen, ihre Grundgedanken sind Toleranz, Menschenliebe und ständige Arbeit an sich selbst. Ich fühle mich immer so aufgeräumt und erquickt, wenn ich von ihnen heimfahre in mein trauriges Leben …“ Hedwig weinte, aber nicht nur sie benötigte ein Tempo, nur Herta blickte düster und verstimmt in ihre Kaffeetasse.
„Lebt dein Pariser Freund noch, Edvigue?“ Else fragte es und gab sich Mühe, harmlos dreinzublicken. Als Hedwig nickte, fuhr sie fort: „Steht Ihr noch in Verbindung?“ Wieder nickt Hedwig und putzte sich die Nase. „Welche Stellung hat er bei den franc-maçons?“ „Ich glaube, er ist Vénérable Maître in der Loge von Versailles, das entspricht dem Meister vom Stuhl.“ „Also ein großes Tier! Kannst du ihn nicht bitten, dass er sich für dich verbürgt?“ „Nein, er war in mich verliebt, und ich habe ihn schmoren lassen, das hat er mir bestimmt nicht verziehen.“ „Aber um so überzeugter kann er sich für deine Unbescholtenheit verbürgen!“ Else strahlte triumphierend. Ein widerwilliges Lächeln breitete sich über Hedwigs Gesicht aus. „Das ist ein neuer Aspekt, Else. Wir schreiben uns eigentlich nur zu Weihnachten – aber ich rufe ihn heute noch an!“
„Unbescholten sind Frauen, die ihre Verehrer schmoren lassen!“ Mit diesem Satz fasste Ute zur Erheiterung aller die Erkenntnis des Plauschs zusammen. Herta wollte sich verabschieden, aber die Mädels bestanden darauf, dass sie noch auf ein Glas Freixenet Asti blieb, und Ellinor sagte: „Herta, ich habe deinen Mann am Samstag in der Michaelskirche spielen hören, ich glaube, es war der Kanon von Pachelbel – wunderbar, vor allem die Zartheit der ausgewählten Register war betörend …“ „Ja, das kann er,“ sagte Herta versöhnt. „Und ich bin auch sehr froh, dass du, Hedwig, nur zu den Freimaurern übertreten willst und nicht zu noch Schlimmerem!“ Die Gläser klangen zusammen – doch Ute ließ noch eine Bombe platzen:
„Ratet mal, wer mich angesprochen hat und uns einen Job anbietet! Ihr kommt nicht drauf: Max Matzke, der momentane Regisseur von ‚Kornblumenblau‘! Er hat uns, als er hier auf der Suche nach Kamerapositionen herumlief, beisammensitzen gesehen und gedacht: Genau so eine Gruppe brauche ich, um das Bahnhofsinnere zu beleben! Er fragt, ob wir am Donnerstag um 14.30 Uhr hier zusammenkommen könnten! Als Statistinnen bekommen wir Mindestlohn! Und müssen nur eine Stunde beisammen sitzen – und uns selbst spielen!“
Der anonyme Brief
Nach ihrem Auftritt als Statistinnen in „Kornblumenblau“ kamen die Mädels in betont abgerissener und sorgloser Kleidung wieder zusammen, trugen absatzlose Schuhe und löchrige Jeans sowie zu große Pullover in Farben wie Grau, Blau und Olivgrün, kaum Schmuck – nur Hedwigs silberner Napoleon Bonaparte war wieder dabei. Sie hatten sich für die Filmaufnahme dermaßen schick gemacht, dass Max Matzke sie wieder nach Hause geschickt hatte. „Zieht Alltagsklamotten an!“, hatte er sie grinsend gebeten, „ich brauche keine aufgebrezelten Tussis!“ Betroffen und beschämt hatten sie vorgehabt, gar nicht wieder in den Bahnhof von LUNDEN zurückzukehren, aber dann dachten sie, es sei witzig, ins andere Extrem zu verfallen, und was sie dann anzogen, das trugen sie auch jetzt.
„Der Anfang unserer Filmkarriere war nicht eben ein Ruhmesblatt,“ sagte Else bedauernd, die ein mausgraues abgetragenes Kostüm ihrer Mutter ausgegraben hatte. „Aber ich finde es gut, dass Matzke unserer Eitelkeit eine Lehre erteilt hat.“
Während die Mädels rekapitulierten, wie sie sich aufgedonnert hatten, brütete Herta schweigend und lustlos über ihrem Tortenstück. „Herta, was hattest du dir noch mal angetan? War es nicht das schwarze Kleid mit weißem Krägelchen, das du auch anziehst, wenn du in der Kirche aus der Bibel liest?“ Ellinor versuchte, die Verdüsterte mit ins Gespräch zu ziehen. Aber Herta schrak nur auf, sah hilfesuchend von einer zur anderen und wusste offenbar nicht, worum es ging. „Was ist mit dir los, Herta?“ Ellinor verstand es trefflich, nachzubohren. Wenn sie etwas wissen wollte, bekam sie es auch heraus. „Du bist doch sonst nicht so. Wenn irgendwas dich bedrückt, dann spuck es aus und unterbreite es der geballten Urteilskraft von vier lebenserfahrenen Frauen, die dir durchaus wohlgesonnen sind.“
„Nein, es ist nichts. Ich habe da nur einen Brief an Frank abgefangen, den ich besser sofort in den Papierkorb geschmissen hätte. Er war mir suspekt, weil die Adresse aus ausgeschnittenen Druckbuchstaben zusammengeklebt war. Nun, zum Inhalt will ich mich nicht weiter äußern. Es ist zu peinlich.“
„Mach keine halben Sachen, Herta. War es ein Drohbrief? Hat Frank Feinde?“
„Ein Drohbrief war es in gewisser Weise schon. Es lag ein Foto dabei, dessen Veröffentlichung Frank schaden würde. Und der Absender drohte, er würde es veröffentlichen, wenn Frank nicht …“ Herta konnte nicht weiter sprechen. Es verschlug ihr die Sprache. Aber Else hatte die Ergänzung sofort parat:
„… wenn er nicht so und so viel zahlt.“ Herta nickte. „Also ein Erpresserbrief.“ Herta nickte erneut. „Aber womit wird Frank erpresst? Was zeigt das Foto? “
Herta kramte stöhnend in ihrer Handtasche und holte den Umschlag hervor, nahm das auch aus Druckbuchstaben zusammengeflickte Schreiben und das Foto heraus und ließ die Mädels es lesen und betrachten. Aber mehr als ein knurriges „Hm!“ war von ihnen nicht zu vernehmen. „Das wirft Fragen auf!“, sagte Hedwig schließlich. „Kannst du uns was dazu sagen?“
„Was soll ich dazu sagen? Ich möchte mich von Frank trennen. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Aber nach fast dreißig Jahren Ehe ist das kein Kinderspiel. Außerdem ist er eine Säule der Gemeinden, in denen er als Organist und Chorleiter wirkt. Es ist eine Katastrophe!“
Arbeiter kamen herein und trugen das Schild LUNDEN hinaus. Offenbar sollte gedreht werden. Ein smarter Produktionsleiter, der sich als Massimo vorstellte, federte auf riesigen Sneakern herbei und informierte sie: Die Szene am und im Bahnhof müsse nachgedreht werden, weil der mit der Bahn ankommende Lover umbesetzt worden sei. Sie sollten einfach sitzen bleiben und die Kamera ignorieren. Im Fußball sei der Schiedsrichter Luft, im Filmgeschäft die Kamera, ergänzte er klug.
„Was wir reden, wird nicht aufgenommen?“, vergewisserte sich Ute.
„Nein, ihr könnt Blablabla machen oder auswendig Gelerntes aufsagen, nur den Mund bewegen, das müsst ihr! Und ein bisschen Lebhaftigkeit kann auch nicht schaden!“ Massimo verschwand.
Nun wurden aber doch Haare zurechtgerückt und -gedrückt, Hedwig legte Rouge auf, Kajalstifte wurden gezückt, und es dauerte ein Weilchen, bis sie zu dem Brief zurückgefunden hatten.
„Dann mache ich gleich mal den Anfang!“ Ellinor sah sich das Foto noch einmal scharf an. „Das ist eindeutig dein Mann, Herta. Und eine Fotomontage scheint es auch nicht zu sein. Wie kam es zu dem Foto?“
„Frank leitet doch einen Chor in Apenrade. Bei der Hin- oder Rückfahrt über die Grenze konnte er offenbar der Versuchung nicht widerstehen, mal in eins dieser Kinos zu gehen, die sind in Dänemark ja erlaubt.“
„Wie lange leitet er den Chor schon?“ wollte Else wissen.
„Seit zehn Jahren.“
„Dann besucht er diese Kinos auch schon seit zehn Jahren,“ sagte Else brutal. „Und du kannst froh sein, vielleicht wäre eure Ehe schon längst im Eimer, wenn er sie nicht besuchte.“
„Mein Mann hat mich mit seinen Sekretärinnen betrogen, jedes Jahr mit einer anderen,“ seufzte Ellinor, „das war sehr viel schmerzhafter. Aber ich hatte ja Holger, dessen Muse ich war – immerhin! Doch zurück zu der Erpressung: Frank soll auf keinen Fall zahlen! Wenn sie das Foto an die Kirchenleitung oder die Presse schicken, wie sie androhen, verlieren sie das Druckmittel. Ihnen geht es nur um Geld. In den Papierkorb mit dem Zeug! Aber Frank zur Rede stellen würde ich auf jeden Fall.“
„Das habe ich schon getan.“
„Und was hat er gesagt?“
„Er sei froh, dass ich es herausbekommen hätte. Er litte furchtbar unter seinem – Trieb, manchmal könne er kaum noch den Chor dirigieren, weil er immer an die Unterwäsche der jungen Sopranistinnen denken müsse, und von denen habe er leider viele.“
„Und was hast du gesagt?“
„Aber du hast doch mich!“ Ellinor, Else, Hedwig und Ute lächelten gerührt, schauten einander vielsagend in die Nornengesichter und staunten, als plötzlich eine Flasche Veuve Clicquot auf dem Tisch stand. Massimo kam herbeigefedert und bedankte sich: „Bravo! Habt ihr toll gemacht! Die Flasche geht auf die Produktion!“ Er entkorkte sie professionell, ließ sich auch ein Glas bringen und stieß mit ihnen an.
Als er weg war, rief Ellinor mit erhobener Tulpe: „Wohlsein, Herta – und auf weitere zehn Jahre mit deinem Lustmolch!“
Der Koffer
Herta schüttelte den Kopf und sagte: „Ellinor, ich möchte dir nicht immer widersprechen. Aber damit gehst du wirklich zu weit. Den Tod eines Menschen darf man nicht herbeiwünschen, da mag er noch so sehr leiden, oder wenn man es tut, darf man es doch nicht aussprechen. Ich weiß, dass Alfons Schreckliches mitgemacht hat, erst die Chemo, jetzt die Bestrahlung, und das zermürbende Auf und Ab von Hoffnung und Verzweiflung. Ich kann verstehen, dass du dir wünschst, es möge endlich ein Ende haben. Aber das Ende eines Menschen liegt in Gottes Hand. Es bleibt uns nur, das in Demut hinzunehmen.“
„Warum sollte man es nicht aussprechen dürfen, wenn man es fühlt?“ Else nippte an ihrem Kathreiner Malzkaffee, düstere Falten bildeten sich zwischen ihren Brauen. „Das ist es, was ich an den Christen am meisten hasse: Dass sie nicht ehrlich sind. Sie wünschen sich auch den Tod eines Menschen – aber sie verbieten es sich, das auszusprechen. Ja, sie heucheln vielleicht noch liebevolle Fürsorge, und in Wirklichkeit würden sie ihm am liebsten das Kissen übers Gesicht drücken.“
Herta stand auf, ließ ihr Bircher halb ungegessen stehen und wollte gehen. Aber an der Tür, neben der das Bahnhofsschild LUNDEN an der Wand lehnte, lief sie Hedwig und Ute in die Arme und musste ihnen erklären, warum sie gehen wollte. „Ich lasse mir von Else keine Heuchelei und Mordabsichten unterstellen,“ sagte sie, und es zuckte um ihre Mundwinkel. „Ellinor hat gesagt…“
„Das klären wir!“, sagte Hedwig resolut und bugsierte Herta wieder vor ihr Müsli. Ute schleppte einen nicht ganz kleinen Koffer herein, den sie unter den Tisch schob. Und merkwürdigerweise begrüßte sie die anderen nicht wie üblich mit „Hallo Mädels!“, sondern mit „Hallo Schwestern!“ Die Verwunderung darüber war jedoch vergessen, als Ellinor zugab, den Tod ihres schwer an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankten Mannes herbeizuwünschen. „Einen Hund, der so leidet, würde der Tierarzt erlösen dürfen. Ich sehe nicht ein, dass Alfons nicht auch ein Recht darauf hat.“
„Und ich habe nur gesagt, sowas darf man vielleicht mal wünschen, aber man darf es nicht aussprechen – und werde der Heuchelei bezichtigt!“ Wütende Tränen traten in Hertas Augen, sie hätte Else am liebsten mit Müsli beworfen.
„In Holland hat man einen rechtlichen Weg gefunden, um solch ein Recht durchsetzen zu können. Wir hier in Deutschland haben den Begriff der Euthanasie durch die ‚Vernichtung lebensunwerten Lebens‘ so in Verruf gebracht, dass wir uns an die Sterbehilfe nicht herantrauen. Und damit möchte ich Ute das Wort geben. Sie hat nämlich auf ihrem Dachboden einen Fund gemacht, der auch uns Mädels betrifft!“
Mit geheimnisvollem Lächeln wuchtete Ute den Koffer auf den Tisch. Er war aus Presspappe, mit Holzleisten beschlagen, graubraun angestrichen, doch der Anstrich blätterte ab. In schwarzer Schablonenschrift stand SCHF LYDIA SEIFERT darauf.
„Nach dem Tod meiner Mutter vor einem Vierteljahr haben wir den Dachboden entrümpelt und sind dabei auf diesen Koffer gestoßen. Eigentlich wollte ich ihn samt Inhalt auf den Müll tun, aber dann dachte ich: Das wäre Feigheit. Zu dieser Vergangenheit meiner sehr geliebten Großmutter muss ich stehen. Sie hat nie ein Wort darüber verloren, wir glaubten, sie wäre nie etwas anderes gewesen als Hausfrau und Verfertigerin wunderbarer Strickarbeiten. Der Norwegerpullover, den ich trage, ist von ihr … Insofern war diese Kiste ein gelinder Schock für uns, meine Schwester und mich.“ Herta, Else und Ellinor beugten sich neugierig über den geöffneten Koffer, nahmen die Sachen vorsichtig heraus und zeigten sie einander.
Unter bereits zerfallendem Seidenpapier fanden sie ein Nadelbüchlein samt Stopfpilz und Fingerhut, Nähschere, ein Kästchen Nähseide, mehrere Sterne Zwirn und darunter zehn kurzärmlige weiße Blusen, zwei schwarze Dreieckstücher, drei schwarze Röcke, eine Kamelhaarwolldecke und ein paar gestrickte Zeltschuhe. Dazu noch eine grüne Schnur mit Karabinerhaken und drei Garnituren Leibwäsche, kleine Taschentücher mit eingesticktem Monogramm, zwei Indanthren-Frotteetücher, eine Schachtel mit drei Kernseifestücken, eine Kleiderbürste und ein kleines elektrisches Bügeleisen.
„Wollte sie auf Reisen gehen? Hatte sie ein Amt? Irgendwie erinnern mich die Kleidungsstücke an was, ich weiß aber nicht an was.“ Ellinor blickte ratlos in die Runde.
„Sie war Scharführerin beim Bund deutscher Mädel,“ sagte Ute mit einer bizarren Mischung aus Stolz und Scham. „Das beweist diese grüne Schnur und auch die Beschriftung des Koffers. Was mich erschüttert, ist die rührende Ordnungsliebe, in der erkenne ich ganz und gar meine liebe Großmutter.“ Sie nahm eines der Taschentücher mit Monogramm heraus und tupfte sich damit die Augen. „Sie war für mich immer der beste Mensch auf der Welt – fürsorglich, selbstlos, humorvoll. Ich bin sicher, sie war eine gute Scharführerin und wurde von ihren Mädels geliebt. Aber ich finde, wir sollten einander nicht mehr mit diesem Naziwort Mädel anreden. Edvigue hat mir erzählt, dass die Frauen bei den Freimaurerinnen einander ‚Schwester‘ nennen. Wollen wir das nicht auch tun?“
„Nein,“ sagte Else nach kurzem Zögern. „Wir lassen uns das von den Nazis nicht wegnehmen. Die hatten auch alle eine Nase. Sollen wir uns die Nase abschneiden, nur um ihnen nicht zu ähneln?“ Wenig später klangen die Gläser zusammen, und „Prost Mädels!“, scholl es vielstimmig durchs Bahnhofscafé.
Die Hexe von Windsor
„Was ich bereue? Dass ich den anonymen Brief an Frank nicht gleich in den Papierkorb geworfen habe.“ Herta blickte bekümmert in die Runde. Ellinor hatte die Idee gehabt, dass sie beim nächsten Treffen einander mal erzählen sollten, was sie bereuten. Else war an der Reihe.
„Ich bereue, mein Kind zur Adoption freigegeben zu haben. Als ich es tat, dachte ich, ich würde noch andere Kinder und das in ordentlichen Verhältnissen bekommen. Aber es hat sich nicht ergeben. Es war eine Tochter, ich weiß, wo sie lebt – aber sie will nichts von mir wissen, und das kann ich ihr nicht einmal verdenken.“
„Bei mir ist es so ähnlich – nur noch schlimmer,“ sagte Ute. „Ich habe ein Kind, das ich erwartete, abgetrieben. Ich war noch sehr jung, wäre bestimmt keine gute Mutter gewesen.“ Sie schniefte kurz in ein Tempo. „Auch wenn es bei mir als allein erziehender blutjunger Mutter sicherlich nicht das beste Zuhause gehabt hätte – aber Pedro wäre jetzt erwachsen und würde sich vielleicht mal um mich kümmern.“
„Oder auch nicht,“ ergänzte Hedwig. „Ich habe drei erwachsene Kinder, aber sie denken gar nicht daran, sich um mich zu kümmern. Nicht einmal ihr schwer kranker Vater interessiert sie. Vorgedruckte Weihnachtskarten, das ist alles, was wir von ihnen zu sehen bekommen. Ich bereue, sie nicht zu mehr Liebe zu ihren Eltern erzogen zu haben. Aber ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe.“
„Und das können wir hier sicherlich in der Kürze der Zeit auch nicht herausbekommen,“ sagte Ellinor. „Ihr wisst, dass das Café heute für eine Schlägerei zwischen Befürwortern und Gegnern der Flüchtlingspolitik in ‚Kornblumenblau‘ gebraucht wird, dann sind wir nicht mehr erwünscht. Ich bin mit meinen drei Töchtern sehr glücklich und habe auch bereits zwei süße Enkelchen. Ja, was bereue ich? Ich bereue, dass ich drei Jahre Mitglied einer total lächerlichen Politsekte war.“
„Verrätst du uns auch deren Namen?“ Else nippte am Ersatzkaffee.
„Nicht so gern, Metastasen dieser Gruppierung befinden sich noch immer im Land und sind sehr prozessfreudig.“
„Und warum bereust du diese Mitgliedschaft?“
„Nun, sie verfolgten Ziele von so abstruser Absurdität, dass ich mich heute noch frage, wie ich darauf habe hereinfallen können. Der Grund war sicherlich, dass meine Eltern mir den Umgang mit dieser Partei verboten, und ich wollte mir von meinen Eltern, die in der Nazizeit brave Mitläufer, wenn nicht mehr, gewesen waren, nichts mehr verbieten lassen. Der erste Kontakt hatte sich durch einen Zufall ergeben. Ich jobbte als Kellnerin in einem Biergarten, in dem sie tagten, und sie fielen mir durch ihr absolut gesittetes Betragen auf. Als Kellnerin wurde man damals von den meisten Männern als Freiwild angesehen – aber nichts dergleichen. Sie waren nicht nur schick angezogen, sondern benahmen sich auch vorbildlich und drückten mir einen Flyer in die Hand, in dem sie sich sehr klar für eine schärfere Bestrafung des Handels und Konsums von Drogen aussprachen. Das gefiel mir, weil mein Bruder bereits an der Nadel hing.“
„Aber das ist doch ein durchaus verständliches Ziel! Auch ich kann nicht begreifen, dass es offenbar völlig unmöglich ist, dieser Pest ein Ende zu bereiten.“ Herta schaute empört in die Runde.
„Nun, das war bei weitem nicht alles! Sie führten den Drogenhandel auf die Mafia und diese auf ein Komplott zwischen CIA, KGB, Mossad, Vatikan und englischer Krone zurück. Das wurde uns in vierteljährlichen Schulungen eingetrichtert und es macht mich heute noch fassungslos, dass ich das alles geglaubt habe und dafür auf die Straße gegangen bin. Wenn im Wahlkampf die spießigen anderen Parteien an ihren Ständen standen, fielen wir blitzartig über sie her, verstreuten ihr Material in alle Winde und riefen: ‚Hängt die Hexe von Windsor!‘ So nannten wir Königin Elizabeth II. im Glauben, sie sei die Wurzel allen Übels.“
„Das ist in der Tat abenteuerlich!“ Herta schüttelte staunend den Kopf. Die Mädels machten Gesichter, als ob sie nicht wüssten, ob sie lachen oder weinen sollten. Die Tür des Cafés wurde aufgestoßen und die bunt gemischten Gruppen stürzten herein, die sich in eine Schlägerei verwickeln sollten. Die Mädels sprangen auf, offenbar mussten sie verschwinden. Aber Massimo kam lächelnd herbeigefedert und gebot ihnen Einhalt: „Ich habe mit Max gesprochen. Wir rücken euern Tisch an die Wand – und ihr unterhaltet euch weiter, als ob nichts wäre! Das gibt einen hübschen Kontrast!“ Gesagt, getan! Im Nullkommanichts saßen sie neben der Tür an der Wand, wo das Schild LUNDEN lehnte, und Ellinor berichtete über weitere unfassbare Details; so wurde diesem Komplott unter Führung der Hexe von Windsor auch die Ermordung der Brüder Kennedy in die Schuhe geschoben; und die niedrigen Wahlergebnisse der Splitterpartei beruhten natürlich, wie konnte es anders sein, auf Wahlbetrug! Und während im Saal die Fetzen flogen, Stühle zerteppert wurden und Rufe wie „Wir schaffen das!“ und „Das ist Umvolkung!“ durch die Luft flogen, verdrückten die Mädels ein zweites Stück Schwarzwälder Kirsch.
Pedro
„Wir haben eine syrische Familie bei uns im Souterrain aufgenommen. Sie haben zwei Kinder und sind alle sehr lieb.“ Herta war offensichtlich nicht wenig stolz auf ihre Liberalität und Willkommenskultur.
„So sind sie am Anfang immer,“ sagte Else. „Sie kennen hier nichts und niemand und sind völlig auf euch angewiesen. Aber lasst sie erstmal ein paar Monate hier sein, dann werdet ihr euer blaues Wunder erleben. Nein, ich beschränke mich darauf, für die Gemeinde gelegentlich zu dolmetschen. Ich kann ganz gut Arabisch, seit ich an der deutschen Schule in Amman war.“
„Bei mir wäre auch Platz für eine Flüchtlingsfamilie. Aber Pedro rät mir eindringlich ab, mich auf sowas einzulassen.“ Ute nippte am fair gehandelten Kaffee, während die anderen Mädels einander verstohlene Blicke zuwarfen. „Er sagt, es würde mich überfordern. Man wisse doch nie, sagt Pedro, was solche Leute einem an schrecklichen Erfahrungen, vielleicht an Traumata ins Haus schleppten, sie würden davon erzählen und uns damit belasten. Stellt euch z.B. vor, es sind Leute, die Zeugen der Ermordung ihrer Eltern oder ihrer Kinder geworden sind …“ Utes Gesicht war bei der bloßen Vorstellung von Fassungslosigkeit gezeichnet.
Ellinor wollte das so nicht stehen lassen. „Aber dafür nehmen wir doch Flüchtlinge auf, auch um das viele Leidvolle, dass sie erlebt haben, mit ihnen zu teilen. Ist Pedro Psychologe, dass er dir solche Ratschläge gibt?“
„Ach, habe ich euch das noch nicht gesagt? Ja, er ist seit kurzem Arzt an der jugendpsychiatrischen Klinik Avanzada in Barcelona. Wir telefonieren fast täglich miteinander, und ich bin überglücklich, ihn immer um Rat fragen zu können.“ Ute strahlte. Else aber blickte sehr verwundert in die Runde und wollte gerade eine ihrer gefürchteten Bemerkungen machen – da spürte sie plötzlich den Fuß Ellinors auf dem ihren, und Ellinor gab ihr mit einem kaum sichtbaren Hin und Her ihres Kopfes zu verstehen, dass sie den Mund halten sollte.
„Sag uns doch, warum du heute ohne Hedwig gekommen bist!“ Ellinor wollte Ute offenbar ablenken, aber das gelang ihr nicht.
„Edvigue musste bei Amandus bleiben, der seine Schmerzen nur noch unter Morphium erträgt. Pedro rät mir eindringlich ab, jemals Morphium oder Opioide zu nehmen, weil der Suchtfaktor zu hoch ist, aber Edvigue wird frech, wenn ich ihr so was sage und hat mich angeschrien: Mein Pedro könne ihr mal im Mondschein begegnen! Ich glaube, wir müssen uns dringend um sie kümmern, denn die Qualen, die ihr Mann durchlebt, machen sie verrückt vor Mitleid, Pedro sagt, Menschen können auch vor Mitleid sterben … Es tut mir leid, Mädels, ich muss raus, der Elfuhrzug kommt gleich, und Pedro hat gesagt, er komme heute, wenn alles klappt, mit diesem Zug an.“ Ute stand auf, verabschiedete sich von Herta, Else und Ellinor mit Küsschen und ging hinaus. Tiefes Schweigen herrschte am Tisch, als sie gegangen war.
„Barcelona! Avanzada!“, sagte Else kopfschüttelnd. „Warum versetzt sie ihn nach Barcelona?“
„Der Mann, von dem sie schwanger war, war doch Spanier,“ sagte Ellinor.
„Sollte nicht jemand mit gehen – um sie aufzufangen, wenn er nicht kommt?“ Herta machte sich Sorgen. Aber Else runzelte die Stirn.
„Wenn er nicht kommt, und er wird nicht kommen, weil es ihn gar nicht gibt, dann telefoniert sie mit ihm, und er kann ihr sicherlich alles zufriedenstellend erklären. Ich brauche jetzt einen Korn!“
Fragwürdigstes
Hedwig sah toll aus in ihrem schwarzen Witwenkleid von Balmain, d.h. es war ein anthrazitfarbener Hosenrock mit Weste und Bluse aus Crêpe de Chine, und sie hatte schon gesagt, dass sie anschließend noch zu den Freimaurerinnen gehen wollte. Erwartungsvoll sahen Herta, Else, Ellinor und Ute sie an. Sie waren alle auf der Beerdigung von Amandus gewesen und hatten geweint, als sie sahen, mit welcher Liebe sie die blauweiß gestreifte, von der IBM gespendete Urne mit den Armen umfing. Aber Hedwigs Eröffnung war enttäuschend. Sie berichtete nämlich nur von ihrem kaputten Receiver. Sie benötigte einen, weil sie fürs Fernsehen einen brauchte. Ihr Haus, ein alter Dreiseithof, war auf die Dachantenne angewiesen, weil es unter Denkmalschutz stand, ein Satellitenspiegel hätte die Harmonie des Denkmals verunziert – aber der Receiver funktionierte nicht, dauernd fiel er aus und musste neu booten, was besonders während eines Krimis sehr ärgerlich war, und Hedwig schaute gern Krimis. Sie erklärte die Umstände so gründlich, dass Else bereits mit den Augen rollte, was Herta gern als frommen Blick zum Himmel gedeutet hätte.
„Nun, und da habe ich Fernseh-Schmidtchen angerufen und sie haben mir diesen – Techniker geschickt, von dem ich euch erzählen muss. Ich verdanke ihm – nein, das glaubt Ihr mir einfach nicht, ich muss es anders anfangen.“ Hedwig ließ ihren Kuchen zurückgehen, sie müsse sich mit Fett und Zucker zurückhalten. Ellinor blinzelte Ute zu – sie waren sich einig, dass die frischgebackene Witwe figurbewusste Pläne für die Zukunft schmiedete.
„Ich muss ein wenig ausholen,“ fuhr Hedwig fort. „Ihr erinnert euch sicherlich an Amandus und an seine Stimme. Er war ein stattlicher Mann – in seinen guten Jahren – aber seine Stimme war ein wenig zu hoch, selbstkritisch nannte er sie seine Fistelstimme und war der Meinung, er hätte bei IBM mit einer ordentlichen Stimme ganz anders Karriere machen können. Wenn er sich aufregte und laut werden wollte, überschlug sie sich – und dann verstummte er sofort und war wütend auf sich selbst und dieses unkontrollierbare Organ … Soviel vorweg, ihr Lieben, denn was sich dann zutrug, als Herr Schlodenski, so hieß er, meinen Receiver reparierte, ist unfassbar. ‚Sie sind in Trauer,‘ sagte er und schraubte. ‚Wie kommen Sie darauf?‘, erwiderte ich schroff. ‚Das spüre ich,‘ sagte er, ‚es gehen immaterielle Algorithmen von Ihnen aus, die ich entschlüsseln kann.‘ Nun fing ich an zu weinen, denn er hatte ja Recht, und Mitgefühl von unerwarteter Seite ist so – wohltuend! ‚Und die Trauer um Ihren Mann ist besonders heftig aus einem bestimmten Grund – aber den vermag ich nicht zu entschlüsseln. Haben Sie ihm etwas Wichtiges nicht mehr sagen können?‘ Nun heulte ich noch mehr, denn es war genau das Gegenteil. Amandus ist Anthroposoph und weigerte sich, Schmerzmittel zu nehmen, und wenn die Schmerzen ihn überwältigten, schrie er so furchtbar, dass ich selbst verrückt zu werden fürchtete, ihn anschrie, als Heulsuse beschimpfte und ihm mit der Morphiumspritze drohte, aber die fürchtete er noch mehr und schrie noch lauter und mit sich überschlagender Fistelstimme: ‚Nein – nein – der Krebs tötet nur meinen Leib, Morphium tötet meine Seele!“ Ich rannte raus, schlug die Tür zu, legte ‚Je ne regrette rien‘ auf und stellte es so laut, dass ich Amandus nicht mehr hörte, rauchte mehrere Gitanes und trank Rotwein, aber als ich es zehnmal gehört hatte, merkte ich, dass er still geworden war, schaute zu ihm ins Zimmer – und da lag er mit offenem Mund in einem See von erbrochener schwarzer Galle …“
„Hör auf!“, rief Ute, „das ist nicht auszuhalten!“
„Das sagte Herr Schlodenski nicht, dem ich das erzählte. Er beendete seine Reparatur, testete den Receiver, er lief gut. Er stand auf und fragte: ‚Würde es Ihre Trauer lindern, wenn Sie noch einmal mit Ihrem Mann sprechen könnten?‘ ‚Das ist ja leider unmöglich!‘, war meine Antwort. ‚Nicht so ganz,‘ erwiderte Schlodenski. „Wenn Sie mir seinen Lieblingsplatz zeigen, könnte ich versuchen, ihn in mir immateriell zu konkretisieren. Ich leihe quasi seiner Seele meinen Leib!‘ ‚Meinen Sie das ernst?‘ Er nickte. ‚Es ist aber sehr anstrengend, weil die Berechnungen sehr komplex sind,‘ sagte er, als er sich auf Amandus‘ Lieblingssessel niederließ. ‚Was machte er hier?‘ ‚Er trank Pastis und las Le Monde. Hier liegt noch das letzte Exemplar, das er in Händen gehalten hat.‘ ‚Bring mir einen Pastis, Edvigue!‘, sagte er, lehnte sich zurück und hob die Zeitung vor sein Gesicht. Mir lief es kalt über den Rücken. Woher kannte er meinen Namen in der französischen Form? Ich brachte ihm den Anislikör, er goss ihn auf und trank ihn wie Amandus in kleinen genießerischen Schlucken. ‚Warum gönnst du mir nicht meine Ruhe?‘ fragte plötzlich die unverkennbare Fistelstimme, ich wich zurück – aber dann fiel ich auf die Knie und sagte: ‚Verzeih mir, Amandus! Ich habe dich angeschrien – und dabei warst du so tapfer!‘ ‚Ich weiß nicht, worum es dir geht.‘ ‚Verzeih mir,‘ schrie ich, ‚bitte verzeih mir, ich habe dich bis zur letzten Sekunde …‘ ‚Sei ruhig‘, schnitt er mir energisch das Wort ab und seine Stimme überschlug sich. ‚Ich danke dir, du dumme Gans! Du hast mir geholfen, los‘ … Die Zeitung sank herab, Schlodenski saß erloschen da. ‚Tut mir leid, ich habe nicht durchgehalten,‘ sagte er mit seiner normalen Stimme und stand auf. ‚Ich sagte schon, es ist sehr anstrengend und würde vielleicht sogar einen Quantencomputer überfordern.‘“ Hedwig verstummte.
Die Mädels schwiegen, Ellinor tippte die Krümel ihrer Torte auf, Herta schaute düster in ihren Kaffeesatz. Else raffte sich schließlich auf und fragte: „Hat er Geld verlangt für sein Zauberkunststück?“
„Ich habe ihm welches angeboten, aber er hat es abgelehnt.“
„Und geht es dir besser seit diesem – Kontakt?“
„Ja – etwas. Er hat mich ‚dumme Gans‘ genannt. Jetzt sind wir quitt. Und wofür er sich bedankt hat, das verstehe ich, glaube ich, auch.“
„Den würde ich gerne mal holen, um meine Großmutter zu fragen, warum sie Scharführerin beim BdM geworden ist und uns das nie erzählt hat …“ Ute begeisterte sich bei der Vorstellung, Lydia Seifert zur Rede zu stellen – und beinahe hätte sie auch noch Pedro erwähnt. Aber der war ja nicht tot, sondern lebte vergnügt in Barcelona! Aber Hedwig sagte:
„Ich habe bei Fernseh-Schmidtchen angerufen und mich für den tollen Techniker bedankt, den Sie mir geschickt haben. Doch ein Herr Schlodenski war dort nicht bekannt.“
Der Prinz
Erschöpft von den Feiertagen, trafen sich die Mädels wieder zu ihrem alldienstäglichen Frühstück im Bahnhofscafé von Sandbergen; denn LUNDEN war natürlich nur der Ortsname in der Serie „Kornblumenblau“, in Wirklichkeit lebten sie in einer Gegend, die man auch gut als Streusandbüchse bezeichnen könnte, auf einem norddeutschen Geestrücken, den die enormen Wandergletscher der Eiszeit dort hinterlassen hatten. Hedwig, war jetzt immer pünktlich, da sie keinen zu pflegenden Mann mehr hatte, was sie einerseits erleichterte, andererseits aber auch in ein abgrundtiefes Loch fallen ließ.
„Für mich waren die Feiertage die Hölle,“ sagte sie, appetitlos an einem Quarkbällchen knabbernd, mit dem sie die Schwarzwälder Kirschtorte diätetisch ersetzte. „Überall war von einem Säugling die Rede, der in einer Krippe lag – hatte nicht auch ich süße Kinder gehabt – aber als sie erwachsen wurden, zogen sie weg, ließen sich ihr Studium von uns finanzieren und seither bekomme ich nur noch vorgedruckte Grußkarten von ihnen – und kann mein eigen Fleisch und Blut nicht mehr in den Arm nehmen. Ich sollte wütend auf sie sein, weil sie nicht einmal zu Amandus‘ Begräbnis gekommen sind – aber ich kann es nicht.“ Else legte ihre Hand auf Hedwigs Hand, die sich klein wie ein Mäuschen darunter duckte.
„Vielleicht geht es dir so wie mir. Plötzlich steht ein Mensch vor dir, du erkennst ihn nicht, und er entpuppt sich als – deine Enkelin!“ Ein verhaltenes Strahlen brach aus Elses sonst so strengem Gesicht. Die Frauen schwiegen und sahen sie staunend an. Eine Enkelin? Wo sie ihr Kind doch zur Adoption weggegeben hatte? Herta sagte:
„Du hast mich ja schon angerufen und mir mitgeteilt, dass sich bei dir etwas Wunderbares ereignet habe, du wolltest mir aber nicht sagen, was. Du hast sogar von ‚gnadenbringender Weihnachtszeit‘ gesprochen – ich traute meinen Ohren kaum.“
„Dabei war der Anfang alles andere als harmonisch … Sophie hat Heiligabend ihre Mutter gebeten, ihr endlich zu sagen, wer ihr Großvater mütterlicherseits ist. Und als Carola, so wurde meine Tochter von ihren Adoptiveltern genannt, sagte, das wisse sie nicht, wurde Sophie wütend, hat meine Adresse auf dem Umschlag der Weihnachtskarte gefunden, die ich geschickt hatte, und ist durch Wind und Regen zu mir gelaufen, und da stand der klapperdürre Backfisch nun vor mir, klatschnass, und sah mich so hilfesuchend und flehentlich an, dass ich sie bei mir aufnehmen musste, auch wenn ich noch gar nicht wusste, wer sie war. Und als sie mir das verriet, musste ich sie erst einmal in den Arm nehmen und fast totdrücken …“ Else stand auf, entschuldigte sich zur Toilette und ließ die Mädels rätselnd zurück. Ellinor fasste zusammen, was sie wusste:
„Mir hat Else mal erzählt, dass sie von ihrer Zeit als Lehrerin in Amman schwanger zurückkehrte. Aber den Vater des Kindes wollte sie partout weder benennen noch beschreiben, ja, sie behauptete sogar, es gäbe keinen, sie habe in Jordanien mit niemandem geschlafen. Es habe zwar einen Schüler gegeben, der sie recht schamlos angehimmelt habe, aber um den habe sie schon allein deshalb einen großen Bogen gemacht, weil er erstens ihr Schüler und zweitens ein Prinz aus der Familie der Haschemiten war, die auch das Königshaus stellt.“ Man hörte die Toilettentür ins Schloss fallen. Ellinor sagte: „Aber dazu wird sie uns bestimmt noch was zu erzählen haben.“ Else kam zurück, sie hatte sich frisch gemacht und Make-up benutzt.
„Ist Sophie magersüchtig?“, wollte Herta wissen. „So wie du sie beschreibst, ist das anzunehmen.“
„Sie war magersüchtig. Inzwischen isst sie wieder ganz gut. Natürlich rief Carola tags darauf an und verlangte von mir, dass ich Sophie zu ihr zurückbrächte. Sie sei anorektisch und dürfe der angefangenen jugendpsychiatrischen Behandlung keinesfalls entzogen werden. Als ich ihr aber sagte, Sophie habe bei mir mit gutem Hunger zwei Teller roten Heringssalat gegessen, wollte sie mir das nicht glauben, gab aber schließlich auf und überließ mir Sophie für drei Tage, die sie dann noch mal auf vierzehn Tage verlängerte. Und ich glaube sagen zu dürfen, dass Sophie förmlich aufblüht, seit sie bei mir ist.“
„Und hast du die Frage, deretwegen sie zu dir gekommen ist, beantworten können?“ Hedwig platzte vor Neugier.
„Nein, das konnte ich nicht, denn ich weiß es wirklich nicht. Auf Wunsch meiner Klasse unternahmen wir im Herbst 1975 eine Pilgerreise zum Grab Abdallahs, eines Vorfahren dieses Prinzen, den ich in meiner Klasse hatte und der unbedingt Deutsch und Englisch lernen sollte. Wir hatten uns zu essen und zu trinken mitgenommen, denn der Ort liegt mitten in der Wüste, und ein Lastkamel trug die Zelte, die wir in der Nähe des Grabmals aufschlugen. Am Morgen des zweiten Tages fehlte Omar, der Prinz, ich fragte die anderen, ob sie wüssten wo er sei, aber sie schauten einander nur mit verhaltenem Lächeln an – sie wussten es offenbar, mochten es mir aber nicht sagen. Es war aber auch ein Mädchen in der Klasse, Laila, mit der ich in einem kleinen Extrazelt schlief, und sie sagte mir: „Omar ist in dich verliebt und steht jeden Morgen früh auf, um seinen Liebeskummer der Morgensternin vorzutragen. Das machen verliebte Männer hierzulande seit Jahrhunderten.“
Ich konnte es nicht glauben, und am nächsten Morgen gegen vier Uhr früh kroch ich aus dem Zelt, in dem ich mit Laila schlief, und sah alsbald, wie auch Omar das Männerzelt verließ. Zum Glück bemerkte er mich nicht oder dachte, ich würde nur ein natürliches Geschäft verrichten, und beachtete mich nicht weiter. Auf einer entfernten Düne hielt er an, verbeugte sich vor der Venus, die leuchtend am Himmel stand, und flehte um ihren Rat. Er habe sich in eine wunderschöne Christin, seine Lehrerin, verliebt und wisse nicht mehr, was er tun solle. „Erlöse mich von dieser Liebe, Zohra, denn sie zerstört meine Zukunft!“ Unbemerkt verschwand ich im Frauenzelt, belauschte ihn aber auch am Morgen darauf. Ich gestehe, es schmeichelte mir ungeheuer und versetzte mich innerlich in Aufruhr, dass ich unscheinbares Lehrfräulein ohne mein Zutun diesen hübschen 18-Jährigen so in Brand gesetzt hatte. Und ich rätselte auch: Sollte ich zum Islam über- und in den künftigen Harem eines Prinzen eintreten? Ich wies das als absurd von mir, aber mein Prinz rang nicht mehr lange mit seiner Zukunft. Am dritten Morgen gelobte er Zohra, so nennen sie die Venus, er wolle auf alle Ämter und Privilegien seines Standes verzichten, nur um mich zu gewinnen. Da konnte ich mich nicht mehr beherrschen und schrie laut: „Nein, Omar, tu das nicht!“ – und wurde vor Scham auf der Stelle ohnmächtig, denn nun hatte ich mich verraten und er wusste, dass ich ihn belauscht und in gewissem Sinne auch an seiner Liebe berauscht hatte.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf einer Bahre, die von zwei Kamelen getragen wurde. Ich hatte großes Glück gehabt. Eine Karawane war zufällig des Wegs gekommen und hatte mich halb erfroren im Wüstensand entdeckt – und gerettet. Omar kam nicht mehr in meinen Unterricht, es hieß, er sei Staatssekretär im Außenministerium geworden. Bald darauf kehrte ich nach Deutschland zurück und fiel aus allen Wolken, als die Ärztin mir mitteilte, dass ich schwanger war. Das ist es, was ich auch meiner Enkelin erzählte, ihre tiefbraunen Augen leuchteten, sie umarmte und küsste mich und rief: ‚Jetzt weiß ich, liebste Großmutter, woher ich stamme!‘ ‚Woher?‘, fragte ich. ‚Aus Tausend-und-einer-Nacht!'“
Kardamom
„Wenn ich Durchfall hatte, gab Mutter mir Aplona, ein Apfelpulver. Das schmeckte so gut und ich war so ausgehungert, dass ich alle drei Tage Durchfall hatte!“ Ellinor war von ihrer Kindheitserinnerung gerührt. „Und erinnert ihr euch noch an Sepso? Ich hatte immer aufgeschürfte Knie, weil ich so viel rannte. Und auf die frische Schürfwunde kam Sepso, und das brannte höllisch, aber es lehrte mich, dass es Schmerzen gibt, die zu ertragen sinnvoll ist.“ Es entspann sich ein Gespräch über Medikamente und Kosmetika aus der Kindheit der Mädels.
Else lachte los bei der Erinnerung an das Birkin-Haarwasser, mit dem ihr Vater seine wachsende Glatze bekämpft hatte. An Uralt Lavendel mit der Postkutsche, das Lieblingsparfüm ihrer Mutter. „Du riechst nach Mottenpulver!“, hatte ihr Vater gesagt, wenn sie es trug. Und ihr fiel ein Satz ein, der auf jeder Nivea-Dose stand: Nivea enthält das hautverwandte Euzerit, und darauf beruht ihre Wirkung. „Auch was auf Brandt-Zwieback- und Köllnflockentüten stand, weiß ich heute noch!“, krähte sie. „Wollt Ihr es hören?“
„Bitte nicht!“ Hedwig winkte ab. „Findet ihr es nicht auch verdammt kalt hier? Ich bestelle mir noch einen heißen Kaffee.“
„Das Schild LUNDEN ist doch wieder angebracht.“ Ute hatte einen guten Draht zur Produktion von „Kornblumenblau“. „Es wird wieder gedreht, Massimo hat mir gesagt, heute sei eine action-Szene dran, es würde ein bisschen wild zugehen, er hätte zwei prima Statisten gewonnen, aber wir sollten uns nicht stören lassen, sondern nach ein paar Seitenblicken unser Gespräch ungerührt fortsetzen.“
„Stimmt genau,“ rief Massimo, der von ferne zugehört hatte. „Ute, ich mache dich zu meiner Assistentin!“ Massimo kam herbeigefedert und verteilte beige und braune Wolldecken. „Die Heizungspumpe tut‘s nicht, aber Max liebt solche Zufälle, und wir sind im Drehplan drei Tage zurück, wir können uns weitere Verzögerungen nicht leisten. Ihr seht prima aus in den Decken, das macht alles viel authentischer!“
Der Kaffee kam, er duftete köstlich nach Kardamom, und ein Teller Kunafa wurde von der hübschen Huda selbst auf den Tisch gestellt. Wer wollte denn noch Schwarzwälderkirsch haben, seit Huda ganz andere Gaumenwunder buk? Sogar Herta hatte sich zu Kunafa und Baklava bekehrt: „Die kann man ja auch genießen, ohne zum Islam überzutreten!“ Sie war stolz auf Huda, denn sie wohnte mit ihren Eltern und den Brüdern Mahdi und Abdul bei ihr und hatte von ihr die Wochentage, Monate, Zahlen und die Uhrzeit gelernt, denn die einzigen deutschen Worte, die die Familie kannte, als sie zu ihr kam, waren: Scheiße, kaputt, Arsch, verboten und ficken.
„Ich wollte dir noch mal danken, Ellinor,“ sagte Herta, während sie Huda nachsah, die sich auf unnachahmliche Weise anmutig bewegte in ihrem langen weißen Bäckerkittel. „Ohne deine Fürsprache hätte Frau Selbach sie bestimmt nicht eingestellt.“
„Else hat uns so viel aus Amman erzählt, dass ich dachte, ein bisschen frischer Wind aus dem Orient könne uns guttun. Ich hoffe, dass Hudas Brüder sich inzwischen damit abgefunden haben, dass ihre Schwester einen Job hat und sie immer noch nicht.“
„Davon profitieren sie ja auch, denn Huda gibt die Hälfte ihres Lohns zu Hause ab. Womit sie sich weniger gut abfinden, ist, dass Huda mit einem einheimischen Jungen geht -“
„- der zufällig mein Enkel Bernd ist,“ ergänzte Ellinor. „Ich habe ihn mir vorgeknöpft und ihm gesagt, dass er Huda in Gefahr bringt. Aber er sagt, das sei ihre Entscheidung, und Mahdi und Abdul seien keine Idioten. Er könne sich von Huda nicht trennen, er habe sich in sie verliebt.“
Inzwischen war es trotz kaputter Heizung im Café voll geworden, die Sänger eines Shantychors und eine Frauenturngruppe hatten sich eingefunden, alle wurden mit Decken ausgestattet, Massimo saß vereinzelt an einem Tisch und schaute minütlich auf seine Armbanduhr – er mimte einen ungeduldig wartenden Reisenden, stand aber per Handy mit Max Matzke in Kontakt. Und noch zwei weitere Gäste kamen herein. Die Mädels schenkten ihnen zunächst keine Aufmerksamkeit, denn sie waren mit dem Gedichtband beschäftigt, den Ellinor bei Books on Demand in Auftrag gegeben und mit dem Diamanten bezahlt hatte, der aus der Asche ihres Verehrers gepresst worden war. Endlich war das Büchlein herausgekommen, und Ellinor hatte ein Exemplar mitgebracht.
Die beiden jungen Männer trugen Hoodies und bestellten ausschließlich Kaffee. Herta hörte ihre Stimmen und drehte sich nach ihnen um. „Hallo Mahdi und Abdul, wollt ihr mal sehen, wo eure Schwester arbeitet?“ Sie sahen einander an und erwiderten nur „Hallo!“ In diesem Moment wurde auf der Estrade, wo die Kamera stand, eine Klappe geschlagen, Huda kam herein, einen Teller mit Apfelkuchen auf der Hand. Mahdi und Abdul sprangen auf, rissen Huda um, der Apfelkuchen lag vermischt mit den Scherben des Tellers am Boden, aber die Mädels beobachteten nur aus den Augenwinkeln, was vorging, und gaben den BoD-Band von einer zur anderen weiter, da hörte man wütend geschriene arabische Worte, zwei Schüsse fielen, die beiden jungen Männer überwanden den Widerstand von zwei Shantysängern, die sich ihnen entgegengeworfen hatten, und verschwanden.
„O mein Gott!“, schrie Herta, „das kann nicht wahr sein!“ Sie kniete neben der am Boden liegenden Huda und sah mit Entsetzen eine große Blutlache am Boden.
„That’s it!“ rief Max Matzke von der Estrade. Huda stand lächelnd auf.
„Da hast du uns aber einen ordentlichen Schreck eingejagt!“, schimpfte Hedwig. „Ce n’est pas rigolo!“ Das Filmblut und der Apfelkuchenmatsch wurden aufgewischt.
„Im ersten Moment habe ich das Blut für echt gehalten,“ sagte Herta. „Aber dann merkte ich, dass es nicht echt war.“
„Woran?“, wollte Ute wissen.
„In der Kälte hier hätte es gedampft.“
Die Hochzeit
„Dass sie nicht einmal das Ende der Trauerzeit einhalten konnte!“ Herta, auf der Rückbank sitzend, seufzte. Aber nicht nur Ellinors Eile, sich wieder zu verheiraten, hatte sie gestört. Es war die Art dieser Ehe, ihre Gleichgeschlechtlichkeit, die sie, obgleich sie seit kurzem legal war, befremdete. Nur mit Mühe hatten Else, Hedwig und Ute sie überreden können, die Einladung anzunehmen. Aber für alle war es das erste Mal, dass sie an einem Ereignis dieser Art teilnahmen. Seit dem 1. Oktober war es möglich, dass ein Mann einen Mann, eine Frau eine Frau heiratete. Ellinor und Louise hatten dieses Datum extra abgewartet, weil sie sich mit der bis dahin möglichen eingetragenen Lebensgemeinschaft nicht begnügen, sondern gleich in den Ehehafen einlaufen wollten. Die vier Mädels hielten, wie Ellinor ihnen empfohlen hatte, am Rheinufer, schälten sich aus Hedwigs Citroen, glätteten die zerknautschten Kleider, richteten die Frisuren und brauchten nur um die Ecke zu gehen, um vor der Kunsthandlung Nautschke und Grell in der Bolkerstraße zu stehen, in deren Fenstern unbegreifliche Bilder von einiger, um nicht zu sagen, riesiger Größe standen, die sie beeindruckt, aber auch verständnislos musterten. „Warum hat der Maler dort einen Strohwisch ins Bild geklebt?“, murmelte Ute ratlos. „Das ist eben moderne Kunst,“ sagte Hedwig weise, „in Paris habe ich noch viel Absurderes gesehen. Aber wo wird hier nun gefeiert?“ Drei jüngere Paare, festlich gekleidet, betraten das Haus, die Mädels schlossen sich ihnen an, durchquerten die wilhelminische Eingangspracht – und landeten nicht etwa auf einem düsteren Hinterhof mit Mülltonnen, sondern in einem Garten, in dem das Laub der Ahornbäume schon zu erröten begann, in den Ebereschen leuchteten die roten Beeren, der gepflegte Rasen war sattgrün, Blumengebinde von Dahlien und Astern standen auf den Tischen – und die glücklich strahlende Ellinor kam ihnen im schwarzen Frack entgegen, umarmte eine nach der anderen, zuletzt die peinlich berührte Herta, die ihr die Frage nicht ersparen konnte: „Hättest du nach Alfons‘ Tod nicht noch ein wenig warten können?“ „Herta, er ist doch schon vor drei Jahren gestorben! Drei Jahre habe ich ein Wesen gepflegt, das mich ebenso wenig erkannte wie ich es, das war Trauerzeit genug! Sein physisches Ende war für mich eine herbeigesehnte Befreiung!“ Schicke sexy Kellnerinnen boten Champagner auf Tabletts in Vulvenform an, und dann begrüßte die frisch Angekommenen auch Louise, ganz in weißem Tüll, auf ihrer Brust funkelte der Diamant aus Holgers Asche, Ellinor trug den ihren auf dem Revers. Louise zeigte sich total gerührt, dass die Mädels den weiten Weg auf sich genommen hatten. Ein Kamerateam war zugegen, um die Höhepunkte dieser ersten Hochzeit ihrer Art in NRW für den WDR einzufangen. „O, da ist Massimo!“, rief Ute glücklich aus, „wie schön, dass du ihn und Matzke beauftragt hast, Ellinor, da fühlen wir uns gleich wie im Café im Bahnhof Lunden!“ „Aber dies ist nicht die Serie ‚Kornblumenblau‘, dies ist Wirklichkeit!“, rief sie stolz aus einer Runde anderer Gäste, die sie baten, ein bestimmtes Gedicht vorzulesen.
„Es ist das Gedicht, mit dem unsere Liebe begonnen hat. Ich las es Louise vor – sie kannte die Gedichte ja gar nicht, die Holger an mich gerichtet hatte. Ich wollte ihr noch mehr vorlesen – aber an diesem Tage lasen wir nicht weiter!“ Sie setzte sich in ein Lederfauteuil, Louise nahm anmutig auf der Armlehne Platz, und Ellinor las mit stockender Stimme:“
„Wär ich doch eine Frau!“ Sie hielt inne und schüttelte den Kopf. „Nein, das kann ich nicht einfach so vorlesen! Wäre einer von den Herren bereit, meinen Verehrer Holger Grell zu spielen, der Louises Mann war? Wie wäre es mit dir, Nils-Peter?“ Die Mädels steckten die Köpfe zusammen: „Das ist der Intendant des hiesigen Schauspielhauses!,“ raunte Edvigue, „mondieu, wie verloren sind wir unter so viel Prominenz!“ Nils-Peter überflog das Gedicht, dann kniete er vor Ellinor nieder und rezitierte:
„Wär‘ ich doch eine Frau! Vertrauensvoll
Kämst du zu mir mit deinem ganzen Leid,
Entrichtetest der Tränen bittern Zoll,
Ließest mich schau’n in jede Traurigkeit.
Ich böte dir der besten Freundin Brust,
Die immer Zeit hat, zuhört, tröstet, rät,
Und die, wenn du mal um dich schlagen musst,
Den Rücken hinzuhalten nicht verschmäht.
Dein Leben wäre meins und ungetrübt
Von jenem Misstraun zwischen Mann und Frau,
Das immer aufkommt, wenn es heißt, ‚er liebt,‘
Errichteten wir treuer Freundschaft Bau.
Verfluchter Phallus, der dies Glück mir raubt,
Verflucht der Zufall, der ihn angeschraubt!“
Ellinor und Louise versanken in einem nicht enden wollenden Kuss.
Zögern, Schweigen – dann lachten und klatschten die Gäste, einige riefen: „Bravo!“, und es war nicht auszumachen, ob das mehr dem Gedicht oder dem prominenten Theatermann oder dem Paar galt, das es zusammengeführt hatte. Sogar Herta lächelte zustimmend. Und wenig später wurde die Hochzeitstorte angeschnitten. Zu der sagte Ellinor: „Ich wurde gefragt, was das für Beeren sind auf dem Baiser. Nein, es sind keine Johannisbeeren, es sind Vogelbeeren. Habt keine Angst, dass wir euch vergiften wollen! Sie wurden kurz erhitzt! Eine Dichterin hat die Hochzeitstorte mitgebacken: Marina Zwetajewa.“ Sie hielt kurz inne, zeigte auf die Ebereschen ringsum und rezitierte auswendig:
„Als der Vogelbeerbaum
Die Blätter verloren
Flammte er rot:
Ich wurde geboren.
Sonnabend war’s,‘
Der Streit begann‘
Von hundert Glocken:
Evangelist Johann.
Heute noch treibt’s mich
Des bittern und heißen
Vogelbeerbaumes
Früchte zu beißen.
Und eben diese russische Dichterin – die Dichter genannt werden wollte – hat in ihrer französischen Schrift ‚Mon frère féminin‘, mein weiblicher Bruder, die Worte gesagt, die Louise jetzt sprechen möchte …“ Louise warf sich Ellinor an die Brust und seufzte in die tiefe Stille:
„Du bist meine Freundin, du bist mein Gott, du bist mein alles.“
Als die vier Mädels am nächsten Tag, noch etwas verkatert und mit zertanzten Schuhen, heimfuhren, meinte Hedwig: „Die Schrift ‚Mon frère féminin‘ muss ich mir unbedingt besorgen und daraus in ‚Alma an der Ostsee‘ vorlesen, meiner Loge.“
„Die Torte fand ich gewöhnungsbedürftig!“, sagte Else; sie hatte die Beeren vorsichtshalber diskret unterm Tisch entsorgt.
Ute kämpfte mit ihren Blähungen: „Das vegane Buffet war klasse. Aber ihr müsst mich entschuldigen – bitte mach mal ein Fenster auf, Edvigue!“
„Dass Louise Ellinor zu ihrem Gott macht, hat mir, wie ihr euch denken könnt, nicht gefallen. Aber wenigstens wurde der Evangelist Johannes erwähnt.“ Herta war entschlossen, sich mit Wenigem zufrieden zu geben. Doch die Aussicht, am Abend im Fernsehen zu sehen zu sein, bedrückte sie. „Hoffentlich erkennt man mich nicht; unsere Gemeinde lehnt das neue Gesetz entschieden ab. Ich habe darauf geachtet, Matzke immer den Rücken zuzukehren.“ Ute, Else und Hedwig hatten das Gegenteil getan und wollten Freunde anrufen, dass sie es sich anschauten. Aber alle fragten sich: Würden sie sich ohne Ellinor, die nach Düsseldorf verzogen war, noch weiterhin treffen?
Anmerkung von Quoth:
Das Gedicht von Marina Zwetajewa übersetzt von Christa Reinig
In: Marina Zwetajewa: Vogelbeerbaum
Ausgewählte Gedichte
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin